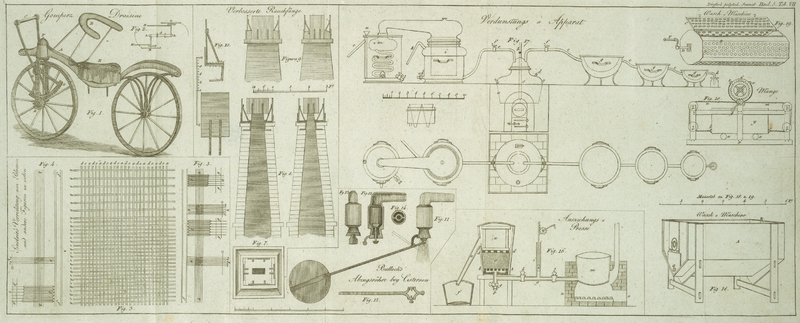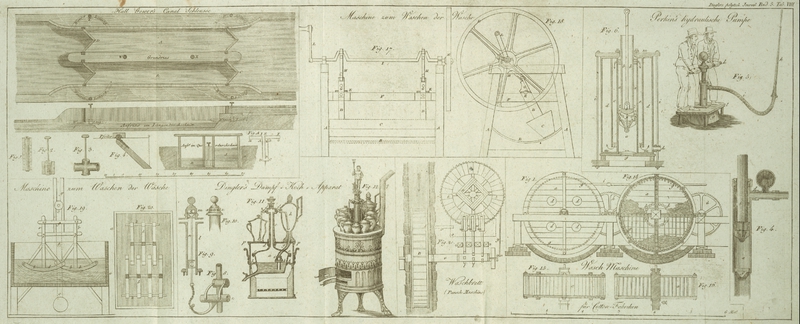| Titel: | Bericht des Herrn Hachette über eine Waschmaschine von Herrn Abbe' de Meilleraie. Beschreibung derselben nebst der Beschreibung mehrerer zum Waschen, Bleichen und Plätten gebräuchlichen Maschinen. |
| Fundstelle: | Band 5, Jahrgang 1821, Nr. LXVIII., S. 425 |
| Download: | XML |
LXVIII.
Bericht des Herrn Hachette über eine Waschmaschine von Herrn Abbe' de Meilleraie. Beschreibung derselben nebst der Beschreibung mehrerer zum Waschen, Bleichen und Plätten gebräuchlichen Maschinen.
Aus dem Bulletin de la Société d'Encouragement etc. Februar 1821. S. 49.
Mit Abbildungen auf Tab. VII. und VIII.
[Hachettes Bericht einer Waschmaschine.]
Wir waren beauftragt eine Maschine zur Reinigung der
Waͤsche zu untersuchen, deren Zeichnung und Beschreibung und von dem Hrn. Abbé de
Meilleraie, Korrespondenten des Conseil général d'Agriculture mitgetheilt
wurde. Sie ist in England unter dem Namen washing-machine bekannt, und besteht aus einer sechsseitigen
Trommel, die aus durchloͤcherten Brettern zusammengefuͤgt ist. Diese
Trommel, deren Achse horizontal ist, dreht sich in einem Bottiche, der mit heißer
Lauge oder mit Seifenwasser beinahe vollgefuͤllt ist; man fuͤllt sie
zur Haͤlfte mit Waͤsche; die Achse derselben wird an dem Bottiche so
angebracht, wie eine Trommel, in welcher man Kaffee brennt, auf dem Blechofen. Ein
Theil der Trommel ist immer außer der Fluͤssigkeit in dem Bottiche, und ein
Brett derselben oͤffnet sich, wie eine Thuͤre, zur Aufnahme der
Waͤsche.
Der Gebrauch des Waschblaͤuels bleibt indessen unerlaͤßlich, wenn
ungleich schmuzig gewordene oder stark geflekte Waͤsche, wie Hadern oder
Hemden, welche Handwerker eine Woche lang getragen haben, weiß gewaschen werden
sollen. Was die Waͤsche wohlhabender Leute betrifft, die nicht stark
beschmuzt ist, oder uͤberhaupt gleichfoͤrmig schmuzige Waͤsche,
wie Tuͤcher, Vorhaͤnge, WeiberroͤkeSe. Hochwuͤrden der Hr. Abbé
scheint die Weiberroͤke wohl nie sehr genau besehen
zu haben, wenn er sie gleichfoͤrmig
schmuzig nennt; sie gehoͤren wohl sehr oft unter die linges inégalement sales er fortement
tachés. A. d. Ueb. etc., so scheint die
fuͤr dieselbe allerdings vollkommen richtig berechnet, sie schont die
Waͤsche und spart Zeit bei der Reinigung derselben.
Wir haben die Ehre die Einruͤkung der Beschreibung und Zeichnung der Maschine
des Hrn. Abbé in den Bulletin de la
Société vorzuschlagen, und den Hrn. Redakteur einzuladen,
damit dasjenige zu verbinden, was er in den neuen englischen Encyklopaͤdien
sowohl uͤber diese als uͤber andere aͤhnliche Maschinen, die
auf den Baumwollen-Bleichen unter dem Namen dash-wheel vorkommen, finden wird.
Angenommen in der Sizung d. 21. Februar 1821.
Unterzeichnet: Hachette, Berichterstatter.
Beschreibung der Waschmaschine des Hrn. Abbe Meilleraie.
Die Maschine ist in den Verhaͤltnissen gezeichnet, in welchen der Verfasser
sich gegenwaͤrtig derselben bedient: er sezt sie durch das Wasser seiner
Muͤhle in Bewegung.
AFig. 18. Tab.
VII. ist ein, wo moͤglich, aus Ulmenholze verfertigter Behaͤlter,
dessen Gefuͤge genau schließen muß, damit er so wasserdicht wie ein Faß ist.
Er ruht auf einem hoͤlzernen Schraͤgen, und laͤuft spizig zu,
um zu seiner Fuͤllung so wenig Wasser als moͤglich zu brauchen. Man
leert ihn bei dem Loche G aus, welches mit einem
Stoͤpsel von Kork verstopft wird.
BFig. 19. ist
eine lange sechsseitige Kiste, gleichfalls aus Ulmenholze, an allen Seiten
durchloͤchert, wie ein Bouteillen-Brett, mit runden einen Zoll im
Durchmesser weiten Loͤchern, um das Wasser frei aus und einstroͤmen zu
lassen. Das Innere dieser Kiste ist vollkommen abgeglaͤttet, um die
Waͤsche nicht zu zerreissen. Drei Brettchen sind darin, wie in einem
Butterfasse, angebracht, um das Wasser zu brechen, und das Schuͤtteln der
Waͤsche zu vermehren.
C eine der Seiten dieser Kiste, ist der Dekel, der eine
Scharnier von Kupfer hat um Rostfleken zu vermeiden, und außen mit zwei kupfernen
Haͤkelchen geschlossen wird.
DD sind Zapfen an jedem Ende der Kiste, auf
welchen sich dieselbe dreht: einer dieser Zapfen paßt in die Kerbe E des Behaͤlters, an dem anderen ist eine Kurbel
F, die hier bequemer, als ein Treibwerk mit
eingreifenden Zahnraͤdern ist.
Man bringt diese Kiste gerade so uͤber den Behaͤlter, wie eine
Waͤlze, in welcher man Kaffee roͤstet, uͤber den Ofen: man
fuͤllt sie ungefaͤhr zur Haͤlfte mit der Waͤsche, welche
man waschen will, und die man vorher eingeweicht hat.
Man gießt in den Behaͤlter Seifenwasser oder Lauge: beide so heiß wie
moͤglich.
Man dreht hierauf die Kiste, wie ein Butterfaß, nur schneller: dreht man mit der
Hand, so kehrt man von Zeit zu Zeit die Bewegung um, um das Schuͤtteln und
den Druk zu vermehren. Die Waͤsche reibt sich an sich selbst, an den
Waͤnden der Kiste, und an den Brettchen; das Wasser, welches
bestaͤndig ein- und ausstroͤmt, waͤscht sie ab, und
reinigt sie. Gewoͤhnlich reichen 10 Minuten hierzu hin, wenn man fleißig
dreht: nach dieser Zeit kann die Waͤsche ausgenommen und neue dafuͤr
eingelegt werden. Man sezt wieder Seifenwasser oder Lauge zu, welche man in einem
nahe stehenden Kessel immer siedend erhaͤlt. Dieses Wasser dient als Ersaz
fuͤr das verloren gegangene oder eingesogene und zur neuen Erwaͤrmung
des noch vorhandenen: man faͤngt hierauf mit demselben die Operation mit der
neu eingelegten Waͤsche wieder von vorne anDer Uebersezer glaubt, daß es gut
waͤre, wenn man, außer der bloß horizontalen Umdrehung der Kiste,
auch eine abwechselnd schiefe, so daß die Kiste ein mal mit einem Zapfen
hoͤher, dann mit ebendemselben Zapfen tiefer liefe, veranlaßte, was
durch zwei gegenuͤberstehende Kerben von verschiedener Tiefe an jeder
Endwand des Behaͤlters leicht erzielt werden koͤnnte. Dadurch
kaͤme neuer Druk auch auf die Endtheile der Waͤsche. A. d.
Ueb..
Die auf diese Weise gewaschene Waͤsche wird dann sorgfaͤltig
ausgespuͤlt; haͤtte man jedoch Hemden zu waschen, die einige Zeit
getragen wurden, so muͤßte der Kragen und das Besez vorne an den Aermeln, die
mehr schmuzig zu werden pflegen, besonders hergenommen werden: fuͤr die
gewoͤhnlicht Waͤsche ist jedoch diese Art zu waschen hinreichend
genug. Es ist offenbar, daß feine Waͤsche, wie Frauenzimmer-Kleider,
Hauben etc. auf diese Weise weit mehr als durch den Waschblaͤuel geschont werden, der sie
zerreißt und zerschneidet, wenn man mit der Schneide desselben auf die
Waͤsche schlaͤgt.
Auf diese Weise, die in England und vorzuͤglich zu London allgemein ist,
koͤnnen zwei bis drei Personen mit Leichtigkeit, mit viel geringerem
Seifenaufwande und mit weit weniger Muͤhe eben so viele Waͤsche
waschen, als zwoͤlf Waͤscherinnen auf die gewoͤhnliche Weise
kaum vermoͤgen. Hr. Abbé de Meilleraie
bedient sich dieser Maschine ununterbrochen seit 15 Jahren und versichert damit sehr
zufrieden zu seyn.
Beschreibung eines Waschrades, (dash-wheel), wie man dasselbe in den Kattun-Manufakturen gewoͤhnlich zu gebrauchen pflegt.
Das Waschrad, welches in so vielen Kattun-Manufakturen Englands und
Schottlands gebraͤuchlich istDiese
Waschmaschine ist schon in den „Nachtraͤgen zu der
vollstaͤndigen Bleichkunst der Buͤrger O'Reilly und
Chaptal, herausgegeben von Eschenbach, Leipzig 1804“ so wie
im ersten Bande des Journal fuͤr die Druk-
Faͤrbe- und Bleichkunde, Augsburg 1806. beschrieben und
abgebildet. Da indessen viele unserer Leser nicht im Besize dieser Schriften
seyn duͤrften so ließen wir sie der Vollstaͤndigkeit wegen
abbilden. D., dient zur Erleichterung des Bleichens der
Fabrikate; man erreicht durch dasselbe auf bequemere, wirtschaftlichere und
schnellere Weise denselben Zwek, wie durch den gewoͤhnlichen
Waschblaͤuel, und bringt dieselbe Wirkung hervor wie durch die Drehkiste des
Hrn. Abbé de Meilleraie, obschon seine Theile alle weit groͤßer
sind.
Diese Maschine, deren Auf- und Grundriß und Durchschnitt Fig. 13, 14, 15 und 16. Tab. VIII. darstellt,
besteht aus einem hohlen senkrechten Rade aa von
6–7 Fuß im Durchmesser, welches von einer horizontalen Achse getragen, und
aus Blaͤttern und Dauben von weißem Holze verfertiget ist. Das Wasser, welches die
Zeuge waschen soll, tritt durch die Loͤcher bb in dieses Rad, und wird durch eine Roͤhre i herbeigefuͤhrt, welche mit ihrer Oeffnung denselben
gegenuͤber steht. Die Zeuge werden durch die Oeffnungen dd in das Rad gebracht und durch dieselben
Oeffnungen, nachdem das Waschen voruͤber ist, wieder herausgezogen.
Das Innere des Rades, welches vollkommen glatt und eben seyn muß, ist in
Faͤcher getheilt, welche durch Loͤcher mit einander in Verbindung
stehen, damit das Wasser frei durch dieselben stroͤmen kann. Am Umfange des
Rades befindet sich zu beiden Seiten desselben eine Reihe von Loͤchern gg, um das schmuzige Wasser auslaufen zu
lassen.
In einigen Manufakturen sind diese Raͤder an ihrem Umfange mit Schaufeln
versehen um den Stoß, den das stroͤmende Wasser ihnen mittheilt, aufzunehmen.
In anderen werden drei bis vier solche Raͤder zugleich durch ein Wasserrad
bewegt, welches seine Thaͤtigkeit denselben mittelst Zahnraͤder hh mittheilt. Jedes Rad hat eine Bremsstange, um
nach Belieben die Bewegung desselben zu stellen, ohne daß dadurch der Lauf der
uͤbrigen Raͤder unterbrochen wuͤrde.
Man bringt in jedes dieser Faͤcher zwei Stuͤke Zeuge, welche, wenn sie
Wasser eingesogen haben, abwechselnd so wie das Rad sich dreht, von einer
Scheidewand auf die andere fallen: da diese Zeuge hier nur maͤßig
geruͤttelt werden, leiden sie dadurch nicht im mindesten. Eine Viertel Stunde
reicht zu, um die acht in dem Rade enthaltenen Stuͤke vollkommen zu reinigen
und zu waschen.
Maschine zum Auslaugen der Hauswaͤsche.
Hr. Christian, Direktor des Conservatoriums der
Kuͤnste und Gewerbe, hatte die Gefaͤlligkeit uns die Zeichnung dieser
Maschine mitzutheilen, deren die Englaͤnder sich zu ihrem Hausgebrauche bei
Reinigung ihrer Waͤsche bedienen: sie ist von vorne und von der Seite
dargestellt in Fig.
17 und 18. Tab. VIII.
A ist das Gestell der Maschine, zwischen dessen Pfosten
eine Wanne B angebracht ist, welche die Lauge oder das
Seifenwasser und die zu waschende Waͤsche aufnimmt. Die Waͤsche wird
in derselben mittelst eines Stuͤkes Holzes C,
welches, um nichts zu zerreissen, unten zugerundet ist, kraͤftig
geruͤttelt und gedruͤkt: dieses Stuͤk Holz nimmt die ganze
Laͤnge der Wanne ein, und paßt genau in die hohle Form derselben. Es wird von
den beiden Stangen DD, die gleichfalls von Holz
sind, getragen, und diese Stangen bewegen sich mittelst Zapfen, die in den
Fuͤtterungen EE laufen, welche an den
Querbalken des Gestelles befestigt sind. Die Stangen DD haben eiserne Aufsaͤze GG,
welche mittelst einer Scharnier an Hebeln HH
befestigt sindDas Original hat
hier fuͤr HH das Wort bielle, welches weder im Dictionaire de l'Academie, noch in Mozin's, Schmidt's oder Schwan's Woͤrterbuͤchern vorkommt. A. d.
Ueb., die eine gebogene Achse in Bewegung sezt. Diese Achse hat an
dem einen Ende ein Schwungrad K, an dem anderen eine
Kurbel L.
Es ist offenbar, daß durch das Drehen der Kurbel abwechselnd der Hebel auf-
und niedersteigt, und daß dieser, indem er auf die eisernen Aufsaͤze GG wirkt, den Stangen DD, und durch diese auch dem Holzstuͤke C eine oscillirende Bewegung mittheilt, welche eine krumme Linie
beschreibt, die der Form der Wanne folgt, und bald hin bald her schiebt.
Eine andere Maschine zum Waschen der Wäsche.
Diese Maschine, deren Auf- und Grundriß Fig. 19 und 20. Tab. VIII.
darstellt, hat viele Aehnlichkeit mit der vorigen, obschon derselben hier die
Bewegung auf eine andere Weise mitgetheilt wird.
Der Bottich aa, in welchen man die Waͤsche
einsenkt, nachdem sie in einem dazu besonders bestimmten Apparate vorlaͤufig
der Einwirkung der Daͤmpfe ausgesezt wurde, enthaͤlt ein leichtes
Seifenwasser: zwei kreisfoͤrmige Kloͤppel oder Ruͤhrer bb bewegen sich innenwendig in dem Bottiche. Eine
Art schwingenden Pendels cc theilt seine Bewegung
den Kloͤppeln bb mit, welche mittelst eines
Schwengels g aufgehaͤngt erhalten werden. Eine
unterhalb angebrachte Querstange h verbindet die Stangen
rr mit dem Pendel cc: bewegliche Achsen sind an den Punkten iii.
Die Kraft, welche das Pendel cc in Bewegung sezt,
ist außen an einem Griffe l angebracht; jeder
Kloͤppel bb besteht aus mehreren parallelen
krummen Stuͤken Holz, welche durch eine durchlaufende Stange k an ihrem hinteren Ende verbunden sind. Diese krummen
Stuͤke Holzes der Kloͤppel laufen wechselweise in einander, so daß die
Hoͤlzer des einen in die Zwischenraͤume der Hoͤlzer des anderen
passen, und sich immer frei schwingen koͤnnen, so oft die bewegende Kraft auf
das Pendel cc wirkt.
Dieses wechselweise Schwingen der beiden Kloͤppel in entgegengesezter Richtung
druͤkt und ruͤttelt die Waͤsche im Seifenwasser und erleichtert
die Entfernung der Unreinigkeiten.
Wenn man die Waͤsche in den Bottich bringen oder herausnehmen will, hebt man
die Kloͤppel zur erforderlichen Hoͤhe empor und befestigt sie mit
einem Schlußnagel: in dieser Absicht sind die Pfosten y
mit einem laugen Falze eingeschnitten, der den Kloͤppeln gestattet so hoch
als moͤglich hinanzusteigen, ohne daß deßhalb die Drehungs-Achse
muͤßte.
Nachdem die Waͤsche in den Bottich gethan wurde, sezt ein Arbeiter das Pendel
solang in Bewegung, bis das Seifenwasser aufhoͤrt zu schaͤumen: dann hebt er die
Kloͤppel neuerdings, man nimmt die Waͤsche heraus und spuͤlt
sie in fließendem Wasser rein.
Das Waschbrett. (Pansch-Maschine).
In der Gegend von Manchester und zu Jouy bedient man sich eines horizontalen
Waschbrettes bb, dessen Grundriß Fig. 21. Tab. VIII.
vorstellt. Dieses Brett, von 12–15 Fuß im Durchmesser, wird von einem sich
drehenden Pfosten gehalten; sein Umfang ist mit starken gut geglaͤtteten und
vollkommen unter einander verbundenen Eichenbrettern so bedekt, daß es einen
abgestuzten Kegel bildet.
Zweierlei Arten von Stuͤzen tragen dieses Brett: die einen sind gerade und
horizontal; die anderen neigen sich von dem Umfange des Rades gegen den unteren
Theil des Pfostens, und geben ihm die gehoͤrige Staͤrke um die
Schlaͤge des Waschblaͤuel zu ertragen. Ein eiserner Reifen bindet und
haͤlt die Felgen des Brettes; er ist mit Zaͤhnen, wie eine
Saͤge, versehen, und diese Zaͤhne stehen 4 bis 6 Zoll von einander.
Diese Zaͤhne werden nach und nach von einer mit einer Kurbel Z versehenen Eisenstange Y
zuruͤkgestossen, wodurch, je nachdem man dreht, das Rad abwechselnd
vor- oder ruͤkwaͤrts bewegt wird; sie haͤkelt sich
naͤmlich abwechselnd in jeden Zahn ein, und noͤthigt durch seine
Bewegung das Rad ihr zu folgen und sich um seine Achse zu drehen. Eine andere auf
einer festen Achse bewegliche Stange, die man in der Figur nicht sieht, hebt bei
jeder Drehung des Brettes sich etwas auf, und faͤllt gegen den Zahn nieder,
der sich darbiethet, so daß sie, waͤhrend die erste Stange neuerdings in
einen anderen Zahn vorgreift, das Zuruͤktreten des Brettes hindert. Dieses
abwechselnde Spiel der beiden langen macht, daß das Rad in ununterbrochener
Aufeinanderfolge von Bewegung und Ruhe sich fortdreht.
Auf der anderen Seite des Randes sind drei oder vier große
Waͤschblaͤuel mmm, deren Stiele,
beim zweiten Drittel ihrer Laͤnge, von einer und derselben Achse
durchschossen sind. Hinter dieser Achse befindet sich ein Wellbaum r mit Daumen ll, an
dessen Ende ein Wasserrad B angebracht ist. Die Daumen
stoßen, waͤhrend der Umdrehung des Wellbaumes, abwechselnd auf die hinteren
Enden der Stiele der Waschblaͤuel, heben einen derselben nach dem anderen
auf, und da sie sie wieder auslassen, so machen sie dieselben abwechselnd auf die
Waͤsche fallen, welche auf der Oberflaͤche des kegelfoͤrmigen
Brettes ausgebreitet da liegt: die Waͤsche wird auf diese Weise weit
kraͤftiger, genauer und schneller durchgewalkt, als eine Menge Arbeiter dieß
kaum zu thun vermoͤchte.
Wenn die Maschine in Thaͤtigkeit ist, stellt der Arbeiter sich auf das
Waschbrett bei x, um die Waͤsche in verschiedener
Richtung zu kehren und legen, damit sie in abwechselnd verschiedener Lage die
Schlaͤge der Waschblaͤuel aufnimmt. Waͤhrend die Waͤsche
unter den Waschblaͤueln durchlaͤuft, wird sie durch einen Wasserstrahl
befeuchtet, welchen das Wasserrad in einen kleinen Canal s leitet, aus welchem er in den Wasserbehaͤlter o gelangt, von dem
das Wasser durch die am Boden angebrachten Loͤcher auf die Waͤsche
faͤllt.
Die Bretter, welche zur Bekleidung des Waschbrettes dienen, muͤssen mit
hoͤlzernen Naͤgeln aufgenagelt werden: Eisen ist, wegen Gefahr der
Rostfleken, auf das sorgfaͤltigste zu vermelden.
Wenn kein fließendes Wasser benuͤzt werden koͤnnte, so kann man die
Maschine durch ein Pferd in Bewegung sezenUmstaͤndlichere Beschreibungen nebst zwei detaillirtern
Abbildungen solcher Pretsch- oder Panschmaschinen die mit dem besten
Erfolg in
vielen Fabriken Frankreichs und Deutschlands Eingang gesunden haben, findet
man in Dinglers Journal fuͤr die Druk-, Faͤrbe-
und Bleichkunde. Augsburg 1806. D..
Maschine zum Plaͤtten oder Mangen der Waͤsche.
Das Conservatorium der Kuͤnste und Gewerbe besizt diese nuͤzliche
Maschine, die nichts anderes als eine kleine Mange (calandre) mit beweglicher Kiste ist.
Die zu plaͤttende Waͤsche wird sorgfaͤltig auf Walzen Fig. 20. Tab.
VII. aa gewikelt, welche sich zwischen einer
vollkommen ebenen und glatten Flaͤche x und einer
beweglichen Kiste y befinden. An den Punkten b und c dieser Kiste
befinden sich zwei Ketten, welche uͤber die Rollen rrr laufen und auf der Oberflaͤche einer
gegossenen Platte f widersinnig zusammen treffen. Die
Kette cm ist an dem Punkte t der Platte f, und die Kette bn an dem Punkt v
befestigt; die Achse dieser Platte wird durch eine Kurbel g, und mittelst eines Zahnwerkes l, bestehend
aus einem Triebstoke und einem Zahnrade, in Bewegung gesezt.
Die Wirkung der Maschine ist leicht einzusehen; wenn man die Kurbel nach einer Seite
dreht, so wird die Kiste y von der Rechten zur Linken
laufen, und wenn man die Kurbel zuruͤkdreht, so wird diese Kiste von der
Linken zur Rechten zuruͤk gefuͤhrt. In die Kiste selbst legt man so
viele Gewichte als noͤthig sind um jene Schwere zu erzeugen, welche die
Operation des Mangens oder Glaͤttens fordert.