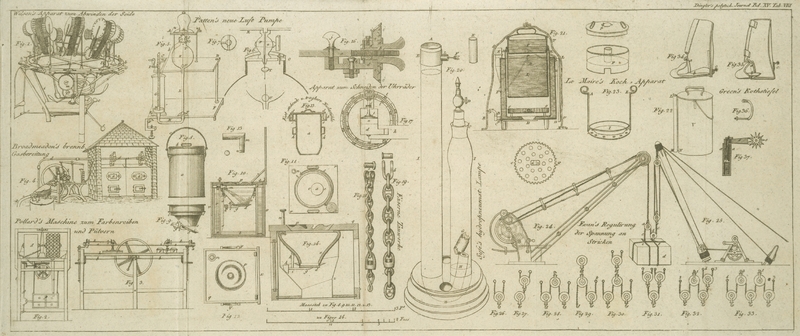| Titel: | Verbesserung an Maschinen zum Farbenreiben in verschiedenen Zweigen der Mahlerei, und auch zu anderen nüzlichen Zweken (z.B. Pülvern verschiedener Materialien in verschiedenen Fabriken), worauf Georg Pollard, Messing-Gießer, ehevor in Rupert-Street in der Pfarre St. James, Middlesex, gegenwärtig in Gloucester-Place, Kentish-Town, am 19ten Jänner 1824 sich ein Patent geben ließ. |
| Fundstelle: | Band 15, Jahrgang 1824, Nr. XCII., S. 407 |
| Download: | XML |
XCII.
Verbesserung an Maschinen zum Farbenreiben in
verschiedenen Zweigen der Mahlerei, und auch zu anderen nüzlichen Zweken (z.B. Pülvern
verschiedener Materialien in verschiedenen Fabriken), worauf Georg Pollard, Messing-Gießer, ehevor in
Rupert-Street in der Pfarre St. James, Middlesex, gegenwärtig in Gloucester-Place,
Kentish-Town, am 19ten Jänner 1824 sich ein
Patent geben ließ.
Aus dem London Journal of Arts and Sciences. N. 44. S.
72.
Mit Abbildungen auf Tab.
VIII.
Pollard's Verbesserung an Maschinen zum Farbenreiben.
Der Gegenstand dieses Patentes ist: 1tens ein Apparat zum
Zerkleinen der Erze, Mineralien, harten Arzneikoͤrper, und anderer harter
Substanzen, und zum Puͤlvern derselben. 2tens ein Apparat, wodurch mehrere
dieser Substanzen entweder im fluͤßigen oder trokenen Zustande zu Farben,
Drukerschwaͤrze und verschiedenen aͤhnlichen Zweken abgerieben oder
gemahlen werden koͤnnen.
Fig. 2 ist ein
geometrischer Aufriß des Zerkleinungs-Apparates, wie er auf einem festen
hoͤlzernen Gestelle aufgezogen ist. Er besteht aus zwei Walzen, wovon die
eine gezaͤhnt, die andere flach ist: beide drehen sich auf einem festen
Bette, auf welches die zu zerkleinenden Materialien aufgeschuͤttet werden.
Eine Mittelachse a, welche durch ein Triebwerk in
Bewegung gesezt wird, und mit irgend einer Triebkraft in Verbindung steht, treibt
die gezaͤhnte Walze c, und die flache d, um: die erste bricht und zerkleint die
aufgeschuͤtteten Materialien in kleine Stuͤke, die zweite zermalmt sie
zu Pulver. An dem Umfange der Walze c, sind
regelmaͤßige Zaͤhne eingeschnitten, deren Winkel einander gleich sind, und deren Spizen,
wenn sie oͤfters uͤber die zu zerkleinenden Koͤrper hinlaufen,
jedes Kluͤmpchen derselben vollkommen zerbrechen, und dadurch die
staͤche Walze, d, welche ihr folgt, in den Stand
sezen, das Ganze mit der groͤßten Leichtigkeit zu puͤlvern. Da das
Bett an seinen Kanten etwas aufsteigt, so gleitet die zu zerkleinende Masse immer
von selbst gegen den Mittelpunct, und bleibt dadurch unter der Wirkung der Walzen.
Sie bleibt selten zwischen den Zaͤhnen der Walze c haͤngen, wohl aber zuweilen an der stachen Walze, d an welcher daher ein Schaber angebracht werden
muß.
Wenn die zu zerkleinenden Koͤrper lang genug bearbeitet worden sind, um die
ganze Masse puͤlvern zu koͤnnen, laͤßt man sie durch den
Schlauch e, in die Kiste f,
hinab, wo sie gesiebt wird. Dieser Sieb-Apparat haͤngt in eisernen Stangen,
und wird mittelst eines Armes geruͤttelt, der mit einer Kurbel, g, in Verbindung steht, welche mittelst eines kleinen
Getriebes von den Centralraͤdern b aus in
Bewegung gesezt wird, und der ganzen Kiste eine schnelle Seitenbewegung mittheilt,
wodurch die feineren Pulvertheilchen in die untere Abtheilung fallen, aus welcher
sie unter die Laͤufer des zweiten, alsogleich zu beschreibenden, Apparates
gelangen. Da aber, außer den Farben, andere zu zerkleinende Koͤrper eben
nicht zu einem hoͤchst feinen Pulver zermahen werden duͤrfen, z. B,
Arzenei-Koͤrper, Faͤrbehoͤlzer etc., so ist dieser
Siebe-Apparat auch vielleicht fuͤr diese nothwendig.
Da ferner eine Maschine dieser Art in vielen Fabriken zum Zerkleinen harter
Koͤrper dienen kann, z.B. zum Zerkleinen der Kohlen bei Gaswerken, zum
Zerbrechen der Oehlkuchen fuͤr Viehfutter u. d. gl., so schlaͤgt der
Patent-Traͤger zwei solche gezaͤhnte Walzen vor, die mit ihren
Zaͤhnen in einander greifen, welche daher alle aus Flaͤchen, die unter
rechten Winkeln stehen, gebildet seyn muͤssen. Diese Walzen koͤnnen
paarweise in zwekmaͤßigen Gestellen stehen, und in gehoͤriger
Entfernung von einander gestellt werden; die zu zerkleinenden Koͤrper
koͤnnen durch eine Art von Trichter unmittelbar zwischen dieselben fallen,
und, nachdem sie durch dieselben durchgegangen sind, auf den gehoͤrigen Grad
zerkleint werden.
Diese Maschinen koͤnnen in beliebiger Groͤße verfertigt wenden; die
hier in der Figur dargestellte ist ungefaͤhr zwei Fuß breit und vier Fuß hoch. Man
kann sie auch tragbar machen, und dadurch Moͤrser und Stoͤßel
ersparen, und oͤfters hoͤchst unangenehmen zuweilen sogar fuͤr
die Arbeiter toͤdtlich gewordenen, Folgen entgehen. Der Bau derselben ist so
einfach, daß sie fast nie in Unordnung gerathen, oder, wenn dieß ja geschehen
sollte, leicht ausgebessert werden koͤnnen. In großen Fabriken koͤnnen
mehrere dieser Maschinen in groͤßerem Maßstabe so verbunden, und durch eine
Dampfmaschine, oder durch (in Wasserrad oder einen Pferdegoͤpel, oder durch
eine andere Triebkraft so in Bewegung gesezt werden, wie man es noͤthig
findet.
Der zweite Apparat zum Mischen und Zubereiten der Farben und anderer Substanzen im
trokenen oder fluͤßigen Zustande ist in Fig. 3 dargestellt. Die
Maschine steht auf einem starken hoͤlzernen Gestelle, und erhaͤlt ihre
Bewegungen von einer Achse a, an welcher ein Flugrad
angebracht ist. Dieses kann entweder durch die Hand, oder durch irgend eine andere
Triebkraft in Bewegung gesezt werden. bb, sind
zwei horizontale Spindeln, welche durch ein Getriebe, a,
in Umlauf gebracht werden, und durch Triebraͤder an ihren Enden die
senkrechten Spindeln, cc, treiben. Oben an diesen
Spindeln befinden sich Kurbeln, dd, welche mit
einer Zugstange, ee, in Verbindung stehen, die das
Gestell f, der Laͤufer gg, in Bewegung sezen, und diese auf dem Bette h, umhertreiben. Statt dieser Laͤufer kann man
auch einen kreisfoͤrmigen Stein, i, anbringen,
welcher auf dem Bette h, durch seine Verbindung mit der
Zugstange e bei f, auf
aͤhnliche Weise wie die Laͤufer umhergetrieben wird. Wenn die Farbe
von dem Bette (den Steinen) weggeschafft werden soll, duͤrfen diese nur mit
ihren Schlitten gehoben, und mittelst des Hakens j an
der Zugstange aufgehaͤngt werden.
Damit diese Steine, waͤhrend sie auf dem Lager umher laufen, sich um ihren
eigenen Mittelpunct drehen, sind eigene kleine Spindeln, kk, mit einem Triebwerke vorgerichtet, wodurch die
Central-Spindeln des Gestelles, ff, eine drehende
Bewegung erhalten, und dadurch jedem Steine auf seinem Laufe eine Epicycloide
beschreiben lassen; was sehr wuͤnschenswerth ist, wenn die Farben vollkommen
fein gerieben werden sollen.
Dieser Apparat, der nicht mehr als 3 bis 4 Fuß lang ist, kann mit sehr geringer Kraft
in Umtrieb gesezt werden, da der Widerstand hoͤchst unbedeutend ist; ein
Knabe kann mittelst einer an der Achse a angebrachten
Kurbel dieselbe treiben. Wenn man jedoch bei einer Arbeit, die ins Große geht, die
Zahl der Steine vermehren will, was allerdings angeht, so wird es auch nothwendig
eine groͤßere Kraft anzuwenden.
Zum Abreiben der feinen Wasserfarben sollte man ein glas fernes Bett und
glaͤserne Laͤufer haben, indem die Porositaͤt des Steines
haͤufig eine Absorption der Farbe veranlaͤßt, und es unmoͤglich
macht, leztere so fein abzureiben, wie der Kuͤnstler dieselbe braucht. Man
wird diese Maschine auch zum Abschleifen lithographischer Steine tauglich finden, um
sie so eben wie moͤglich zu machen: ebenso auch zur Bereitung der
lithographischen und der Drukerschwaͤrze, und in allen jenen Faͤllen,
wo das Farbenreihen auf dem gewoͤhnlichen Wege wegen der verderblichen
Ausfluͤsse der Farben der Gesundheit der Arbeiter nachtheilig werden kann,
oder das Pulvern (Alkoholisiren) irgend eines giftigen ArzeneimittelsHier muß aber ein gehoͤriger Zug uͤber dieser Maschine
angebracht werden. (Vergl. polytechn. Journ. B. XV. S. 294.) A. d. Ueb..
Tafeln