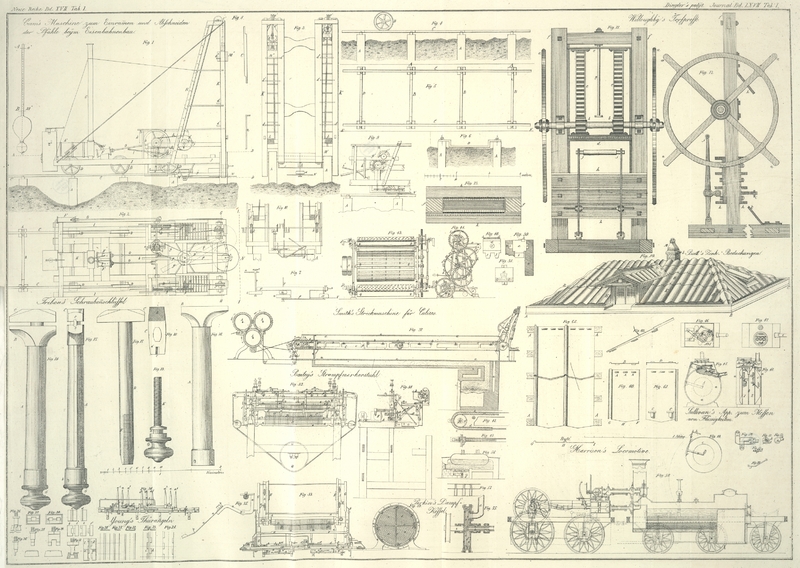| Titel: | Verbesserungen im Zurichten und Appretiren von wollenen und anderem Geweben, worauf sich Alexander Ritchie, in Leeds in der Grafschaft York, auf die Mittheilungen eines Ausländers hin, am 13. Jun. 1836 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 67, Jahrgang 1838, Nr. IX., S. 27 |
| Download: | XML |
IX.
Verbesserungen im Zurichten und Appretiren von
wollenen und anderem Geweben, worauf sich Alexander Ritchie, in
Leeds in der Grafschaft York, auf die Mittheilungen eines
Auslaͤnders hin, am 13. Jun. 1836 ein
Patent ertheilen ließ.
Aus dem London Journal of arts. Oktober 1837, S.
12.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
Ritchie, Verbesserungen im Zurichten wollener Gewebe.
Das Wesen der Erfindung besteht in der Anwendung eines oder mehrerer hohler,
durchloͤcherter Dampfcylinder oder anderer geeigneter Gefaͤße, um in
dicht und fest aufgerollte Wollen- oder andere Zeuge eine große Anzahl
kleiner Dampfstroͤme treten zu lassen, damit auf diese Zeuge hiedurch eben so
eingewirkt wird, wie dieß bei dem sogenannten Daͤmpfen der Calicos zu
geschehen pflegt. Da dieser Zwek offenbar auf verschiedene Weise und mit
verschiedenen Maschinen erreicht werden kann, so beschranke ich mich auf die
Andeutung der Verbindung dieses Verfahrens mit einer sogenannten Rauh- oder
Gigmuͤhle.
Fig. 43 ist
ein Frontaufriß einer Rauhmuͤhle, mit der zwei hohle, durchloͤcherte
Dampfcylinder und die uͤbrigen zur Vollbringung des Dampfprocesses
noͤthigen Vorrichtungen in Verbindung gebracht sind. Fig. 44 zeigt dieselbe
Maschine in einem Endaufrisse. Die Maschine ruht in den gußeisernen, durch
Laͤngenbalken mit einander verbundenen Endgestellen a,
a, a. Die wie gewoͤhnlich mit Karden oder Buͤrsten
ausgestattete Trommel b, b ist an einer Welle
aufgezogen, und wird von einer Dampfmaschine oder irgend einem anderen Motor her
durch ein uͤber die Rolle c geschlungenes
Laufband in Bewegung gesezt. Die hohlen Dampfcylinder d,
d, von denen sich einer uͤber und der andere unter der Rauhtrommel
befindet, laufen mit hohlen Zapfen in den Endgestellen. Man verfertigt sie am besten
aus Kupferblech von gehoͤriger Dike, und bohrt von Außen nach Innen zu eine Menge
Loͤcher, durch die der Dampf dringen kann. Mit dem Ende eines jeden der
hohlen Cylinderzapfen ist mittelst gehoͤriger dampfdichter Gefuͤge und
Liederungen eine Roͤhre e, e, die den Dampf von
einem Dampfkessel herbeileitet, in Verbindung gebracht. An den hohlen Zapfen der
entgegengesezten Seite sind auf gleiche Weise aͤhnliche Roͤhren
befestigt, damit kaltes Wasser in die Cylinder eingeleitet werden kann, wenn dieß
zum Behufe der Abkuͤhlung des in Behandlung befindlichen Zeuges
noͤthig wird. Hieraus folgt von selbst, daß sowohl die Dampf- als die
Wasserroͤhren mit Sperrhaͤhnen versehen seyn muͤssen, damit man
den Dampf und das Wasser je nach Bedarf einlassen und wieder absperren kann.
Was die zum Umtreiben der Dampfcylinder dienende Maschinerie betrifft, so erheischt
sie, da sie der au den hoͤlzernen Aufwindwalzen der gewoͤhnlichen
Rauhmuͤhlen angebrachten vollkommen aͤhnlich ist, keine
ausfuͤhrliche Beschreibung. Es genuͤgt zu wissen, daß ein au dem Ende
der Welle der Rauhtrommel befindliches Getrieb g durch
das Eingreifen in das Zahnrad h das ganze
Raͤderwerk h, i, k und l in Bewegung bringt. Das Rad k schiebt sich
lose an dem Zapfen des unteren, das Rad l hingegen an
dem Zapfen des oberen hohlen Cylinders; und eines dieser Raͤder wird, je
nachdem es die Umstaͤnde erfordern, mir einer Klauenbuͤchse in an
seinen Zapfen gesperrt, damit der ihm entsprechende hohle Cylinder umlauft und den
Zeug aufwindet, waͤhrend der andere frei bleibt, damit der auf ihn
aufgerollte Zeug ungehindert ablaufen kann. Um dem Zeuge eine solche Spannung geben
zu koͤnnen, daß er hinlaͤnglich fest auf den Aufnahmcylinder
aufgewunden wird, ist an dem Umfange einer Rolle p, p,
dergleichen an jedem Zapfen der hohlen Cylinder eine angebracht ist, fuͤr
eine mit einem beschwerten Hebel o, o versehene
Reibungsbremse n, n gesorgt. Laßt man diese Bremse auf
die Rolle des Cylinders, von dem der Zeug abgewunden wird, wirken, so wird
nothwendig eine solche Verzoͤgerung des Abwindens daraus erfolgen, daß der
Zeug mit bedeutender Spannung von dem Aufwindcylinder aufgewunden wird. Um diesen
Zwek noch sicherer zu erreichen, wirkt die Drukwalze q,
q auf dem Umfange des hohlen Cylinders auf die Oberflaͤche des
Zeuges. Die Zapfen dieser Walze laufen in den Hebeln r,
r, welche an Zapfen, die in die Endgestelle eingelassen sind, angebracht,
und an ihrem laͤngeren Arme mit Gewichten ausgestattet sind, damit man die
Wirkung der Drukwalze auf den aufzuwindenden Zeug nach Belieben reguliren kann.
Mit dieser Maschine wird nun auf folgende Weise gearbeitet. Bevor der Zeug auf die
Cylinder aufgewunden wird, wikelt man ungefaͤhr 20 Yards eines Leinen-
oder Baumwollzeuges fest um sie, damit der zu behandelnde Zeug nicht unmittelbar mit den
Cylindern in Beruͤhrung und einer zu großen Hize ausgesezt wird; und damit
der bei den Loͤchern des Cylinders austretende Dampf moͤglichst
gleichfoͤrmig verbreitet auf den aufgewundenen Zeug einwirke. Das Dampfen
geschieht am besten unmittelbar, nachdem der Zeug in der Rauhmuͤhle
aufgerauht worden ist, und vor dem Scheren; es kann jedoch, besonders wenn die
Faͤden des Zeuges sehr fein sind, eben so gut auch dann geschehen, wenn der
Zeug zum Theil geschoren worden ist. Man befestigt das eine Ende des zu behandelnden
Wollenzeuges an dem einen Ende des auf den einen Cylinder aufgewundenen
Baumwoll- oder Leinenzeuges, und das andere Ende an dem einen Ende des auf
den anderen Cylinder aufgewundenen Baumwoll- oder Leinenzeuges. Wenn dann der
aufgerauhte und benezte Wollenzeug fest auf den einen der beiden Cylinder
aufgewunden worden ist, so laͤßt man in diesen Dampf eintreten, damit der
Dampf durch die Loͤcher in den Zeug eindringe. Nachdem diese Einwirkung 10
bis 20 Minuten angedauert, – welche Zeit je nach dem Druke des Dampfes, der
von 12 bis 40 Pfd. auf den Zoll betragen kann, verschieden ist, – windet man
den Wollenzeug auf den anderen Cylinder, wobei man ihn, waͤhrend dieß
geschieht, abermals mit Wasser befeuchtet, und zwar nach dem in den
Rauhmuͤhlen uͤblichen Verfahren. Der Zeug erfahrt auf dem Uebergange
von einem Cylinder zum anderen die Einwirkung der Karden der Rauhtrommel; und ist er
festgespannt auf den anderen Cylinder uͤbergegangen, so laͤßt man nun
auch in diesen auf die angegebene Weise Dampf eintreten. Wenn der Zeug auch auf
diesem eben so lang wie fruͤher der Einwirkung des Dampfes ausgesezt gewesen
ist, so windet man ihn wieder zuruͤk, wobei er abermals benezt wird und der
Einwirkung der Karden der Rauhtrommel unterliegt. Nach Vollendung dieses Processes
kann man den Zeug dann von den Cylindern abnehmen.
Die ganze hier beschriebene Operation laͤßt sich auch mit einem einzigen
Cylinder und einer gewoͤhnlichen Zeugwalze bewerkstelligen; man wendet jedoch
besser zwei Cylinder an, indem die Operation dann schneller von Statten geht, und
indem sie auch gleichmaͤßiger ausfaͤllt, wenn jedes der Zeugenden ein
Mal zunaͤchst an den Cylinder gebracht wird. Zum Aufstellen, Geraderichten
und Niederlegen des Haares kann man steife Buͤrsten oder metallene Spizen
anwenden; Distelkarden verdienen jedoch vor beiden den Vorzug. Man kann die
Operation auch vollbringen, indem man den Dampf nur ein Mal durch den Zeug treibt
und dafuͤr die Dauer auf das Doppelte erhoͤht; oder man kann den Dampf
auch drei und mehrere Male durchtreiben und dafuͤr die jedesmalige Dauer seiner Einwirkung
abkuͤrzen. Das oben beschriebene Verfahren scheint jedoch unter allen
Umstaͤnden den Vorzug zu verdienen.
Der Zwek des ganzen Verfahrens ist beim Geraderichten und Niederlegen des Haares
mitzuwirken, und demselben in kuͤrzerer Zeit eine groͤßere Weiche und
Glatte und einen vollkommneren Glanz zu geben, als dieß auf irgend eine andere Weise
moͤglich ist.
Tafeln