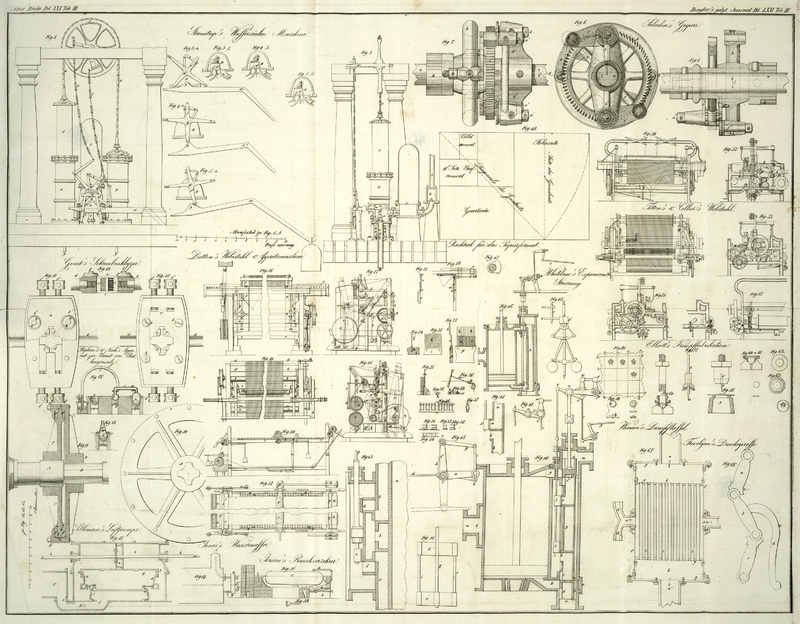| Titel: | Verbesserungen in der Fabrication von Wollentuch, und zwar sowohl im Weben als Appretiren desselben, worauf sich James Dutton, Tuchfabrikant von Wotton-under-Edge in der Grafschaft Gloucester, am 8. Febr. 1838 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 71, Jahrgang 1839, Nr. XLII., S. 203 |
| Download: | XML |
XLII.
Verbesserungen in der Fabrication von Wollentuch,
und zwar sowohl im Weben als Appretiren desselben, worauf sich James Dutton, Tuchfabrikant
von Wotton-under-Edge in der Grafschaft Gloucester,
am 8. Febr. 1838 ein Patent ertheilen
ließ.
Aus dem London Journal of arts December 1838, S.
121.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Dutton's Webestuhl und Appretirmaschine fuͤr
Wollentuch.
Gegenwaͤrtige Verbesserungen betreffen, was das Weben der Wollentuͤcher
anbelangt: 1) den Bau eines Stuhles zum Weben dieser Tuͤcher, welcher durch
eine rotirende Kraft in Bewegung gesezt wird; 2) eine verbesserte Methode die Kette
auf den Kettenbaum aufzuziehen, gemaͤß welcher das Garn regelmaͤßiger
und mit gleichfoͤrmigerer Spannung auf den Kettenbaum gebracht wird, als dieß
nach den bisherigen Methoden moͤglich war; 3) eine eigentuͤmliche
Einrichtung der Geschirre, welche zum Oeffnen der Kettenblaͤtter vor dem
Eintragen des Einschusses dienen, und auch des Rietblattes, womit das Einschlagen
geschieht; 4) einen Apparat, welcher bestaͤndig als Spannstok oder Tempel
wirkt; 5) endlich eine oder mehrere Methoden die Abgabe der Kette mir dem Aufwinden
des gewebten Zeuges in Einklang zu bringen.
In Beziehung auf das Appretiren besteht die Erfindung in einer Maschine, in der sich
das Wollentuch ausgespannt vorwaͤrts bewegt, wobei sein Haar durch einen
umlaufenden Cylinder, dessen Umfang mit Karden, Draͤhten oder Buͤrsten
besezt ist, und der in der Richtung der Bewegung des Tuches aber mit großer
Geschwindigkeit umlaͤuft, ausgeraubt wird. Das Tuch wird mittelst einer
adjustirbaren Walze, die in einem aus zusammengesezten Hebeln gefertigten und
gehoͤrig belasteten Rahmen aufgezogen ist, gegen die Karden
angedruͤkt. Mit derselben Maschine laͤßt sich auch ein rotirender
Scheer-Apparat in Verbindung bringen; auch kann das Pressen mit ihr
vollbracht werden, wenn man erhizte Walzen an die Stelle der erwaͤhnten
Rauh-Cylinder einsezt. Das Buͤrsten ist gleichfalls zu
bewerkstelligen, wenn man einen Buͤrst-Cylinder auf dieselbe Weise
aufzieht, auf welche der Rauh-Cylinder angebracht ist.
Endlich betreffen die Verbesserungen auch Modificationen und Zusaͤze zu jenem
Apparate, auf den der Patenttraͤger unterm 13. Mai 1834 ein Patent nahm.Wir haben dieses Patent im Polyt. Journal Bd. LVII. S. 360 nach der im London
Journal erschienenen Beschreibung bekannt gemacht A. d. R.
Fig. 16 ist
ein Frontaufriß eines Webestuhles, an welchem die das Weben betreffenden
Verbesserungen angebracht sind. Fig. 17 zeigt denselben
in einem an dem rechten Ende genommenen Aufrisse. Fig. 18 ist ein
Quer-Durchschnitt durch den Stuhl und zwar gegen das rechte Ende der Maschine
hin. Fig. 19
gibt eine Ansicht desselben von Oben. Die Hauptwelle a
erhaͤlt ihre rotirende Bewegung von irgend einem Motor her, und zwar durch
den Treibriemen b, welcher uͤber einen an dem
Ende der Hauptwelle fixirten Rigger c geschlungen ist.
Die Enden der Welle des Kettenbaumes d laufen in
Spalten, welche in Traͤger geschnitten sind, die an den Hinteren Pfosten
festgemacht sind. Der Kettenbaum druͤkt mit seinem Umfange auf eine Walze e, an deren Ende man das Zahnrad f bemerkt, welches mittelst einer endlosen Schraube umgetrieben wird. Die
Reibung des Kettenbaumes an der Walze e bedingt also das
Umlaufen des ersteren. Das von ihm abgegebene Garn laͤuft nach
Aufwaͤrts uͤber die Hintere Latte h, und
hierauf durch die Geschirre i, i und das Rietblatt k an den Brustbaum l. Das an
diesem gewebte Tuch laͤuft nach Abwaͤrts unter der Walze m hinweg uͤber den Baum n an die Tuchwalze o, auf die es im Maaße, als
seine Fabrication fortschreitet, aufgewunden wird.
Die Geschirre i, i bestehen aus Drahten, welche auf eine
spaͤter zu beschreibende Weise gebogen sind. Ihre Rahmen sind an Brettern
oder Platten p, p befestigt, von denen die eine an einer
Schiebstange q, die andere hingegen an den beiden
Leitstangen r, r festgemacht ist. Beide sind sie
miteinander durch einen endlosen Riemen verbunden, der an den Platten p, p festgemacht, und uͤber die an den
Seitengestellen aufgezogenen Spannungsrollen t, t
gefuͤhrt ist.
An der Hauptwelle befindet sich auch ein Muschelrad oder ein Kamm u, welches man in Fig. 18 sieht, und
welches sich in einem rechtekigen Rahmen v, v bewegt.
Dieses bewirkt, daß, so wie die Hauptwelle umlaͤuft, die Stange q sich in ihren Fuͤhrern auf und nieder schiebt
und dadurch einer der Platten p eine Hin- und
Her-Bewegung gibt, wodurch die Geschirre zum Behufe des Oeffnens und
Schließens der Kettenblaͤtter auf und nieder bewegt werden.
Das Auswerfen der Schuͤze zwischen den Kettenblaͤttern hindurch wird
auf folgende Welse hervorgebracht. Von jedem Ende der Hauptwelle laufen Arme w aus, die, sowie letztere umlaͤuft, abwechselnd
auf die Seite des einen der Hebel x, x wirken. Man sieht
diese Vorrichtung, welche in Fig. 16 an beiden Enden
der Maschine angedeutet ist, deutlicher und einzeln fuͤr sich in Fig. 20. Die
Hebel x haben ihre Drehpunkte in Zapfen, welche an den
Schenkeln der Lade A, A befestigt sind. Wenn hie
Hauptwelle a umlaͤuft, so druͤken die Arme w abwechselnd und mit bedeutender Kraft auf die
vorspringenden Walzen y, y der Hebel x, wodurch diese Hebel in die Stellung
zuruͤkgetrieben werden, welche man in Fig. 20 durch Punkte
angedeutet sieht. Der obere Theil eines jeden dieser Hebel x wirkt auf den kuͤrzeren Arm des von dem oberen Theile der
Schenkel A der Lade B
herabhaͤngenden, im rechten Winkel gebogenen Hebels z, und veranlaßt in Folge der eben beschriebenen Bewegung, daß der Hebel
z mit bedeutender Geschwindigkeit in die durch
Punkte angedeutete Stellung geschnellt wird. Da der laͤngere Arm des Hebels
z an einem Riemen festgemacht ist, welcher mit
Armen, die sich von dem Treiber C aus nach
Abwaͤrts erstreken, verbunden ist, so werden die Bewegungen der Hebel x und z bewirken, daß die
Treiber die Schuͤze mit solcher Gewalt schnellen, daß dieselbe laͤngs
der Schuͤzenbahn zwischen den Kettenblaͤttern hindurch getrieben wird.
An dem Schuͤzentreiber befindet sich dem Ende der Schuͤze
gegenuͤber ein mit Kautschuk ausgefuͤllter Ausschnitt. Der Kautschuk
wird in dem Maaße als er sich abnuͤzt, mittelst einer durch die
gegenuͤberliegende Seite gefuͤhrten Schraube vorwaͤrts
geschoben.
Die ruͤkgaͤngige Bewegung der Lade, waͤhrend welcher die
Schuͤze mit dem Einschusse durch die Kettenblaͤtter geworfen wird,
wird durch die an der Hauptwelle befindlichen, in Fig. 17 ersichtlichen,
umlaufenden Muschelraͤder D hervorgebracht. Diese
Raͤder wirken naͤmlich bei ihrem Umlaufen auf die Schwaͤnze der
gegliederten Hebel E, E; kommen die laͤngeren
Radien derselben mit diesen Schwaͤnzen in Beruͤhrung, so wird die
Lade, wie man in Fig. 17 sieht, zuruͤkgehalten, und dieß geschieht, waͤhrend
die Schuͤze durch die Kette laͤuft. Sowie aber die Schwaͤnze
der Hebel E die laͤngeren Radien verlassen, wird
die Lade frei und durch eine Feder F, F, welche an den
vorderen Pfosten und den Schenkeln der Lade, Fig. 18 festgemacht ist,
zum Behufe des Einschlagens des Einschusses mit Gewalt vorwaͤrts getrieben.
Dieses Einschlagen wird noch unterstuͤzt durch die Daͤumlinge G, G, welche sich an Armen, die in die Hauptwelle
eingesezt sind, befinden, und welche unmittelbar nachdem die Lade vorwaͤrts
getreten, mit einer Schraͤgflaͤche H in
Beruͤhrung kommen, die an den beiden Schenkeln der Lade angebracht ist, und
welche die Daͤumlinge nur so weit vorwaͤrts treibt, als es
noͤthig ist, um den Einschuß gehoͤrig einzuschlagen.
Es bleiben nunmehr die Vorrichtungen, womit das Garn von dem Kettenbaume d abgegeben, das Tuch hingegen auf den Tuchbaum o aufgewunden wird, zu beschreiben. Der Stab I, welcher sich frei in den an dem stehenden Gestelle
befestigten Baͤndern J, J schiebt,
schlaͤgt bei der ruͤkgaͤngigen Bewegung der Lade B auf den oberen Theil eines Kreuzhebels K, welcher in einem an dem hinteren Gestellpfosten befestigten Bande an
einer Spindel aufgezogen ist. An dem einen der Arme dieses Hebels K ist ein Sperrkegel L
angebracht, welcher in das Sperrrad M eingreift, und
der, wenn der Hebel K der angegebenen Einwirkung
unterliegt, dieses Sperrrad M je um einen Zahn umtreibt.
Die Bewegung dieses Rades M bedingt eine entsprechende
rotirende Bewegung der Welle und der kugelfoͤrmigen Rolle N, N, von der die Bewegung mittelst eines Treibriemens
an die untere Rolle P fortgepflanzt wird. An der Achse
der lezteren ist eine Schneke oder eine endlose Schraube g befestigt, die in die Zaͤhne des an der Welle der Reibungswalze
e befindlichen Rades eingreift, so daß also diese
Walze ebenso viele Bewegung erhaͤlt, als durch den fruͤher
beschriebenen Mechanismus hervorgebracht wird. Der auf dem Umfange der Walze e aufruhende Kettenbaum d
wird sich in Folge der Reibung der Oberflaͤchen um seine Welle drehen, und
hiedurch soviel Kettengarn abgeben, als von dem Werkbaume Tuch aufgenommen wird.
Eine belastete Schnur, welche um eine an dem Ende des Baumes o fixirte Rolle geschlungen ist, bewirkt, daß dieser Baum umlaͤuft
und dadurch das Tuch auf sich aufwindet. Eine aͤhnliche Rolle mit einer
belasteten Schnur ist auch an dem Ende der Walze m
angebracht, wodurch nicht nur das Tuch gehoͤrig gespannt, sondern auch
allmaͤhlich von dem Brustbaume herabgezogen und uͤber den
Baͤumen an den Werkbaum o gefuͤhrt wird.
Die Walze m ist es, wenn sie gehoͤrig belastet
ist, hauptsaͤchlich, welche das gewebte Tuch vorwaͤrts bewegt; und da
ihr Durchmesser stets einer und derselbe bleibt, so bleibt sich auch die Spannung
immer gleich. Die rotirende Bewegung der Walze in wird durch ihre Welle der an
dieser befestigten Frictions-Scheibe Q
mitgetheilt, wodurch der Sperrkegel L auf folgende Weise
aufgehoben wird. Wenn sich die Lade zum Behufe des Einschlagens des Einschusses
vorwaͤrts schwingt, so schlaͤgt die mit dem unteren Theile des
Schenkels der Lade verbundene Schiebstange R gegen den
oberen Theil des im rechten Winkel gebogenen Hebels S,
den man am besten in Fig. 17 siebt. Durch das
Zuruͤkfallen dieses Hebels, welches man durch Punkte angedeutet sieht, wird
ein an der Bodenlatte des Gestelles aufgezogener Hebel T, an dem sich die senkrechte Stange U befindet,
emporgehoben. Diese senkrechte Stange ist an ihrem oberen Ende durch ein Gelenk mit
einer Schiebstange W, an ihrem unteren Ende dagegen
gleichfalls durch ein Gelenk mit dem Hebel T verbunden.
An ihrem lezteren Ende bemerkt man auch die Reibungsrolle V, die mit dem Umfange der Frictions-Scheibe Q in Beruͤhrung kommt, so oft der Hebel auf die beschriebene Weise emporgehoben wird.
Ist diese gegenseitige Beruͤhrung eingetreten, so wild jede rotirende
Bewegung, welche der Scheibe durch die angegebenen Mittel mitgetheilt worden, auch
die Rolle V und mithin die Stange U zur Bewegung veranlassen. Die Stange U wird
hiedurch in die durch Punkte angedeutete Stellung gerathen, wodurch die Schiebstange
W gegen den unteren Arm des Kreuzhebels K getrieben und mithin der Sperrkegel L emporgehoben wird. Dieser Sperrkegel wird demnach um
einen Zahn an dem Umfange des Sperrrades zuruͤkgezogen, und in die zum
Treiben des Rades M bestimmte Stellung gebracht. Die
Bewegung, welche dieses Umtreiben veranlaßt, wird durch die bereits oben angegebenen
Vorrichtungen erzeugt. Es erhellt hieraus, daß die Abgabe des Kettengarnes durch das
Aufwinden des Tuches oder durch das mittelst der Walze m
erzeugte Vorwaͤrtsziehen desselben bedingt ist. Wenn das Rietblatt beim
Anschlagen des Gewebes, deßhalb weil es auf keinen Einschuß trifft, keinen
hinreichenden Widerstand findet, so wird die Kraft nicht, ausreichen, um das Tuch
uͤber den Brustbaum l zu ziehen, woraus folgt,
daß sowohl die Walze m als auch die
Frictions-Scheibe Q unbewegt bleibt; daß, indem
auch die Theile V, U, W nicht in Thaͤtigkeit
kommen, der Sperrkegel L nicht zuruͤkgezogen
wird: und daß also das Sperrad M und die damit
verbundenen Theile N, O, P, g, e, welche den Kettenbaum
d treiben, stehen bleiben, ohne daß eine Abgabe der
Kette Statt findet.
Was die verbesserte Methode die Ketten auf die fuͤr sie bestimmten
Baͤume in der Tuchweberei aufzuziehen betrifft, so muß vorlaͤufig
bemerkt werden, daß nach der gewoͤhnlichen Methode das Kettengarn sehr
ungleich und mit sehr verschiedener Spannung auf den Baum aufgewunden wird. Die neue
Methode soll diesen Maͤngeln abhelfen. Ich nehme, sagt der
Patenttraͤger Garn von dem Zettel (warper), und
fuͤhre es nach gewoͤhnlicher Art in Buͤndeln, zu
beilaͤufig 20 Faͤden ein jeder, durch enge Rietblaͤtter. Beim
Aufwinden dieses Garnes auf den Kettenbaum bringe ich zwischen jede Windung eine
Lage Papier oder irgend einen anderen entsprechenden Stoff. Ich nehme hiezu einen
Papierstreifen, welcher die Breite des auf den Baum gelegten Garnes und zugleich
eine der Gesammtlaͤnge der Kette gleichkommende Laͤnge hat. Von dem
auf diese Weise bekleideten Baͤume ziehe ich die Garnfaͤden einzeln
durch ein Rietblatt, welches dem zum Weben bestimmten an Feinheit gleichkommt. Durch
dieses feine Rietblatt hindurch winde ich das Garn auf einen anderen Daum, wobei ich
gleichfalls zwischen jede Windung eine Lage Papier bringe. Den auf diese Art mit
Garn- und Papier-Windungen bedekten Baum seze ich in den Webestuhl
ein, in welchem man ihn
in Fig. 18
bei d sieht. Von ihm aus leite ich die Faͤden
ganz nach dem uͤblichen Verfahren durch das zum Weben bestimmte Rietblatt.
Das Papier oder der sonstige zwischen die Kettenwindungen gelegte Stoff wird bei der
Abgabe der Kette von dem Baͤume an eine Walze X
gefuͤhrt, auf die er mittelst einer belasteten Schnur, die um eine an dessen
Ende befindliche Rolle geschlungen ist, aufgerollt ist.
Der eigenthuͤmliche Bau der zum Oeffnen der Ketten dienenden Geschirre erhellt
aus Fig. 21,
wo dieselben einzeln fuͤr sich und in groͤßerem Maaßstabe abgebildet
sind. Anstatt der bisher uͤblichen Augen oder Oehren, durch welche die
Faͤden gefuͤhrt wurden, bestehen meine verbesserten Geschirre aus
gebogenen Drahten a, a, die mit ihren
hakenfoͤrmigen Enden an zwei horizontalen Staͤben b, b festgemacht sind. Diese Staͤbe sind mit zwei
eisernen Pfosten c, c, die an einer der oben
beschriebenen Platten p festgemacht sind, verbunden. Die
Kettenfaͤden werden einzeln um die Biegung des Drahtes herumgefuͤhrt,
so daß die Kettenblaͤtter also durch die Auf- und Niederbewegung der
Geschirrrahmen geoͤffnet und geschlossen werden.
Eine Modification der Geschirre sieht man in Fig. 22 von der Seite und
in Fig. 23
von Vorne her betrachtet. Sie bestehen hier gleichfalls aus Draht, haben aber die
bei d ersichtliche Form, waͤhrend ihre unteren
Theile, wie man bei e sieht, flach oder abgeplattet
sind. Diese abgeplatteten Theile oder ihre Stiele sind wie die Fuͤhrer einer
Tullmaschine in Bleie eingesezt, die am Boden an der Platte oder an dem Brette p festgemacht sind. Nach Oben zu sind die Drahte offen
gelassen, damit man die Kettenfaͤden zwischen sie bringen und um den
gebogenen Theil derselben herum fuͤhren kann.
Mein verbessertes Rietblatt besteht aus geraden, plattgedruͤkten Drahten, die
gleichfalls wie die Draͤhte einer Tullmaschine in Bleie eingesezt sind, und
welche man in Fig.
24 und 25 von zwei Seiten abgebildet sieht. g, g
sind hier die Draͤhte und h die an der Lade i befestigten Bleie.
Die Vorrichtung, deren ich mich bediene, um das Tuch der Breite nach ausgespannt zu
erhalten, und welche also die Stelle von Spannstoͤken oder Tempeln vertritt,
sieht man aus Fig.
26, 27, 28 und 29. Fig.
26 ist eine in groͤßerem Maaßstabe gezeichnete Ansicht eines
Theiles, den man bereits in Fig. 18 sah, und an dem
man bei l den Brustbaum und das geoͤffnete
Kettenblatt bemerkt. Fig. 27 ist eine
horizontale Ansicht dieses Theiles. Fig. 28 ist ein
Querdurchschnitt zwischen dem Brustbaume und jenem Theile der Kette, an welchem der
Webeproceß sein Ende erreicht, d.h. an welchem das Einschlagen geschieht, genommen.
Fig. 29
ist eine perspectivische Ansicht dieser als perpetuirlicher Spannstok verwendeten Vorrichtung. Man kann
diese Vorrichtung k, dergleichen in der Naͤhe
eines jeden Brustbaumendes eine befestigt wird, auch eine Zange nennen. Es befindet
sich an ihr zwischen zwei Wangen eine enge Spalte, welche fuͤr den Durchgang
des Sahlbandes des Tuches bestimmt ist. Hinter diesen Wangen bemerkt man einen
kleinen Ausschnitt, in den ein duͤnnes Staͤbchen aus Fischbein oder
einem anderen elastischen Stoffe m lose eingesezt ist.
Dieses Staͤbchen, welches mit seinem anderen Ende an dem Geschirrrahmen i festgemacht ist, bewegt sich mit dem Kettenblatte auf
und nieder, und so oft die Schuͤze durchfliegt, wird der Einschuß
uͤber das Staͤbchen gefuͤhrt, so daß das Tuch außerhalb des
Sahlbandes eine kleine Schlinge bekommt. Diese Schlingen glitschen, wenn das Tuch
uͤber den Brustbaum gefuͤhrt wird, eine geringe Streke weit an dem
Staͤbchen m fort, wodurch das Tuch da wo es
gewebt wird gehoͤrig ausgespannt erhalten wird.
Ich habe, was das Weben der Wollentuͤcher betrifft, nur noch
beizufuͤgen, daß die beschriebenen Maschinerien entweder durch irgend eine
Triebkraft oder durch Menschenhaͤnde in Bewegung gesezt werden
koͤnnen, und daß die verbesserten Geschirre, Rietblaͤtter und
Spannstoͤke nicht bloß an der beschriebenen Art von Webestuhl, sondern auch
an anderen fuͤr die Tuchweberei bestimmten Kunst- und
Handwebestuͤhlen anwendbar sind.
Was das Appretiren der Wollentuͤcher anbelangt, so erhellen meine
Verbesserungen aus Fig. 30 und 31. Erstere Figur ist
naͤmlich ein Laͤngendurchschnitt einer Maschine, in der das mittelst
Haken ausgespannte Tuch unter einer mit Karden, Drahtkarden oder Buͤrsten
besezten Trommel oder Walze weglaͤuft. Leztere hingegen zeigt dieselbe
Maschine von Oben betrachtet oder im Grundrisse. Das zu appretirende Stuͤk
Tuch wird in den unter der Maschine befindlichen Trog gelegt, und zwischen den
Walzen a, b, c, d, e, f, g, h durchgefuͤhrt, bis
es endlich von der lezten Walze uͤber die Schraͤgflaͤche
herabfaͤllt, wo die beiden Enden des Stuͤkes zusammengenaͤht
werden, so daß das Tuch gleichsam ein endloses Band vorstellt.
Die Walze a, welche mir Filz uͤberzogen ist,
laͤuft in einem Wassertroge. Die Walze b ruht mit
ihrer Achse in belasteten Hebeln, damit das Tuch in beliebigem Grade gegen die
Oberflaͤche der Walze a angedruͤkt wird,
und hiedurch von dem Filze lezterer eine geringe Menge Wasser aufnimmt. Die Walze
c, welche als Leitungsswalze fuͤr das Tuch
dient, laͤuft mit ihren Zapfen in den Enden der oberen Latten der Maschine.
Die Walze d ruht in Hebelarmen, welche an den Hinteren
Gestellpfosten an Zapfen haͤngen; sie liegt auf dem Tuche auf, damit dasselbe nicht
vorwaͤrts glitscht. Quer durch die Mitte der Maschine ist die Walze e, die mit Karden oder Buͤrsten besezt ist,
gelegt; ihre Achse oder Welle laͤuft in Zapfenlagern, welche an der oberen
Latte fixirt sind. Unter der Walze e befindet sich die
Walze f, deren Welle in den an der Stange l aufgehaͤngten Hebelarmen k aufgezogen ist. Die laͤngeren Arme dieser Hebel sind belastet,
damit sie die Walze gegen die untere Seite der Walze e
andruͤken. Die als Ziehwalze dienende Walze q
fuͤhrt an dem einen Ende ihrer Welle die Haupttreibrolle m. Gegen ihre Oberflaͤche druͤkt die Walze
h, welche in Hebelarmen ruht, die an den Hinteren
Gestellpfosten an Zapfen aufgehaͤngt sind. Diese Walze haͤlt das Tuch
gespannt und leitet dasselbe an die in den Trog hinabfuͤhrende
Schraͤgflaͤche.
Wenn das Tuch der Laͤnge nach zwischen diesen Walzen durchgefuͤhrt
worden ist, so spannt man es der Breite nach aus, indem man seine Sahlbaͤnder
an die Haken n, n, n hakt, die sich zu beiden Seiten der
Maschine an einer horizontalen Stange q schieben, wie
man dieß in Fig.
31 sieht. Wenn hierauf die Rolle m in
rotirende Bewegung versezt wird, so zieht die Walze g
das Tuch allmaͤhlich durch die Maschine. Ein Treibriemen, der um den an dem
entgegengesezten Ende der Welle der Achse g befindlichen
Rigger o geschlungen ist, sezt die an dem Ende der Walze
e befindliche Rolle p in
Bewegung, und hieraus folgt, daß sich die Walze e mit
groͤßerer Geschwindigkeit aber in derselben Richtung bewegt, wie das Tuch. In
dem Maaße als das Tuch durch die Maschine laͤuft, unterliegt es demnach der
Einwirkung der Karden oder Buͤrsten. Die Spannhaken n,
n, n sind reihenweise in Rahmen, welche sich an den horizontalen, an den
Seitenlatten des hoͤlzernen Gestelles befindlichen Eisenstangen q, q schieben, verbunden. An jeder Seite des Hinteren
Theiles der Maschine ist auf den Stangen q, q einer
dieser Rahmen angebracht. Die Haken werden von den zur Bedienung der Maschine
Aufgestellten in den Sahlbaͤndern befestigt; das Tuch wird, indem es
vorwaͤrts gezogen wird, bewirken, daß sich auch die Hakenrahmen
vorwaͤrts bewegen, bis sie vorne an der Maschine, naͤmlich da, wo das
Tuch auf die erwaͤhnte Schraͤgflaͤche kommt, anlangen, wo dann
die Haken ausgehakt und die Rahmen beseitigt werden, damit fuͤr die
nachruͤkenden Raum gestattet werde.
Wenn man das Tuch noch staͤrker spannen will, kann man an der Walze c einen Reibungs-Hebel r anbringen. Der Druk der Walze f gegen das
unter dem Kardencylinder e befindliche Tuch laͤßt
sich durch Verschiebung eines adjustirbaren Hakens s,
der den Schwanz des Hebels k zu tragen hat, reguliren.
Soll dieser Druk gaͤnzlich nachgelassen werden, so hat ein Gehuͤlfe den Fuß auf den
Tritthebel t zu setzen, wo dann mittelst der
Verbindungsstange u der Schwanz des Hebels emporgehoben
und die Walze f außer Beruͤhrung mit dem Tuche
gebracht wird. Brauchte das Tuch, waͤhrend es der hier angedeuteten
Behandlung unterliegt, nicht benezt zu werden, so koͤnnten die Walzen a und b wegbleiben, wo dann
das Tuch sogleich an die Walzen c und d gefuͤhrt werden koͤnnte.
Zum Behufe der Bekleidung des Cylinders e mit Karden
verfertige ich mir eine Anzahl leichter Rahmen aus Blechstreifen oder aus Drahten,
wie man sie in Fig.
32 von der Seite und in Fig. 33 vom Ruͤken
her betrachtet sieht. Zwischen je vier der horizontalen Draͤhte bringe ich
eine Karde, die, wenn ihre Spizen an einer Seite abgenuͤzt sind, leicht
ausgenommen und wieder so gestellt werden kann, daß neue Spizen in
Thaͤtigkeit kommen. Ich befestige eine Anzahl dieser Karden-Rahmen auf
einem elastischen Bande, und zwar indem ich den unteren Theil eines jeden dieser
Rahmen durch die aus Fig. 34 und 35
ersichtlichen Buͤgeldraͤhte fuͤhre. Das mit den Karden
ausgestattete Band winde ich spiralfoͤrmig um die Walze. Sollte man den
Karden einen groͤßeren Durchmesser zu geben wuͤnschen, so kann man sie
an Griffen, wie man sie in Fig. 36 und 37 sieht,
aufziehen und jede Karde zwischen Draͤhten so befestigen, daß sie, wenn man
es fuͤr noͤthig haͤlt, verschoben werden kann. Die Griffe
selbst lassen sich auf irgend eine geeignete Weise an der Trommel oder Kardenwalze
befestigen. Eben dieser Art von Kardengriffen kann man sich auch an allen
Rauh-Muͤhlen bedienen.
Meine lezte Verbesserung im Appretiren der Wollentuͤcher betrifft einen Zusaz
zu meinem fruͤheren Patente, welchem gemaͤß ich das Tuch in
verschiedenen Operationen durch Anwendung von Druk in Verbindung mit Hize und Nasse
appretirte. Sie besteht darin, daß ich das Tuch, nachdem es diese Behandlung
erlitten, in einzelnen Portionen einer zweiten Pressung unterwerfe. Diesen zweiten
Proceß, der zum Zwek hat, dem Tuche waͤhrend es der Pressung unterliegt, die
Hize zu entziehen, bewerkstellige ich auf folgende Art. Nachdem ein Theil des Tuches
in der in meinem fruͤheren Patente beschriebenen Maschine gepreßt worden ist,
bringe ich diesen Theil alsogleich aus der heißen in eine kalte, aber
uͤbrigens ganz auf dieselbe Weise gebaute Presse, die zu diesem Zweke dicht
neben ersterer angebracht seyn muß. Der Preßdekel der zweiten Presse ist hohl und
wird zum Behufe der Abkuͤhlung mit kaltem Wasser gefuͤllt. Durch
dieses schnelle Abkuͤhlen erhaͤlt das Tuch einen schoͤnern
Glanz, als wenn man es wie fruͤher langsam abkuͤhlen laͤßt.
Tafeln