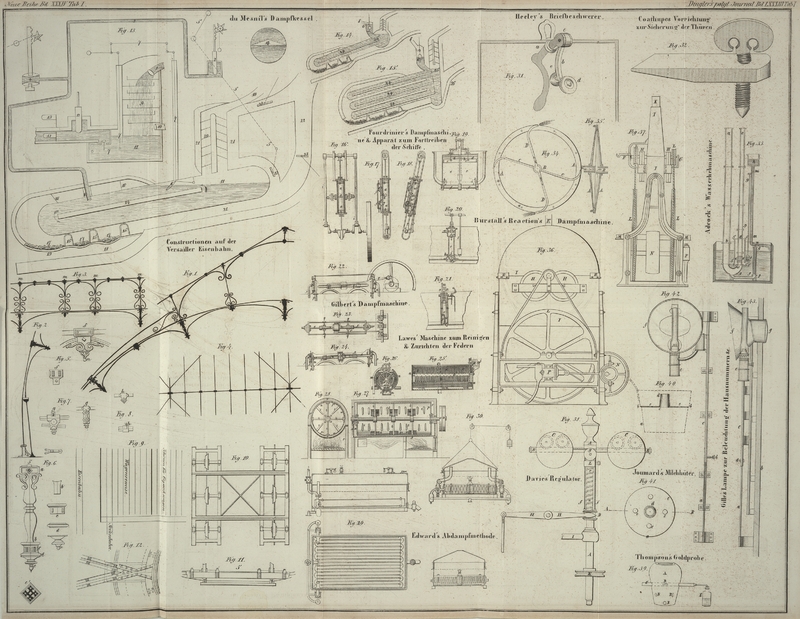| Titel: | Verbesserungen an den Dampfmaschinen, worauf sich George Alexander Gilbert, in Norfolk House, Battersea, in der Grafschaft Surrey, am 10. Sept. 1840 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 83, Jahrgang 1842, Nr. V., S. 30 |
| Download: | XML |
V.
Verbesserungen an den Dampfmaschinen, worauf sich
George Alexander
Gilbert, in Norfolk House, Battersea, in der Grafschaft Surrey, am 10. Sept. 1840 ein Patent ertheilen
ließ.
Aus dem London Journal of arts. Okt. 1841, S.
167.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
Gilbert's Verbesserungen an Dampfmaschinen.
Vorliegende Verbesserungen bestehen in gewissen Neuerungen in der Construction von
Maschinen, welche durch Dampf, Luft, Gas oder eine sonstige elastische Flüssigkeit
in Thätigkeit gesezt werden sollen. Der Patentträger macht nämlich den Vorschlag, an
die Stelle der seither üblichen schweren Cylinder gewisse Röhren zu sezen, welche
sich wie die Röhren eines Fernrohrs in einander verschieben lassen.
Fig. 22 ist
eine Vollständige Seitenansicht der Maschine; Fig. 23 ein Grundriß
derselben und Fig.
24 ein. senkrechter Längendurchschnitt der wirksamen Theile, wobei
Schwungrad und Kurbeln weggelassen sind.
Derjenige Theil der Maschine, welcher den gewöhnlichen Cylinder ersezen soll, besteht
aus zwei Röhren a und b,
Fig. 24.
Das eine Ende einer jeden dieser Röhren ist an eine Dampfkammer geschmiedet, welche
durch eine in der Mitte befindliche Scheidewand in zwei Räume c und d getheilt wird. Beide Röhren lassen
sich über den an dem Maschinengestell befestigten stationären Röhren e und f hin- und
herschieben. Um einen dampfdichten schluß herzustellen, sind an beiden Enden der
Röhren a und b die
Stopfbüchsen g, g angebracht. An den unteren Theilen der
Dampfbüchse befinden sich zwei Hähne v, v deren Zwek
darauf hinausgeht, die in der Büchse enthaltene Luft entweichen zu lassen, ehe man
die Maschine in Gang sezt.
Die Thätigkeit der gewöhnlichen Schiebventile h und i muß so regulirt werden, daß sie dem Dampf abwechselnd
den Eintritt in die Röhren e oder f gestatten und ihn aus denselben entweichen lassen. Das Ventil h ist in einer solchen Lage dargestellt, daß der Dampf
in die Röhren a und e
dringen kann, während das Ventil i dem in den Röhren b und f befindlichen Dampfe
den Ausweg gestattet.
Durch die Röhre j gelangt der Dampf aus dem Dampfkessel
in die Dampfkammer
k, von wo aus derselbe durch das Ventil h in die feste Röhre e und
von da durch die Schieberöhre in die Dampfkammer c
strömt. Indem der Dampf gegen die Scheidewand der Büchse c seine elastische Kraft ausübt, treibt er die Büchse mit den
Schieberöhren a und b nach
der rechten Seite hin. Der Dampf, welcher vorher die Röhren b, f und den Raum d erfüllte, entweicht durch
das geöffnete Ventil i und die Röhre l entweder in die freie Luft oder in einen
Condensator.
Ist die Schieberöhre b am Ende ihres Hubes angelangt, so
verschieben sich die Ventile h und i mit Hülfe eines in der Abbildung nicht angegebenen
Excentricums, welches auf die Stangen m, n wirkt, und
wechseln ihre Stellung. Jezt strömt der Dampf durch die Röhre o ein, nimmt seinen Weg durch das Ventil i,
die feste Röhre f und die Schieberöhre b, und tritt in die Dampfkammer d, wo er seine elastische Kraft in demselben Sinne, wie vorher, ausübt und
die Schieberöhren sammt Büchsen nach der entgegengesezten Richtung treibt. Der Dampf
aber, welcher vorher seine elastische Kraft in der Kammer c und den Röhren a, e ausgeübt hat, wird
verdrängt und entweicht durch die Austrittsröhre p. Die
Büchse c, d und die Röhren a,
b sind auf Frictionsrollen q, q, q, q, Fig. 22 und
23,
gelagert, und diese laufen in Einschnitten, welche in dem Maschinengestell
angebracht sind.
Die hin- und hergehende Bewegung der Büchse und der Röhren wird auf folgende
Weise in eine rotirende verwandelt. Mit der Außenseite der Büchse sind die
Lenkstangen r, r mittelst Bolzen verbunden (Fig. 23). Die
anderen Enden dieser Stangen sind mit den Kurbeln s, s
der in den Lagern u, u, u laufenden Hauptwelle t in Verbindung. Von dieser Welle aus wird die
Triebkraft durch Rolle und Laufband auf den in Bewegung zu sezenden Mechanismus
übertragen und durch ein Schwungrad regulirt.
Tafeln