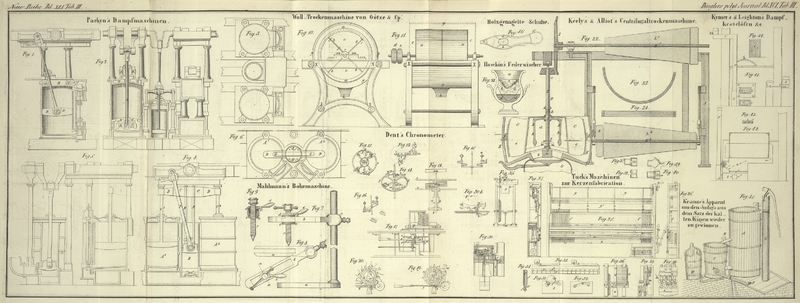| Titel: | Verbesserungen an den mit Anthracit oder Steinkohlen geheizten Dampfkesselöfen, worauf sich John Kymer, Kohlenbergwerksbesizer zu Pontardulais in der Grafschaft Karmarthen, und Thomas Hodgson Leighton, Chemiker zu Llanelly in derselben Grafschaft, am 21. Februar 1843 ein Patent ertheilen ließen. |
| Fundstelle: | Band 91, Jahrgang 1844, Nr. XLIII., S. 170 |
| Download: | XML |
XLIII.
Verbesserungen an den mit Anthracit oder
Steinkohlen geheizten Dampfkesseloͤfen, worauf sich John Kymer, Kohlenbergwerksbesizer zu Pontardulais
in der Grafschaft Karmarthen, und Thomas Hodgson Leighton, Chemiker zu Llanelly in derselben Grafschaft,
am 21. Februar 1843 ein Patent ertheilen
ließen.
Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Nov. 1843,
S. 260.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Kymer's u. Leighton's Dampfkesselöfen.
Unsere Erfindung bezieht sich auf die Construction der Ofenroste und auf eine
Anordnung der Roststäbe, vermöge welcher dieselben mit Wasser in Berührung sind und
Dampf entwikeln, der durch das Brennmaterial strömend eine freie und vortheilhafte
Verbrennung desselben veranlaßt.
Fig. 41 ist
die Frontansicht,
Fig. 42 der
Längendurchschnitt eines Dampfkesselofens, und
Fig. 43 der
Querschnitt der Roststäbe und der Wassertröge, worin die Roststäbe liegen.
Fig. 44 zeigt
den Grundriß der Wassertröge abgesondert. a ist der
Ofen; b der Aschenfall, der sich durch eine Thür c verschließen läßt, damit die Luft vermittelst eines
Ventilators in den Aschenfall geblasen werden kann; denn es ist beim Brennen von
Anthracit oder Steinkohlen ein bedeutender Luftstrom unter die Roststäbe
wünschenswerth. Durch die Röhre f gelangt die Luft von
dem Ventilator e bei g in
den Aschenfall. i, i sind
die Wassertröge, in welche die unteren Flächen der Roststäbe j, j treten und auf diese Weise mit dem darin befindlichen
Wasser in Berührung kommen. Durch diese Anordnung bleiben die Roststäbe kühl und
zugleich entwikelt die dem Wasser mitgetheilte Wärme dieser Stäbe Dampf, welcher mit
der Luft aus dem Aschenfall durch das Brennmaterial strömt und dadurch den
Verbrennungsproceß befördert. Man wird finden, daß obgleich das Brennmaterial sich
in einem Zustande sehr intensiver Gluth befindet, doch die Roststäbe nicht sehr
stark erhizt werden. k ist ein Wassereimer und l eine Röhre, welche die erwähnten Wassertröge
fortwährend mit Wasser versieht. Den Wasserzufluß reguliren wir mit Hülfe eines an
der Röhre l angebrachten Hahnes so, daß dasselbe immer
am oberen Rande der Wassertröge steht.
Tafeln