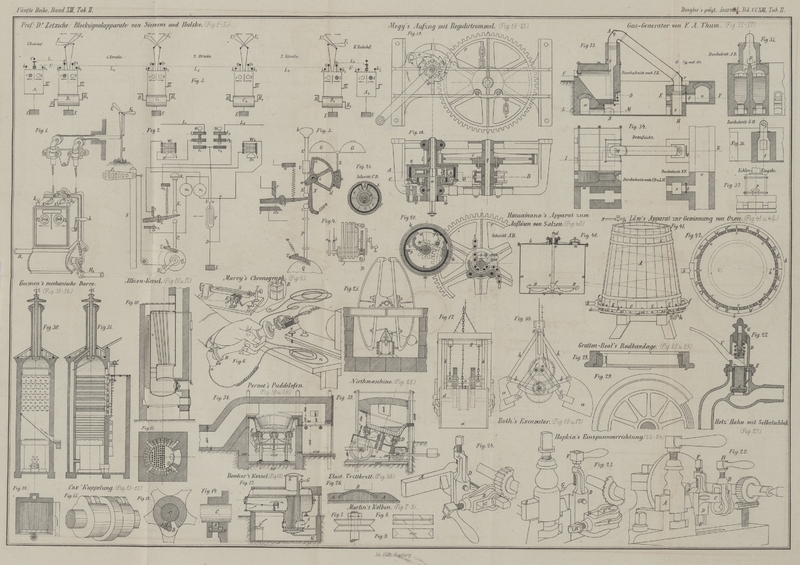| Titel: | Gecmen's mechanischer Darr- und Keim-Apparat für Malzfabrikation; ausgeführt von der Maschinenfabrik Germania (vormals J. S. Schwalbe und Sohn) in Chemnitz. |
| Autor: | J. |
| Fundstelle: | Band 213, Jahrgang 1874, Nr. XXXIV., S. 117 |
| Download: | XML |
XXXIV.
Gecmen's mechanischer Darr- und Keim-Apparat für
Malzfabrikation; ausgeführt von der Maschinenfabrik Germania
(vormals J. S. Schwalbe und Sohn)
in Chemnitz.
Mit Holzschnitt und Abbildungen auf Tab. II.
Gecmen's mechanischer Darr- und Keim-Apparat für
Malzfabrikation.
Schon auf der Wiener Weltausstellung 1873 hatte der in Modellform von Josef Gecmen in New-York exponirte Darrapparat das
lebhafte Interesse der Fachkreise auf sich gezogen.Vergleiche Gustav Noback: Bier, Malz, sowie
Maschinen und Apparate für Brauereien und Mälzereien auf der Wiener
Weltausstellung 1873 (S. 76). 66. Heft des officiellen
Ausstellungsberichtes. Druck und Verlag der k. k. Hof- und
Staatsdruckerei, Wien 1874. Seit dieser Zeit hat die Chemnitzer Maschinenfabrik Germania (vormals J. S. Schwalbe und Sohn) eine mechanische Mälzerei in Simmering bei Wien für
die Firma Jacob Zboril und Comp. mit solchem Erfolg ausgeführt, daß eine nähere Vorführung des Gecmen'schen Apparates und der Einrichtung der Mälzerei,
deren Daten uns die erwähnte Maschinenfabrik mit dankenswerther Bereitwilligkeit zur
Verfügung stellte, am Platze erscheint.
Der Gecmen'sche Apparat eignet sich zum Trocknen oder
Darren von Getreide, Früchten, Pflanzen, Malz etc. oder als Keimapparat zum Keimen
für Gerste u.a.m. Wie aus den bezüglichen Abbildungen in Figur 30 bis 32 ersichtlich
ist, befinden sich in einem geschlossenen Raum von quadratischem oder rechteckigem
Querschnitte eine Anzahl von über einander angeordneten Reihen muldenartiger Rinnen
– Trocken- oder Keimfächer. Diese Fächer können durch einen einfachen
Mechanismus (von der Kurbel a aus) der Reihe nach derart
in Bewegung gesetzt d.h. umgekippt werden, daß das in den
obersten Fächern aufgegebene Darr- oder Keimgut unter regelmäßigem Wenden successive in die tieferen Etagen gelangt und zuletzt
über eine schiefe Ebene als vollendetes Darr- oder Keimgut ganz aus dem
Apparat geschafft wird. Je nach dem Zweck des Apparates richtet sich die Zahl der Etagen etc.; ferner ist
unter dem Abrutschrost ein Calorifer bezw. ein Apparat zur Erzeugung von kühler,
feuchter Luft aufgestellt. Bei der Darre steigt die heiße Luft zwischen den (5
Centimeter von einander abstehenden) Fächern, welche aus geschlitztem Hordenblech
hergestellt sind, auf und führt den Wasserdampf durch den Dunstschlauch in's Freie;
im Keimapparat nimmt dagegen kühle Luft die sich bildende Kohlensäure mit.
Das Kippen der Fächer um ihre am Boden angesetzte Achse erfolgt in systematischer
Weise durch regelmäßig vertheilte Arme an der stehenden Welle b, welche durch ein Vorgelege mit der Kurbel a
in Verbindung steht. Die Fächer einer Etage sind untereinander derart verbunden, daß
durch die bezüglichen Arme an der Welle b sämmtliche
Rinnen dieser Etage umgekehrt und deren Inhalt in die nächsttiefere Fächerreihe
übergestürzt wird. Diese Bewegung erfordert so wenig Kraft, daß der Mechanismus
durch einen Jungen bedient werden kann.
Der Keimapparat in der Simmeringer Mälzerei nimmt einen
Flächenraum von 14 Qu. Met. ein; er ist 5,4 Met. breit, 2,5 Met. tief und 7,3 Meter
hoch, enthält 26 Etagen mit je 21 Rinnen, faßt an Keimgut ein Aequivalent aus 250
Zollcentner roher Gerste, und liefert an Grünmalz die nöthige Menge zur Erzeugung
von 38 bis 44 Zollcentner fertigen Malzes in 24 Stunden. Die Keimdauer beträgt 5 bis
6 Tage. Die Temperatur ist in den obersten Etagen 12,5° C., steigt gegen die
Mitte des Apparates auf 16 bis 19° C. und fällt auf die zugeführte Temperatur
in den untersten Etagen. Das Auftragen der gequellten Gerste auf die obere Etage und
das Wenden der Etagen beansprucht nur 1 Stunde Arbeitszeit unter 24 Stunden.
Die Malzdarre nimmt einen Flächenraum von 5,4 Quadratmeter
ein; dieselbe ist 1,7 Meter breit, 2,8 Meter tief, 4,4 Meter hoch, enthält 16 Etagen
mit je 7 geschlitzten Rinnen und können darauf bis 80 Zollcentner Malz in 24 Stunden
abgedarrt werden. Die Temperatur ist auf der obersten Etage 32,5° C. und
steigt bis zur untersten Etage, je nach der Farbe des Malzes auf 60 bis 125°
C. Zur Bedienung der Darre – nämlich Heizen, Entleeren der untersten Etage,
Wenden und Füllen der obersten Etage – genügt ein Arbeiter.
Nachfolgender Holzschnitt stellt die mechanische Mälzerei in Simmering im
Längenquerschnitt dar. A bezeichnet den Keimapparat, B den Darrapparat, C den
Rauchfang, D den Dunstschlauch, E den Heizraum, M den Raum für das aus der
Darre in die Putzmaschine herausfallende fertige Malz, G
drei übereinanderstehende eiserne Quellstöcke, H die
Wasserpumpe, J den Trichter (in welchen die gequellte
Gerste gefüllt wird, um
sie in den Wagen, welcher bei R steht, abzugeben, der
die Gerste in die obersten Rinnen auf einmal vertheilt), K einen einfachen Handaufzug, L den
Transporteur mit Klobenrad auf hängenden Schienen, N den
Raum für Abschöpflinge, O die Kurbel zum
Bewegungsmechanismus der Darr-Fächer,
Textabbildung Bd. 213, S. 119
P desgleichen für die
Keim-Etagen, Q den Wagen zum Auftragen des Grünmalzes auf
die oberste Darr-Etage, S, S Thermometer und T Raum für das aus dem Keimapparat herabfallende fertige
Grünmalz.
Die ganze Mälzerei steht auf einem Flächenraum von 130 Quadratmeter; sie enthält
noch, nebst den oben beschriebenen Apparaten und dem nöthigen Manipulationsraume, 2
hohe Getreidekästen (Silos) von je circa 1800
Zollcentner Fassungsraum, ferner ein Comptoir im ersten Stock und ein Zimmer im
zweiten Stock.Der Braumeister der Chemnitzer Societätsbrauerei Altendorf, Hr. Pagany, theilt in der deutschen Industriezeitung
1874, S. 258 nachstehendes Gutachten über die Leistungsfähigkeit des Gecmen'schen Systems, wie es in Simmering erprobt
worden ist, mit.„Das auf dem Apparat gewonnene Grünmalz war von solcher Qualität
und gab zu der Annahme volle Berechtigung, daß sich das Problem in der
Mälzerei durch diesen Keimapparat vollkommen zu lösen scheint. Das unter
meiner Beobachtung erzeugte Malz war, nachdem die Gerste den richtigen
Grad der Weiche erhielt und auf den Keimapparat aufgetragen wurde, nach
regelmäßigem, 6 bis 8stündigem Wenden durch successives Fortschreiten
der Keimung am siebenten Tage vollständig entwickelt und aufgelöst, der
Blattkeim erreichte trotz der vollständigen Auflösung des Kornes und des
langen Gewächses blos zwei Drittheile der Kornlänge. In der ersten
Entwickelung der Keime wurden bis zum dritten und vierten Tage Körner
bemerkbar, welche sich theilweise durch Zurückbleiben im Gewächs mehr
oder weniger ausbildeten, jedoch bis zum siebenten Tage ganz egal und
normal entwickelten.Das fertige Malz war von überraschender Qualität, in jeder Beziehung
vollständig aufgelöst, die Wurzelkeime ganz frisch, und zeichnete sich
besonders durch einen reinen feinen aromatischen Geruch, wie derselbe
auf Malztennen unter den günstigsten Verhältnissen nicht zu erzielen
sein dürfte, aus. Von einer Schimmelbildung war während des ganzen
Keimprocesses keine Spur bemerkbar. Ich erachte es für überflüssig, auf
eine weitere Detailirung der überhaupt getheilten Ansichten über den
Keimproceß einzugehen und betrachte eine vollständige Auflösung des
Kornes als den günstigsten Erfolg in der Mälzerei. Zur wesentlichen
Vervollkommnung des Keimapparates trägt hauptsächlich die geringe
Influenz der äußern Temperatur, sowie die entsprechend frische
Luftzuführung bei; es kann mithin eine übermäßige Erwärmung oder eine
Vertrocknung des Malzes, wie letztere bei dünner Haufenführung öfters
vorzukommen pflegt und gewöhnlich das Absterben der Keime vor der
vollständigen Entwickelung, resp. Auflösung zur Folge hat, nicht
stattfinden.Als Hauptvortheile dieses Keimapparates dürften nun namentlich
bezeichnet werden:a) der continuirliche Betrieb zur Erzeugung
einer gleich großen Quantität Malzes auch bei wärmerer Temperatur;b) Erzeugung eines gesunden schmackhaften
Malzes;c) Raumersparniß bezüglich der
Mälzerei-Anlage;d) Wegfall der difficilen Malzarbeit und
hohen Arbeitslöhne;e) Vermeidung des Verlustes durch Zertreten
von Körnern.Der in der Actienbrauerei zu Liesing bei Wien gemachte Probesud aus dem
auf dem Keimapparat erzeugten Malz lieferte, soweit ich mich persönlich
überzeugt habe, das günstigste Resultat. Die Würze zeigte bei dem
gleichen Quantum dort selbst erzeugten Malzes bester Qualität gleiche
Gradhältigkeit und weder im Brau- noch im Gährungsproceß eine
wesentliche Abweichung. Das Bier war nach 14tägigem Lager vollständig
klar.Nach diesen überaus günstigen Resultaten dürfte das Vorurtheil und
mancher Zweifel in Bezug auf den mechanischen Betrieb der Mälzerei
gehoben sein und wäre eine recht rege Unterstützung dieser wichtigen
Erfindung als neue Stütze der Bierbrauerei seitens der Fachgenossen
gewiß höchst wünschenswerth.“ Chemnitz, 1. Mai 1874.
J.
Tafeln