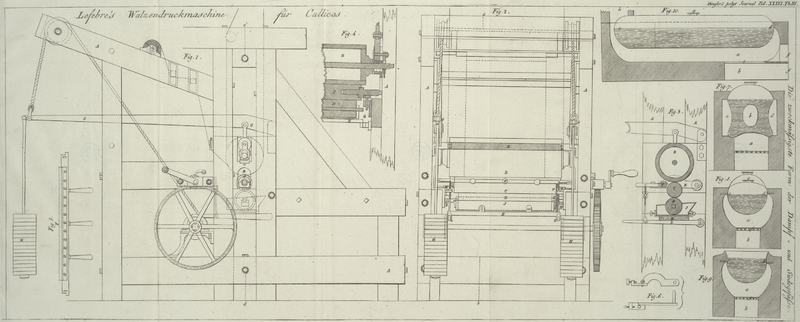| Titel: | Ueber die zwekmäßigste Form der Dampf- und Siedegefäße. Von Hrn. J. G. Peschel, k. Hofgrotteur und Wasserinspector in Dresden. |
| Autor: | J. G. Peschel |
| Fundstelle: | Band 36, Jahrgang 1830, Nr. XVII., S. 86 |
| Download: | XML |
XVII.
Ueber die zwekmaͤßigste Form der
Dampf- und Siedegefaͤße. Von Hrn. J. G. Peschel, k. Hofgrotteur und
Wasserinspector in Dresden.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Ueber die zwekmaͤßige Form der Dampf- und
Siedegefaͤße.
Die Dampf- und Siedekessel bei Dampfheizungen, Dampfkochereien,
Dampfmaschinen, Bier- und Essigbrauereien, Brantweinbrennereien,
Zuker-, Salz-, Laugensiedereien u. dgl. machen einen sehr wichtigen
Gegenstand in der technischen Oekonomie aus. Daß sehr viel von der Form derselben
abhaͤngt, wenn die darin auf den Siedepunkt zu bringenden oder zu
verdampfenden Fluͤssigkeiten in moͤglich kuͤrzester Zeit und
mit dem geringsten Aufwande des Feuermateriales geschehen soll, ist leicht
einzusehen.
Man hat schon verschiedene Arten von Dampfkesseln angewendet, und mancherlei
Abaͤnderungen daran vorgenommen, um die Verdampfung zu beschleunigen und an
Feuermaterial zu ersparen; man scheint aber die zwekmaͤßigste Form derselben
bis jezt noch gar nicht ausgemittelt zu haben; oder, wenn man ja derselben zuweilen
nahe gekommen ist, das Vortheilhafste daran nicht erkannt zu haben; wenigstens habe
ich nirgends einen zureichenden Grund angefuͤhrt gesunden: warum man ihre
Form gerade so und nicht anders gewaͤhlt habe; die Dampfkessel, die ich, als
die neuesten nach englischer Art, gesehen habe, sind gerade die
unzwekmaͤßigsten, die man dazu anwenden kann.
Die Erwaͤrmung des Wassers und die Entwikelung des Dampfes durch die freie
Waͤrme des Feuers kann in einem jeden Raͤume und in jeder Form eines
Gefaͤßes geschehen, wozu die Waͤrme Zutritt haben kann, und daselbst
chemische Aufloͤsungen und Verbindungen hervorbringen; die Wirkung des Feuers
selbst geschieht aber auf mechanische Weise, wobei sehr viel auf die Form und das
Verhaͤltniß des Gefaͤßes ankommt, in welchem die Fluͤssigkeit
zum Sieden gebracht oder verdampft werden soll, wenn das Fetter vollkommen darauf
wirken, die Verdampfung beschleunigen, und nicht ein zu großer Theil Hize dabei
unbenuͤzt verloren gehen soll.
In haͤuslichen Einrichtungen, beim Kochen und Braten der Speisen, wird die
Form der Gefaͤße mehr nach der Bequemlichkeit und Localitaͤt
eingerichtet, und wegen des Geschmaks der Speisen oft mehr Feuermaterial verwendet,
als eigentlich noͤthig waͤre; wo aber Feuerungsanstalten im Großen
betrieben werden, und das Feuermaterial ein großes Object ausmacht, da verdient wohl
die Form der Gefaͤße genau beruͤksichtigt zu werden. Um nun die
vortheilhafteste Form dazu auszumitteln, muß die Erfahrung zu Huͤlfe genommen
und die Wirkung des Feuers genau beobachtet werden. Folgende Erfahrungen halte ich
dazu fuͤr hinlaͤnglich, um das Nachtheilige an den Kesseln zu
erkennen, und das Vorteilhaftere dabei zu bestimmen:
Wenn man auf einen freien Herd einen Topf mit Wasser sezt, und um denselben herum ein
Feuer macht, um dieses Feuer aͤußerlich wieder so viel gleich große
Toͤpfe mit Wasser sezt, als neben einander Raum haben, so wird man glauben,
der mittlere Topf muͤsse weit fruͤher in's Kochen oder Sieden kommen,
als die aͤußeren Toͤpfe, weil diese nur mit einem kleinen Theile ihrer
Seitenflaͤche vom Feuer beruͤhrt werden, und jener ganz vom Feuer
umgeben ist. Die Erfahrung lehrt aber das Gegentheil; die aͤußeren
Toͤpfe kommen gewoͤhnlich fruͤher zum Kochen, als der
innere.
Wenn ferner ein gewoͤhnlicher Kochtopf mit der einen Seite am Feuer steht, und
die Fluͤssigkeit in demselben im Sieden ist, so kann man die dem Feuer
entgegengesezte Seite des Topfes nicht beruͤhren, ohne sich die Hand daran zu
verbrennen; ruͤkt man aber den Topf vom Feuer ab, so kann man die Hand an die
am Feuer gestandene Seite des Topfes so lang halten, als die Fluͤssigkeit in
demselben fortsiedet, ohne sich daran zu verbrennen. Sobald aber das Wallen des
Wassers im Topfe aufhoͤrt, wird der Topf auch sogleich an allen Seiten gleich
heiß, und man kann keine Seite mehr beruͤhren, ohne sich daran zu verbrennen.
Dieses geschieht auch an den Casserolen und Fischkesseln, die uͤber dem Feuer
stehen. Wenn ein Fischkessel waͤhrend des Kochens vom Feuer abgehoben wird,
und man sezt ihn mit dem Boden auf die hohle Hand, so kann er eine ziemliche Streke
auf derselben fortgetragen werden, ohne daß man sich daran verbrennt,
waͤhrend er weder am Henkel noch am oberen Rande beruͤhrt werden kann,
ohne daß man sich sogleich die Hand daran verbrennte. So verbrennt sich auch die
Hand an dem, aus einem Kessel stroͤmenden, siedenden Dampfe augenbliklich,
waͤhrend man den Kessel an der Seite des Feuers ein paar Secunden lang ohne
große Schmerzen anruͤhren kann. So weiß auch jeder Koch, daß auf einer
Herdplatte, wo bloß unter derselben das Feuer unterhalten wird, ein Topf mit Wasser
weit leichter kocht, als in einer Kochroͤhre oder Kochmaschine, wo die Hize
von allen Seiten auf
den Topf wirken kann. Ueberhaupt gestehen alle Koͤche, daß in einer jeden
Kochmaschine mehr Feuerungsmaterial zum Kochen verbraucht wird, als beim Kochen auf
dem freien Herde, wenn uͤbrigens beim Anlegen des Holzes vorsichtig zu Werke
gegangen wird. Die Vortheile einer Kochmaschine sind nie Ersparung an Feuermaterial,
sondern mehr Reinlichkeit und Schmakhaftigkeit der Speisen und andere
Waͤrmevortheile, und daß dabei jede Art von Feuermaterial angewendet werden
kann. Auch das Verdampfen geschieht auf einem freien Feuerherde schneller, als in
einer Kochmaschine. Wie schnell wurde z.B. die wenige Fluͤssigkeit, die man
beim Braten des Fleisches demselben zusezt, verdampfen, wenn man die Bratpfanne auf
einem freien Herde der Hize aussezte, in der das Fleisch in der Bratroͤhre
zum Roͤsten kommt, wo sie Stunden lang nicht ganz verdampft.
So kommt auch ein offenstehender Topf mit Wasser auf dem freien Herde eher zum
Kochen, als ein zugedekter; der Topf, der vorne am Feuer steht, wo die Luft von
außen hinzutritt, fruͤher, als der, der hinter dem Feuer steht, worauf die
Hize mehr stoͤßt u.s.w. Diese Erfahrungen habe ich auch durch viele, und zum
Theile sehr kostspielige. Versuche bestaͤtigt gefunden; die ich aber der
Weitlaͤuftigkeit wegen hier nicht beschreiben will. Aus dem
Angefuͤhrten wird zu ersehen seyn, daß jede Feuerungseinrichtung auf
Grundsaͤzen beruht, nach denen dabei verfahren, und die Form der
Gefaͤße zu bestimmen ist, wenn so wenig Feuermaterial als moͤglich
verschwendet werden soll.
Das Feuer wirkt naͤmlich, wie das Licht, strahlenmaͤßig, und durch die
Koͤrper in gleicher Richtung vor sich hin. Nur dadurch, daß es die
Koͤrper ausdehnt, das Wasser dadurch so, wie die Luft, leichter wird und in
der kaͤlteren in die Hoͤhe schwimmt, scheint sie mehr nach oben, als
nach unten zu gehen. Wenn man das Feuer oder den Feuerungsraum mitten in der
Fluͤssigkeit oder des Siedegefaͤßes anbringt, so wirkt das Feuer nach
allen Seiten, und es scheint keine Waͤrme dabei verloren zu gehen; allein die
Hize zerstreuet sich dabei zu sehr; die Fluͤssigkeit kommt aͤußerst
langsam in's Kochen, und eben so langsam geht alsdann die Abdampfung von Statten,
wobei nicht nur an Zeit, sondern auch an Feuermaterial verschwendet wird. Davon habe
ich mich durch einen sehr kostspieligen Versuch uͤberzeugt.
Wirkt dagegen das Feuer von zwei einander gegenuͤberstehenden Seiten auf die
Fluͤssigkeit, so wird die Wirkung zwar nicht aufgehoben, aber eine Wirkung
hindert die andere, und es wird dabei ebenfalls an Feuermaterial verschwendet. Das
Feuer, das einen Koͤrper durchdringen, erwaͤrmen und veraͤndern
soll, muß erst etwas aus demselben verdraͤngen, ehe es die Veraͤnderung
bewirken kann. Diese Verdraͤngung eines Bestandtheiles wird sehr verhindert,
wenn die Waͤrme von zwei entgegengesezten Seiten auf die Fluͤssigkeit
wirkt, wenigstens gehoͤrt ein Uebermaß von Feuer dazu, wodurch die
Verschwendung entsteht.
Der aus dem Wasser, welches erwaͤrmt oder in Dampf verwandelt werden soll,
zuerst zu verdraͤngende Bestandtheil ist unstreitig der
Kaͤltestoff.Von der Hypothese des Kaͤltestoffes ist man heute zu Tage so ziemlich
zuruͤkgekommen.A. d. R. Wenn man z.B. zu einiger Dike uͤber einander gelegten Wollenzeug auf
einen Ofen zum Erwaͤrmen legt, so wird die aͤußere Seite erst
bedeutend kaͤlter, ehe man etwas von der Erwaͤrmung
verspuͤrtDer Hr. Verfasser scheint das Gesez der Verminderung der Temperatur bei dem
Uebergange einer tropfbaren Fluͤssigkeit in gasfoͤrmige hier
uͤbersehen zu haben.A. d. R. Dasselbe geschieht auch bei einem jeden anderen auf diese Art zu
erwaͤrmenden Koͤrper. Daß diese Verdraͤngung der Kaͤlte
eben so, wie die Wirkung der Waͤrme, in gleicher Richtung geschieht, beweiset
das bekannte Experiment mit einem Teller voll Schnee und Eis. Sezt man auf einen
solchen Teller mit Schnee und Eis einen anderen mit Wasser, so schmilzt in einem
erwaͤrmten Zimmer das Eis nach und nach, ohne eine merkliche
Veraͤnderung in dem Wasser des oberen Tellers hervorzubringen; wird aber
unter dem ersten Teller ein Kohlenfeuer angebracht, so wird das Wasser im oberen
Teller in Eis verwandelt, indem das Eis im unteren Teller schmilzt; dasselbe
geschieht auch umgekehrt. Hier wird durch die strahlenaͤhnliche Wirkung des
Feuers auf das Eis der Kaͤltestoff, als ein besonderer Bestandtheil im
Wasser, genoͤthiget in gleicher Richtung zu entweichen, aͤußert auf
diesem Wege noch seine Wirkung auf das Wasser, und verwandelt dasselbe in Eis.
Dieses Verdraͤngen eines Bestandtheiles muß, nach den vorangefuͤhrten
Erfahrungen, auch im Wasser noch fortgehen, bis dasselbe durch die Hize des Feuers
in einen gasartigen Dampf verwandelt worden ist. Ob aber das Eis in der halben Zeit
zerschmelzen wuͤrde, wenn man von zwei Seiten ein Kohlenfeuer auf dasselbe
wirken ließe, und auf diese Art mit doppeltem Aufwande an Feuermaterial auch
doppelte Wirkung hervorbringen koͤnne? dieses habe ich noch nicht
versucht.
Die Zeit, die das Feuer braucht, um einen Koͤrper zu durchdringen, ist
ebenfalls bei der Form der Siedegefaͤße zu beruͤksichtigen. Die
Feuermaterialien brauchen zum Theile mehr, zum Theile weniger atmosphaͤrische
Luft zum Verbrennen, wovon das Stikgas und die entwikelten Gasarten wieder
entweichen muͤssen und die Hize mit fortfuͤhren. Wenn diese Gase einen
Siedekessel zu geschwind verlassen, so kann nur wenig von ihrer Hize auf die Fluͤssigkeit
wirken, und es muß dabei ein großer Theil des Feuermateriales unbenuͤzt
verloren gehen.
Dieß sind die Gruͤnde, auf welchen die Form der Dampfkessel beruht, in welchen
das Wasser bis zur Verwandlung in Dampf gebracht werden soll, wenn man das Feuer mit
Vortheil dabei anwenden will; und es laͤßt sich auch daraus die
Unzwekmaͤßigkeit ersehen, wornach viele Dampf- und Siedekessel geformt
und construirt sind. Es sey z.B. Fig. 7. der Durchschnitt
eines Dampfkessels, wie ich einen dergleichen neu gefertigten vor ein paar Jahren
gesehen habe, und wie man sie gewoͤhnlich in den Aufrissen der englischen
Dampfmaschinen gezeichnet findet. Diese Form von Dampfkesseln hat an sich viel
Zwekmaͤßiges: die Kessel sind nach derselben gewoͤhnlich sehr hoch und
nicht lang gebauet und nehmen daher wenig Raum ein; das Bogenfoͤrmige am
Boden und an den Seiten widersteht dem Zerspringen derselben; die Hoͤhlung
durch die Mitte derselben haͤlt beide Stirnseiten zusammen, und das Feuer hat
sehr viel Beruͤhrungspunkte mit der Fluͤssigkeit. Nach den auf
Erfahrungen beruhenden Grundsaͤzen sind sie aber gegen die vortheilhafte
Wirkung des Feuers geformt; mithin holzverschwendend, und daher auch
unzwekmaͤßig construirt. Das Feuer brennt in dem Feuerungsraume a unter dem Kessel hinter, durch die Hoͤhlung b, wieder hervor, geht von da zu beiden Seiten c und d wieder zuruͤk
und zur Esse hinaus. Die Hize des Feuers in a unter dem
Kessel ist groͤßer, als die bei b hervorkommt.
Die Hize in b ist wieder groͤßer, als die zu
beiden Seiten c und d. Da
nun die Hize in b schon kleiner seyn muß als in a, und noch dazu strahlenmaͤßig und zerstreuend
wirkt, so kann sie zur Vermehrung der Hize von a nichts
beitragen, wohl aber dieselbe in ihrer Wirkung verhindern. Eben so ist es mit der
Waͤrme zu beiden Seiten c und d, diese muß von der Hize, die aus b wirkt, ganz verdraͤngt und unwirksam gemacht
werden. Die große Beruͤhrungsflaͤche, die bei dieser Form der
Erwaͤrmung dargeboten wird, kann sehr wenig zur Vermehrung derselben
beitragen; im Gegentheile, die Hize wirkt von allen Seiten zerstreuend auf die
Fluͤssigkeit, und auch einander entgegen. Es gehoͤrt mithin ein großer
Ueberschuß von Feuer dazu, um alle diese Gegenwirkungen zu uͤberwinden, und
die Verdampfung in einem solchen Gefaͤße zu beschleunigen; und ich halte
daher diese Form fuͤr die unzwekmaͤßigste, die man dazu erfinden und
anwenden kann. Die Erfahrung mag auch schon manchen Maschinenbauer und Inhaber
derselben davon uͤberzeugt haben. Nur scheint man nicht zu wissen, was dabei
abzuaͤndern oder zu verbessern ist. Zwekmaͤßiger, und unter allen
moͤglichen Formen, die man Dampfgefaͤßen geben kann, die
vorteilhafteste ist die Kugelform, Fig. 8.
Bei der Kugelform kann, wenn diese bis zur Haͤlfte angefuͤllt und bis
auf diese Hoͤhe in den Feuerungsraum eingesenkt ist, die Hize des Feuers von
allen Seiten auf die Fluͤssigkeit wirken, ohne sich entgegen zu wirken, und
hat auf diese Art Gelegenheit sich ungehindert und am vollkommensten der
Fluͤssigkeit im Siedegefaͤße mitzutheilen. Da aber die Hize nicht
schnell genug die Fluͤssigkeit zu durchdringen vermag, sondern einige Zeit
dazu braucht, auch durch den Luftzug, den das Feuer zum Verbrennen noͤthig
hat, zum Theile fortgefuͤhrt wird, so muß das Siedegefaͤß eine
verhaͤltnißmaͤßige Laͤnge haben, damit sich die Flamme an
denselben ausbreiten kann und die Hize mehr Zeit bekommt auf die Fluͤssigkeit
zu wirken, was bei der bloßen Kugelform nicht geschehen kann.
Fig. 8. stellt
einen solchen Dampfkessel im Quer- und Fig. 10. im
Langendurchschnitt vor; a, ist der Feuerungsraum; b, der Aschenherd; c, d, die
Hoͤhe der Fluͤssigkeit im Kessel; e, der
Rost und f, f, die Thuͤren zur Einheizung und zum
Aschenherde. Da ich bloß von der Form dieser Kessel spreche, so sind die
uͤbrigen Einrichtungen, die an dergleichen Kesseln angebracht werden, als
bekannt weggelassen, und ich bemerke nur, daß das Dampfrohr g in der Mitte desselben anzubringen ist. Gleiche Form muͤssen auch
die Pfannen, die oben offen sind, wie Fig. 9. im Durchschnitt
zeigt, haben.
Der hier verzeichnete Kessel ist vier Mal so lang, als breit angenommen; und diese
Laͤnge ist bei jedem Feuermateriale, das mit Flamme brennt, nothwendig, wenn
die Hize auf die moͤglich vollkommenste Weise benuͤzt werden soll. Die
Laͤnge des Rostes oder der Raum, den das zum Verbrennen eingelegte
Feuermaterial einnimmt, betraͤgt aber nur den vierten Theil der Laͤnge
des Kessels. Die uͤbrigen drei Theile desselben werden hinlaͤnglich
von der Flamme und von der Gashize erwaͤrmt. Die, Hize ist bei a, wo das Feuer unter dem Kessel brennt,
natuͤrlich groͤßer, als da, wo sie bei c,
zur Esse, h, hinausfaͤhrt; aber beide, die
groͤßere und die kleinere Hize, koͤnnen einander in der Wirkung auf
die Fluͤssigkeit nicht hindern, und haben Gelegenheit, beinahe die ganze
Temperatur, die zur Verdampfung der Fluͤssigkeit noͤthig ist, an den
Kessel abzusezen. Bei Anwendung der Kohks, Holzkohlen oder eines anderen
Feuermateriales, das nicht mit Flamme brennt, und weniger atmosphaͤrische
Luft zum Verbrennen braucht, oder auch, wo der Dampf in sehr stark erhiztem Zustand
angewendet wird, kann man die Form etwas kuͤrzer waͤhlen. Wenn aber
die Fluͤssigkeit bloß zum Siedepunkte zu bringen ist, wie beim Bier-
und Essigbrauen, beim Brantweinbrennen, besonders bei Abdampfungen in den
Salzsiedereien u. dgl. ist es vortheilhafter, sie noch laͤnger, oder so lang
zu nehmen, daß der Rauch nur noch die Temperatur des Siedepunktes hat, wenn er den Kessel
verlaͤßt. Bei allen Einrichtungen aber, wo Wasser zum Siedepunkte gebracht,
oder in Dampf verwandelt werden soll, (lezterer mag zu was immer fuͤr einer
Drukhoͤhe auch gebracht werden sollen) muß die Kugel- oder
Cylinderform und die angegebene Wasserhoͤhe in denselben beibehalten werden,
wenn man kein Feuermaterial dabei verschwenden will; man mag uͤbrigens der
Spannung wegen einen vollen Kreis waͤhlen, oder zur Deke nur einen
gedruͤkten Bogen nehmen. Wo aber Wasser nicht in Dampf verwandelt, sondern
bloß in eine große Gluͤhhize gebracht werden soll, was bei einigen Maschinen
mit hohem Druke geschehen ist, muß das Gefaͤß ganz voll Wasser gehalten
werden, und man kann die Hize von allen Seiten darauf wirken lassen. Hierbei kann
nur allerdings das, was man Verschwendung des Feuermaterials nennen kann, in dem
Feuerungsraume geschehen. Auch in dem Feuerungsraume koͤnnen bei dergleichen
Einrichtungen Fehler begangen werden.
Die Erfahrung lehrt, daß das Feuer in einem Cylinder oder in einer blechernen
Roͤhre am lebhaftesten, das ist, mit der meisten Flamme brennt. Man muß daher
jede Feuerung so viel als moͤglich kreisfoͤrmig einrichten, wie es in
Fig. 8 und
9.
angegeben ist. Dieser Raum wird so groß genommen, als noͤthig ist, um so viel
Feuermaterial einzulegen, als zur erforderlichen Hize gebraucht wird. Da nun das
Feuermaterial verschieden ist, und das eine mehr Hize auf einmal erzeugt, als das
andere; so muß dieser Raum nach der Wirksamkeit des zu verbrauchenden Feuermittels
bestimmt werden. Ist dieser Raum zu groß, so bleibt entweder zu viel Raum zwischen
dem Feuer und dem Kessel, oder der Heizer legt auf ein Mal zu viel ein, und sucht
sich durch Daͤmpfung des Luftzuges zu helfen, wenn auf ein Mal mehr Hize
erzeugt wird, als noͤthig ist, wobei sowohl die Verbrennung des Materiales
als die Benuͤzung der Hize unvollkommen geschieht. Es ist uͤberhaupt
unverzeihlich, mit welcher Nachlaͤssigkeit bei vielen Feuerungen die
Unterhaltung des Feuers durch das Nachlegen des Materiales betrieben wird. Hierzu
sollte man gerade die vorsichtigsten und fleißigsten Arbeiter waͤhlen. Die
meisten stopfen gewoͤhnlich die Feuerungsraͤume so voll, daß sie lange
Zeit Muße haben, ehe sie wieder nachlegen duͤrfen, wobei sehr viel Material
verschwendet wird.
Der uͤbrige Raum vom Feuer unter dem Kessel bis zur Esse darf auch nicht
kleiner als der Feuerungsraum genommen werden, wenn das Material mit voller Flamme
brennen soll. Manche Feuerungsarbeiter glauben der Hize des Feuers mehr Wirkung zu
geben, wenn sie den Feuerungsraum am Ende enge zusammen ziehen, und einen sogenannten Fuchs bilden, um
eine Stichflamme hervorzubringen. Es ist wahr, daß wenn die Flamme des Feuers bis
durch diese Verengung geht, die Hize dadurch sehr zusammen gedraͤngt wird, so
daß der Kessel an diesem Orte weit eher verbrennt, als an den uͤbrigen
Stellen; aber die Flamme brennt dabei unvollkommen, und die Hize wird zu schnell vom
Kessel hinweg gefuͤhrt, und kann zu wenig auf die ganze Fluͤssigkeit
wirken. Der Rauch wird zwar von da noch ein Mal um den Kessel herum gefuͤhrt,
die Hize desselben kann aber, nach oben angefuͤhrten Ursachen, zur
Erwaͤrmung der Fluͤssigkeit im Kessel nichts mehr beitragen. Bei jedem
Feuermateriale, das mit Flamme brennt, nimmt gemeiniglich die Flamme einen noch
groͤßeren Raum ein, als das angelegte brennende Material selbst. Wenn man
daher diesen Raum zu sehr verengt, so wird dadurch nicht nur der Luftzug gehindert,
sondern die Flamme kann auch nicht vollkommen brennen. Soll die Flamme in diesem
Raume ganz ohne Rauch verbrennen, so muß man derselben durch besondere kleine
Oeffnungen hinter dem Feuer noch etwas atmosphaͤrische LuftUnd wenn moͤglich heiße Luft.A. d. R. zustroͤmen lassen, indem die Luft, die das Feuer durch den Rost oder
die Einheizthuͤre erhaͤlt, groͤßten Theils zersezt wird, ehe
sie zur Flamme kommt. Das Gas selbst, welches vom Feuer stroͤmt und noch viel
Hize enthaͤlt, ist in einem sehr ausgedehnten Zustande, und wuͤrde
ebenfalls so schnell vom Kessel entweichen muͤssen, wenn der uͤbrige
Raum zu eng gehalten wird; wuͤrde eben darum auch nicht mehr Hize an den
Kessel absezen koͤnnen.
Es ist ferner sehr rathsam, die inneren Seiten des Feuerungsraumes mit Eisenplatten
zu belegen, Statt, wie vorgeschlagen worden ist, dieselben mit lokeren Massen, wie
mit Lehm, mit Thon, mit Kohlenpulver gemengt u. dgl., auszustreichen. Erstens,
brennt ein jedes Feuer am vollkommensten, wenn die ganze Umgebung in der
Gluͤhhize steht, und zweitens, reflectirt auch diese Hize der Umgebung mehr,
als bei einem lokeren Koͤrper. Zur Zusammenhaltung der Waͤrme ist es
vortheilhafter, den Raum zwischen diesen Eisenplatten und der Mauer mit Asche oder
mit einem anderen lokeren Koͤrper auszufuͤllen, oder denselben auch
hohl zu lassen.
Eben so ist es auch rathsamer bei Cylinder-Feuerungen, wo entweder Wasser bloß
in eine Gluͤhhize gebracht, und dann in einem anderen Raume in Dampf
uͤbergehen soll, oder wo brennbares Gas aus Steinkohlen entwikelt werden
soll, daß jeder Cylinder in einem besonderen Heizraume steht, als daß mehrere
Cylinder neben und uͤber einander in einem Heizraume angebracht sind.
Es sind noch zwei Umstaͤnde zu erwaͤhnen, die bei der Dampfentwikelung
beruͤksichtigt
zu werden verdienen. Erstens kocht das Wasser weit geschwinder, und oft in der
halben Zeit, wenn Gemuͤse oder andere Koͤrper in demselben zum Feuer
gesezt werden. Sollte es nicht zur Beschleunigung des Dampfes vortheilhaft seyn,
wenn in die Dampfkessel harte Kieselsteine oder Metallkugeln eingelegt
wuͤrden?Man gibt in England etwas Erdaͤpfelkleie in den Dampfkessel.A. d. R. – Zweitens ist es bekannt, daß destillirtes Wasser weit leichter
kocht und verdampft, als Brunnenwasser; daß aber Oel und Fett das Kochen sehr
verhindert. Nun wird zwar bei Dampfmaschinen das verdampfte und wieder verdichtete
Wasser wieder in den Kessel gebracht; allein es kommt auch zugleich eine Menge Fett
von dem Einschmieren mit in den Dampfkessel, das der Verdampfung sehr hinderlich
seyn muß.Jede Koͤchin weiß, daß wenn beim Fischsieden, da Fische
gewoͤhnlich bei einem lebhaften Flammenfeuer rasch gesotten werden
muͤssen, zulezt etwas Butter oder eine andere Fettigkeit zugesezt
wird, das Ueberkochen des Wassers dadurch sogleich niedergehalten wird und
bei aller Hize nicht wieder in die Hoͤhe kochen kann. Dieß beweiset,
daß dadurch die Verdampfung desselben sehr aufgehalten wird. In einem
offenen Gefaͤße, wo das siedende Wasser Wellen schlaͤgt, wird
diese Fettdeke noch durchbrochen; in einem Dampfkessel aber, wo dieses
Wallen im wirklichen Siedepunkte voͤllig aufhoͤrt, kann sich
die, nach und nach eingebrachte Fettigkeit auf der ganzen ruhigen
Oberflaͤche des Wassers ausbreiten, und die Dampfentwikelung dadurch
sehr verhindern, was sorgfaͤltig vermieden werden muß. Sollte es nicht vortheilhafter seyn, hierzu anderes und reines Wasser zu
nehmen, das in einem besonderen Gefaͤße von dem abgehenden Rauche dem
Siedepunkt nahe gebracht werden kann? – Große Wirkungen haͤngen oft
von kleinen Umstaͤnden bei einer Sache ab; man muß daher auf alles
Ruͤksicht nehmen, was dabei Einfluß haben kann, um den moͤglich
groͤßten Vortheil davon zu erhalten.
Von den Vortheilen der von mir angegebenen Kesselform hatte ich vor 12 Jahren in
Berlin Gelegenheit mich zu uͤberzeugen. Ich besuchte naͤmlich daselbst
eine Drathzieherei, in welcher mit einer, in Berlin gefertigten Dampfmaschine
gearbeitet wurde; ich fand diese Maschine sehr gut und zwekmaͤßig gebaut;
besonders gefiel mir der Dampfkessel derselben. Dieser war aus Kupfer gefertigt, und
bestand in einem langen Cylinder, voͤllig kreisrund, 1 1/4 Elle im
Durchmesser und uͤber 5 Ellen lang. Ich fragte die beiden Herren Besizer
sogleich nach der Consumtion der Kohlen. Diese gaben mir ihre volle Zufriedenheit
mit der Maschine zu erkennen, und gestanden mir, daß ihre Maschine etwa die
Haͤlfte der Kohlen verbrauche, welche andere Maschinen dieser Groͤße,
die sie untersucht haͤtten, noͤthig haben; ohne zu ahnden, daß dazu
die Form des Dampfkessels das Meiste beitraͤgt. Denn als ich nach der Absicht
bei dieser Form fragte, entgegneten sie mir: „des Zerspringens wegen, und
weil es das Local gerade gestattete, einen mehr langen als breiten Dampfofen
anzubringen. Das Werk stand eben still. Die Herren waren so gefaͤllig, mir zu erlauben,
den folgenden Tag wiederzukommen, wo ich schon fruͤhe das Werk in
Thaͤtigkeit finden wuͤrde. Diese Gelegenheit benuͤzte ich
auch; nicht des Drathziehens wegen, sondern um mich von der Wirkung des Kessels
zu uͤberzeugen; der der erste und auch einzige dieser Art war, den ich
gesehen oder gezeichnet gefunden hatte. Als ich den zweiten Tag dahin kam, war
die Maschine ebenfalls nicht im Gange. Der freundliche Inhaber entschuldigte
sich mit einer kleinen Reparatur, die daran noͤthig geworden, die aber
bald hergestellt seyn wuͤrde. Ich glaubte nun etwas lang warten zu
muͤssen, ehe der Kessel auf den Siedepunkt kommen wuͤrde, weil
noch alles an demselben verschlossen war. Allein zu meiner Verwunderung ging die
Maschine auf einmal fort, eine Zange wurde eingelegt, und 7/4 Zoll starke
Kupferstangen wurden mit einer solchen Kraft durchgezogen, daß sie nach ein paar
Mal Durchziehen im Wasser abgekuͤhlt werden mußten. Die Maschine hatte
einen Cylinder von 10 Zoll im Durchmesser mit Messingkolben, und arbeitete,
außer der Condensation, mit 12 Zoll Queksilberhoͤhe Druk; diese Kraft
wurde so verbraucht, daß dem sehr großen Schwungrade, nach jedem Durchziehen,
das wenige Secunden dauerte, wieder etwas Zeit gelassen werden mußte, sich zu
erholen. Ich gab meine Verwunderung daruͤber zu erkennen, daß ich es bei
einem solchen Druke nicht wagen wuͤrde, den Dampfkessel bei vollem Feuer
zu verschließen. Man entgegnete mir, „sie haͤtten dabei nichts
zu befuͤrchten; es wuͤrde gewoͤhnlich bei 10 bis 12
Zoll Druk gearbeitet; wenn sie Mittags zum Essen gingen, wuͤrde der
Dampfhahn zugedreht und der Luftzug zum Feuer etwas gedaͤmpft, und
nach dem Essen ginge die Maschine sogleich ihren Gang wieder fort; das
Queksilber stiege dabei hoͤchstens um 2 Zoll hoͤher und noch
nie sey das Sicherheitsventil dabei geoͤffnet worden.“
– Ein Beweis mehr, wie vortheilhaft diese Form und das Verhaͤltniß
dieses Kessels war; wie vollkommen die Hize des darunter brennenden
Feuermateriales benuzt wurde, die die Compression des Dampfes, nach dem
Abschließen des Dampfrohres, nicht weiter zu bringen vermochte. Bei welcher
andern Form von Dampfkesseln duͤrfte diese kuͤhne
Nachlaͤssigkeit, ohne Gefahr zu besorgen, wohl zu wagen seyn!
–
Diese Drathzieherei soll aber nicht rentirt haben und nachher wieder eingestellt
worden seyn. Es ist mir jedoch nicht bekannt, wozu diese Maschine weiter verwendet
wurde. Wer daher bei Dampf- und Siedekesseln alle moͤgliche Vortheile
benuͤzen, nicht uͤberfluͤssiges Feuermaterial verschwenden will
und durch keine Localverhaͤltnisse und andere Ursachen daran behindert wird,
der pruͤfe die angefuͤhrten Grundsaͤze und ahme die angegebene
Form nach! –
Bei Dampfbooten, die weite Reisen zu machen haben, ist es besonders hoͤchst noͤthig,
auf die moͤglich groͤßte Ersparung des Feuermateriales
Ruͤksicht zu nehmen. Außer der Kohlenverschwendung finde ich noch an diesen
Fahrzeugen die Schaufelraͤder, mit allen ihren Verbesserungen, sehr
unzwekmaͤßig gebaut, so daß groͤßten Theils die halbe Kraft der
Dampfmaschine verloren gehen muß. Meine Ansicht und Angabe, wie dieselben beschaffen
seyn muͤssen, werde ich naͤchstens bekannt machen.
Tafeln