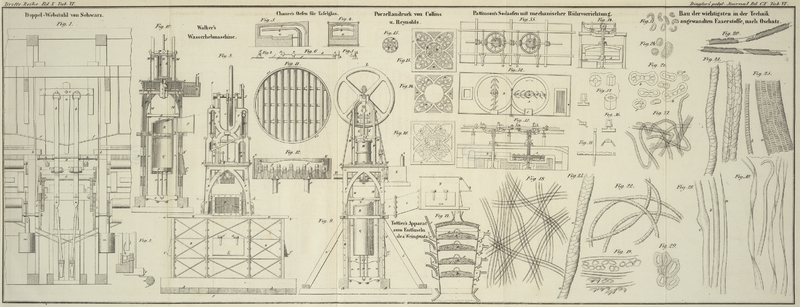| Titel: | Ueber den Bau der wichtigsten in der Technik Anwendung findenden Faserstoffe, als sicherstes Kennzeichen zu ihrer Unterscheidung; von Dr. A. Oschatz. |
| Fundstelle: | Band 110, Jahrgang 1848, Nr. LXVII., S. 343 |
| Download: | XML |
LXVII.
Ueber den Bau der wichtigsten in der Technik
Anwendung findenden Faserstoffe, als sicherstes Kennzeichen zu ihrer Unterscheidung; von
Dr. A.
Oschatz.
Aus dem Berliner Gewerbe-, Industrie- und
Handelsblatt, 1848, Nr. 1 bis 11.
Mit Abbildungen auf Tab.
VI.
Oschatz, über den Bau der Faserstoffe welche in der Technik
angewandt werden.
Das verschiedene Verhalten der Gespinnste und Gewebe gegen chemische Einwirkungen,
mithin auch gegen die Färbemittel, hat seinen Grund theils in ihrer chemischen
Zusammensetzung, theils in ihrem Baue. Die aus dem Thierreich herstammenden
Faserstoffe, als Wolle, Haare überhaupt und Seide zeichnen sich durch ihren Gehalt
an Stickstoff aus, der beim Verbrennen den eigenthümlichen Geruch nach verbranntem
Horne verursacht, indem diese Stoffe sämmtlich mit dem Horne, den Federn und der Oberhaut unseres
Körpers, die gleichfalls aus Hornsubstanz besteht, übereinstimmen. Beim Verbrennen
bilden sie eine blasige Kohle, die sich nur schwer einäschern läßt, und an welcher
die frühere Structur nicht mehr zu erkennen ist, indem sie zuerst durch Einwirkung
der Hitze erweicht, gewissermaßen geschmolzen werden, ehe unter Entwickelung von
Gasblasen die Verkohlung stattfindet.
Die vegetabilischen Fasern dagegen sind nur aus Kohlenstoff, nebst Sauerstoff und
Wasserstoff, in dem Verhältnisse um Wasser zu bilden, zusammengesetzt. Sie
verbrennen an der freien Luft mit Leichtigkeit vollständig, indem sie nur einen
geringen Antheil unverbrennlicher Bestandtheile als Asche zurücklassen. Ihre bei
unvollständiger Verbrennung zurückbleibende Kohle ist nicht merklich zusammen
gesintert und zeigt noch fast vollständig den ursprünglichen Bau. Auf diesem
abweichenden Verhalten beim Verbrennen beruht die bekannte Prüfung der Fasern durch
Anbrennen. Man vermag mittelst derselben wohl Baumwolle von Wolle zu unterscheiden,
aber nicht Floret- oder gekratzte Seide von Wolle, noch auch mit Bestimmtheit
Baumwolle von Leinen.
Ebenso unterscheiden sich nur im allgemeinen die animalischen Faserstoffe von den
vegetabilischen durch ihre schnellere Löslichkeit in ätzenden alkalischen
Flüssigkeiten, wogegen alle Verschiedenheit in dem Verhalten von Fasern derselben
Hauptgruppe gegen Säuren und Alkalien nur eine gradweise, also nicht genau
bestimmbar ist. Auch die in neuerer Zeit so angelegentlich zur Unterscheidung von
Leinen und Baumwolle empfohlene Schwefelsäure löst die Fasern der letztern unter den
vorgeschriebenen Bedingungen nur etwas schneller auf, und gewährt daher, abgesehen
von ihrer Umständlichkeit, kein ganz sicheres Merkmal.
Am sichersten ist jedenfalls die mikroskopische Probe. Für
keinen unserer Sinne ist eine ähnliche Verstärkung und Gebietserweiterung gewonnen
worden, wie für das Auge durch das Mikroskop, dessen allgemeinere Benutzung auch dem
Interesse vieler Gewerbtreibenden, namentlich dem Manufacturisten und Färber sehr
förderlich seyn würde, zumal jetzt, wo brauchbare derartige Instrumente zu sehr
billigen Preisen zu erlangen sind. Zum Belege hiefür theilen wir nun die
Beschreibung des Baues der wichtigsten Faserstoffe mit, wie er sich bei einer
höchstens 300maligen Vergrößerung dem Untersuchenden darbietet.
Structur der Seide.
Die Seide zeigt den einfachsten Bau unter den zu betrachtenden Faserstoffen. Die
Seidenmaterie wird in der lebenden Raupe aus dem blaßgelben Blute derselben in
zwei schlauchartige Säcke abgeschieden, welche zur Zeit der Spinnreife strotzend mit
der dickflüssigen, klebrigen und durchscheinenden Masse angefüllt sind. Aus jedem
von ihnen führt ein dünner Ausführungsgang nach einem kleinen Zapfen unter dem
Maule, der Spinnwarze, in welcher sie dicht nebeneinander zu Tage kommen. Dieser
Erzeugungsweise gemäß besteht das Gespinnst des Cocons aus dichten, nicht hohlen Doppelfäden, wie dieß auch aus der gleichförmigen Lichtbrechung der Fäden hervorgeht. Ein
durch geringere Lichtbrechung verschiedener Saum, häufig in eckigen Aussprüngen
unregelmäßig hervortretend, rührt von einem auch in chemischer Beziehung
verschiedenen Ueberzuge her, dem sogenannten Bast oder Gummi, nach dessen
Beseitigung die Fasern völlig glatt erscheinen. Betrachtet man aus demselben Cocon
nebeneinander ein Blättchen Gespinnstlage aus der äußersten Partie, und ein anderes
aus der innern, so findet man, daß die letztere wohl um ⅓ feiner ist als die
erstere, woraus folgt daß der Ausführungsgang sich immer stärker zusammenzieht,
jemehr die Seidenmaterie im Spinnsacke abnimmt. Hiermit stimmen auch sorgfältige
Wägungen von gleichen Längen aus der äußersten und innersten Partie desselben
Coconfadens überein, und dieser Umstand muß beim Seidehaspeln wohl berücksichtigt
werden, um durch Ergänzungsfäden eine Ausgleichung herbeizuführen, sobald mehrere
Cocons über die Hälfte abgehaspelt sind. Der Querschnitt der Coconfäden ist nicht,
wie man zu erwarten geneigt seyn möchte, rund, der Form des Ausführungsganges
entsprechend, sondern unbestimmt stumpfeckig; es platten sich nämlich die beiden
gleichzeitig hervortretenden Fasern gegen einander ab, da sie anfangs weich sind und
erst an der Luft, wahrscheinlich durch Sauerstoffaufnahme, erhärten, wie auch weiter
noch eine gegenseitige Abplattung durch die Anlagerung an den bereits vorhandenen
Theil des Gespinnstes hervorgebracht wird.
In der gehaspelten und versponnenen Seide lassen sich die zusammengehörigen
Faserpaare nur selten noch erkennen. Man wird aber offenbar in jedem Faden doppelt
so viel Fasern zählen können, als Cocons zur Bildung desselben vereinigt worden
sind. In der gefärbten Seide liefern mitunter breitgequetschte Stellen der Faser den
Beweis, daß dieselbe während der Bearbeitung erweicht gewesen ist. Es wäre
wünschenswerth für die Praxis, den Grund dieser Erweichung zu ermitteln, da ein
häufiges Vorkommen solcher breitgedrückten Stellen nothwendig die Haltbarkeit
beeinträchtigen muß.
Beim Färben wird die Faser gleichmäßig von dem gelösten Farbstoff durchdrungen, wie
man am Durchschnitt gefärbter Seide erkennt; manche Farben, z. B. einige Arten von Schwarz haften aber
auch äußerlich fest und machen dann die Faser rauh und starr. Bei der chargirten
oder Dunstseide dagegen bildet das beschwerende Pigment äußerlich eine Rinde um die
Faser herum und hieraus erklärt es sich, daß getragene oder naßgewordene Dunstseide
ein fahles Ansehen erlangt, weil dieser Farbenbeleg an vielen Stellen abgesprungen
ist.
Structur der Wolle wie der Haare
überhaupt.
In den technologischen Werken werden die Haare gewöhnlich als Röhren von Hornsubstanz
geschildert. Diese Angabe ist mindestens ungenau, in vielen Fällen sogar unrichtig,
und könnte leicht zu falschen Folgerungen Anlaß geben, die auch in der Verwendung
Fehlgriffe herbeiführen könnten. Jedenfalls wird eine genauere Darstellung des Baues
dieser Gebilde dazu beitragen, viele technisch wichtige Vorgänge richtig
aufzulösen.
Die Haare jeder Art, also auch Borsten und Wolle, entstehen in Einsackungen der Haut,
den Haarbälgen, auf deren Grunde sich ein gefäßreiches Wärzchen erhebt, von dessen
Oberfläche feine Körnchen oder Bläschen abgesondert werden, um die Grundlage des
Haares zu bilden. Nach außen geht von diesen Wärzchen eine Scheide aus, die das Haar
an seinem Grunde umschließt und gewöhnlich noch etwas über den Eingang des
Haarbalges emporragt. An ausgerissenen Haaren wird der untere Theil, unvollständig
von den Haarwärzchen abgerissen, und umgeben von der Scheide, für gewöhnlich als
Wurzel oder Zwiebel desselben bezeichnet. Das Wachsthum eines Haares geschieht durch
Erzeugung von neuen Körnchen oder Bläschen mit noch weichem Inhalte auf den
Bildungswärzchen, während die darüber liegenden emporrücken und sich auf
verschiedene Art entwickeln und zusammenfügen. Die äußersten von ihnen dehnen sich
ziemlich gleichmäßig aus, werden durch gegenseitigen Druck eckig, platten sich
tafelförmig ab, und schließen sich fest aneinander, indeß ihr Inhalt allmählich
erhärtet, um so endlich eine Rinde von Schuppen um das Haar zu bilden, deren nach
oben gerichteter Rand oft sehr merklich vorspringt, indeß die unteren Theile innig
mit den Nachbarrändern und der innerhalb liegenden Partie des Haares verschmolzen
sind. Diese Schuppen der Rindenschicht sind unter dem Mikroskop am leichtesten bei
den Wollhaaren wahrzunehmen, schwieriger bei Menschenhaaren, Pferdehaaren,
Schweinsborsten etc.
Bei den feineren Wollhaaren gestalten sich die sämmtlichen
nach innen gelegenen, vom Haarwärzchen ausgesonderten Körnchen, welche nicht zur
Rinde verwendet werden, zu feinen Fasern, die sich etwas durch einander schlingen, so
daß in diesem Fall das Haar sich als ein Strang von Fasern darstellt, umschlossen
von den Rindenschuppen. Daß der Wurzeltheil der Haare dicker ist als der obere
Theil, der Haarschaft, hängt sowohl mit diesem Auswachsen der Körnchen zu Fasern
zusammen, als auch mit der Zusammenziehung, welche durch das Festwerden seiner
Theile bedingt wird.
Bei den gröberen Wollhaaren, Schweinsborsten etc. nimmt
die Mitte des Haares eine Lage von Körnchen oder Bläschen ein, so daß die Fasern in
ihrer Gesammtheit eine Röhre bilden, welche diesen Canal umschließt. Es kommt bei
menschlichen Haupthaaren häufig vor, daß auf einzelnen Strecken desselben Haares
dieser Markcanal vorhanden ist, und abwechselnd wieder verschwindet. Bei den
ordinärsten Sorten von Schafwolle finden sich neben stärkeren Fasern mit Canal auch
sehr feine ohne Canal. Durch die Veredelung verschwinden
diese gröberen Haare gänzlich.
In Bezug auf die meisten Eigenschaften der Wolle, welche beim Sortiren in Betracht
kommen, gewährt das Mikroskop keinen besondern Aufschluß, da es hierbei auf die
Gesammtauffassung der Wollhaare in ihrer natürlichen Lage ankommt; selbst die
Feinheit läßt sich mit bloßem Auge hinlänglich genau für die Werthbestimmung
schätzen. Dagegen erhält man durch das Mikroskop sehr befriedigenden Aufschluß über
die Art der Einwirkung der Wärme auf die künstliche
Streckung und Kräuselung der Haare. Wird ein schlichtes Haar stark gespannt, so
dehnt es sich beträchtlich aus, bevor es zerreißt (ein Menschenhaar beinahe um den
dritten Theil seiner Länge) und zieht sich beim Nachlassen der Spannung fast auf die
vorige Länge zusammen. Wird es aber in ausgedehntem Zustande noch etwas über den
Siedepunkt hinaus erhitzt, so zieht es nicht wieder
zusammen, indem die Hitze ganz ebenso darauf einwirkt, wie auf Hornmasse überhaupt
unter ähnlichen Umständen. Wird nun krauses Haar oder Wolle angespannt, so werden
diejenigen Theile, welche an den gekrümmten Stellen nach innen liegen, am stärksten,
die an den Krümmungen nach außen liegenden Stellen dagegen am wenigsten oder gar
nicht ausgedehnt. Ist dieser Zustand durch Erhitzung bleibend gemacht, wie bei
gekämmter Wolle, so sieht man unter dem Mikroskop die früheren Beugungsstellen als
eben so viele Verdünnungen des nunmehr geraden Haares. Dagegen erscheinen in
entgegengesetzter Weise bei ursprünglich schlichtem Haare, das künstlich gekräuselt
ist, abweichend von natürlich krausem Haar, die gekrümmten Stellen verdickt.
Der Durchschnitt der Schafwolle ist etwas elliptisch. Die Ansicht desselben bei gefärbter Wolle
bestätigt, daß auch hier die färbende Substanz in der ganzen
Masse vertheilt, nicht etwa an der Oberfläche oder zwischen den Fasern
niedergeschlagen ist, genau so, wie dieß mit der Seide, wie auch mit den
vegetabilischen Faserstoffen der Fall ist. Indem die organische Substanz die
färbenden Stoffe in sich aufnimmt, verhindert sie die Aussonderung von
Niederschlägen, selbst bei solchen Färbemitteln, die im Wasser sich fällen, also
nach einander von dem zu färbenden Körper aufgenommen werden müssen.
Mit der Schafwolle stimmen im Baue die Flaumhaare der Cachmirziege, die Wolle der
Lamas und andere überein. Den bisher betrachteten Bau zeigen außer den bereits
erwähnten die meisten der zu Pelzwerk benutzten Haare. Von ganz abweichendem Bau
dagegen sind die Haare der Nagethiere, mit denen unter andern die der Reharten
übereinstimmen. Wegen der wichtigen technischen Verwendung soll der Bau der
Hasenhaare besonders berücksichtigt werden.
Bei den Hasenhaaren sind die Rindenzellen besonders innig
mit der darunter liegenden Partie des Haares und unter einander verschmolzen, jedoch
durch die hervorragenden oberen Ränder auch ohne weitere Behandlung noch deutlich zu
erkennen. In concentrirter Schwefelsäure quellen diese Rindenzellen etwas auf, lösen
sich von den darunter liegenden Theilen und von einander ab, und sind dann deutlich
als eine ziemlich dicke Schicht übereinander liegender Schuppen zu erkennen. Der
innere Theil des Haares aber zeigt keine Fasern, sondern größere, dickwandige Zellen
einzeln übereinander oder zu mehreren nebeneinander. Die dünnen oder Flaumhaare
bestehen im Innern nur aus einer Reihe übereinander liegender Zellen. Bei den
stärkeren Haaren, z. B. den Deckhaaren, zeigt der Schaft, den verschiedenen Perioden
seines Wachsthums entsprechend, sich in seiner Länge sehr verschieden. Die Spitze
enthält hier eine Reihe Zellen, die allmählich stärker werden; dann treten zwei
Zellen neben einander und das Haar wird länglich im Durchschnitte. Allmählich
vermehrt sich die Zahl der Zellen bis auf 12 und das Haar wird noch breiter; der
dann folgende Theil wird wiederum rund und die Zahl der Zellen nimmt wieder ab, bis
die Wurzel endlich nur noch Fasern enthält. Der Wechsel der Haare geschieht hier wie
allenthalben wo er stattfindet, dadurch, daß neben dem alten, unthätig werdenden und
vertrocknenden Haarwärzchen ein neues am Grunde des Haarbalges entsteht, welches
beim Ausfallen des abgestorbenen Haares bereits die Spitze des neuen gebildet
hat.
Die Einwirkung des Beizens der Hasenhaare beruht
keineswegs darauf, daß in Folge desselben die Hervorragungen der oberen Schuppenränder etwas stärker
hervortreten, wodurch die Haare rauher und geeigneter würden aneinander zu haften.
Vielmehr bleibt die Form durchaus unverändert; es wird
aber durch die Einwirkung des Beizmittels die Elasticität der Haarsubstanz
beträchtlich vermindert, so daß die Haare sich ohne Widerstand um einander schlingen
und zwischen einander durchschieben lassen. Bei Versuchen zur Ermittelung eines
zweckmäßigen Beizverfahrens wäre die mikroskopische Prüfung besonders anzurathen, da
aus der ungleichen Färbung, welche der auf gewöhnliche Weise gebeizte Filz zeigt,
entschieden hervorgeht, daß die Einwirkung sehr ungleichmäßig stattgefunden hat.
Structur der technisch wichtigen
Pflanzenfasern.
Der Pflanzenkörper zeigt einen höchst einfachen Bau, dessen sämmtliche Bestandtheile
sich auf ein Grundgebilde zurückführen lassen, die Pflanzenzelle. Bei ihrer
Entstehung zeigt sich die Zelle als ein Bläschen mit flüssigem Inhalte und
gleichförmiger Wandung, welches durch diese hindurch seine Nahrung aufnimmt, die das
Material zum Wachsthum der Zellenwandung und zur Entstehung neuer Zellen innerhalb
der noch in Entwickelung begriffenen abgibt. Die Wandungen einer Zelle, innerhalb
welcher solche Neubildungen vor sich gehen, einer Mutterzelle, werden demnächst
wieder aufgelöst, so daß der fertige Pflanzenkörper nur aus nebeneinander liegenden
Zellen besteht. Aus dem flüssigen Zelleninhalte geschieht endlich bei den bleibenden
Zellen die Ablagerung von Verdickungsschichten auf der Innenseite ihrer Wandungen
und die Gestaltung des verschiedenartig körnigen Inhalts, der sich in denselben
findet, wozu namentlich das Pflanzengrün und die Stärke gehört.
Durch gegenseitigen Druck werden die anfangs rundlichen Zellenwandungen eckig; an
manchen Stellen nehmen sie eine lang gestreckte, röhrenförmige Gestalt an, und
werden dann Gefäße genannt. So ergeben sich die sogenannten Adern der Blätter bei
der mikroskopischen Untersuchung als Stränge von lang gestreckten, dickwandigen
Zellen mit zugespitzten Enden, welche einige röhrenförmige Zellen von beträchtlich
größerm Innenraum mit verschiedenartigen Ablagerungen auf ihren Wandungen zwischen
sich schließen; solche Stränge von lang gestreckten Zellen und Gefäßen, welche
letztere im ausgebildeten Zustande Luft enthalten, führen den Namen Gefäßbündel.
Dadurch daß sich an die größeren, zuerst entstandenen Gefäßbündel die kleineren mit
ihren Enden innig anlegen, entsteht die anscheinende Verästelung der Gefäßbündel
eines Blattes.
Bei den Pflanzen mit einem Keimblatte, den
Monokotyledonen, durchziehen in ähnlicher Weise einzelne Gefäßbündel die Masse des
Stengels, welche im Uebrigen aus Zellen besteht, die nach allen Richtungen ziemlich
gleichmäßig ausgedehnt sind. Zu dieser Abtheilung gehören unter andern die Palmen,
die Pisangarten, die lilienartigen Gewächse und die Gräser. Zur technischen
Benutzung kommen besonders die Gefäßbündel aus dem Stengel einer Pisangart, Musa textilis, welche unter dem Namen Manilla-Hanf zu Seilen und Geweben verarbeitet
werden, und die Gefäßbündel aus den Blättern des sogenannten neuseeländischen Flachses, Phormium tenax.
Diese Gefäßbündel werden auf ähnliche Weise gewonnen, wie bei uns die Leinenfasern,
indem man durch beginnende Fäulniß (Röstung) die Sonderung einleitet. Man erhält
dabei die einzelnen Fasern, welche ein solches Gefäßbündel bilden, noch in ihrem
natürlichen Zusammenhange, so daß sie schon ohne Verspinnung verwebbare Fäden
abgeben, die sich durch große Zähigkeit und durch ihren Glanz auszeichnen. Es
lockert sich jedoch der Zusammenhang zwischen diesen an sich ziemlich kurzen Fasern
während der Benutzung, so daß hier die Haltbarkeit viel geringer ist, als bei Zeugen
und Stricken aus Leinen oder Hanf, wo die einzelnen Fasern von vornherein durch die
Zurichtung gesondert und demnächst, bei sehr beträchtlicher Länge, noch
gegeneinander gedreht werden.
Dagegen geben die Fasern dieser Gewächse, sowie die Fasern aus den Halmen unserer
Getreide- und Rohrarten, eine sehr gute Papiermasse ab, wie auch ein großer
Theil des schönen chinesischen Papiers aus den Fasern des Bambusrohrs bereitet
wird.
Bei den Pflanzen mit zwei Keimblättern, den Dikotyledonen,
wozu die Leinpflanze gehört, herrscht eine größere Mannichfaltigkeit des Baues. Der
Durchschnitt eines jungen Stengels zeigt anfänglich durchaus gleichartige Zellen; im
Verlaufe seines Wachsthums aber bildet sich demnächst ein Gürtel von kreisförmig
gestellten Gefäßbündeln, welche die Grundlage des Holzkörpers abgeben und durch deren Auftreten zugleich der nach innen
gelegene Theil als Mark, und der nach außen gelegene Theil des Stengels als Rinde abgesondert wird. Die im wesentlichen Baue mit den
Markzellen übereinstimmenden Zellenlagen, welche die Gefäßbündel des Holzkörpers von
einander trennen, heißen Markstrahlen. In der Rinde
entstehen gleichfalls Bündel von langgestreckten Zellen, die aber keine Gefäße
zwischen sich schließen, die Bastzellen. Auf der Gränze
zwischen Holz und Rinde findet sich eine Schicht zarter, dünnwandiger Zellen, in
welcher, so lange überhaupt das Wachsthum des Stengels dauert, die Vermehrung seiner
Zellen vorzugsweise
stattfindet. Es bilden nämlich die innersten Zellen dieser Schicht endlich lang
gestreckte Zellen und Gefäße zum Anschluß an den Holzkörper aus, die äußersten aber
dienen zur Verstärkung der Rindenschicht, während der mittlere Theil sich zum
Ersatze des so erlittenen Abganges durch Bildung neuer Zellen verstärkt. Wegen
dieses Verhaltens führt die geschilderte Zellenlage den Namen Cambium oder Bildungsschicht.
Bei den einjährigen Gewächsen hört die Thätigkeit der Bildungsschicht bald nach dem
Abblühen auf, bei den Bäumen und Sträuchern rückt sie aber während der ganzen
Lebensdauer fortwährend nach außen. Ihre Wirksamkeit zur Hervorbringung neuer Zellen
ist im Frühling am lebhaftesten; dann läßt sich die Rinde der Bäume lösen, indem die
zarten Zellen des Cambiums zerrissen werden; sie vermindert sich gegen den Herbst
hin, um im Winter gänzlich stille zu stehen. Durch die Verschiedenheit in dem
Aussehen der stärker gefärbten Schlußschicht eines jeden Jahres und den größern
Reichthum an Gefäßen in der Frühlingsschicht werden die Jahresringe im Holze unserer Bäume gebildet. Die einzelnen Abtheilungen
des Holzkörpers, welche zwischen zwei Markstrahlen liegen, nehmen mit dem Vorrücken
des Cambiums nach außen keilförmig zu; nachdem sie eine gewisse Ausdehnung erreicht
haben, werden sie durch das Auftreten neuer Markstrahlen getheilt. Zur
Unterscheidung von der ursprünglich entstandenen, bis ans Mark hinanreichenden,
werden diese Markstrahlen, deren Zahl mit der Verdickung des Holzkörpers zunimmt,
kleine Markstrahlen genannt.
Die Bastbündel verlaufen häufig ohne Verbindung untereinander, zwischen den übrigen
Zellen der Rinde senkrecht emporsteigend. So besonders bei den einjährigen Pflanzen
und bei solchen Bäumen und Sträuchern, welche die ganze Rinde jährlich abwerfen, z.
B. bei der Weinrebe. Da aber, wo die Rinde und somit auch die Bastbündel längern
Bestand haben, treten die in derselben Rindenschicht gelegenen Bastbündel
abwechselnd aneinander und wieder auseinander, und bilden so ein Maschenwerk, dessen
Theile durch ihre Ausdehnung der Verdickung des Stammes folgen können, während die
zwischenliegenden Rindenzellen sich in entsprechendem Maaße vermehren. Es werden in
einem Jahre bei vielen Bäumen mehrere Bastschichten gebildet, deren Faserbündel
jedoch nicht mit denen der benachbarten Schichten in Verbindung treten, sondern ein
in sich zusammenhängendes Netzwerk bilden.
Der Bast wird bekanntlich dadurch für technische Zwecke gewonnen, daß man die übrigen
Zellen der Rinde durch Fäulniß zerstören laßt. Der Bast der Stämme und mehrjährigen
Zweige vieler Bäume
dient zu gröberen Geflechten; der Bast mancher einjährigen Zweige kann nach Art der
Leinenfasern zu Gespinnst verwendet werden und wird, namentlich der vom
Papiermaulbeerbaum bei den Chinesen zu Papier verarbeitet. Die Bastfasern zeigen
sich auf dem Querschnitte durch gegenseitige Pressung eckig, mit sehr starken, aus
mehreren Schichten bestehenden Wandungen und sehr kleiner Höhlung. Ihre Enden sind
zugespitzt, so daß sie in der Form mit den langgestreckten Holzzellen
übereinstimmen, die aber an Länge bedeutend von ihnen übertroffen werden.
Leinen und Baumwolle.
An einem der Reife nahen Leinstengel findet man in der
Mitte die Reste des Markes, um dieses den Holzkörper mit den Markstrahlen, und
darüber das Cambium, welches zu dieser Zeit bereits seine Thätigkeit, neue Zellen
hervorzubringen, eingestellt hat. In der Rinde bemerkt man die Gruppen der
Bastzellen und die mit Pflanzengrün erfüllten Zellen der äußern Rindenschicht,
welche von den Zellen der Oberhaut eingeschlossen werden. Die Bastfasern bilden
Gruppen, die inselartig von den übrigen Zellen der Rinde eingeschlossen werden und
deren einzelne Zellen während des Wachsthums des Stengels sich beträchtlich
ausdehnen. Die Verdickung geschieht durch wiederholte Ablagerung von Schichten nach
innen.
Bei dem gewöhnlichen Verfahren der Flachs- und Hanfbereitung walten zwei
Mißstände ob, deren nachtheilige Wirkung die mikroskopische Prüfung in ihrem ganzen
Umfange übersehen läßt. Durch das Rösten werden die
Zellen des Cambiums fast gänzlich zerstört, sowie auch der Zusammenhang der grünen
Rindenschicht sehr vermindert; bei unvorsichtiger Behandlung leidet auch die
Festigkeit der Bastfaser durch die Fäulniß. Nächstdem wird hierdurch auch das
Pflanzengrün in eine bräunliche Masse umgewandelt, die sich zum Theil auflöst und
die ursprünglich fast ungefärbten Bastfasern mit einem sehr festhaftenden Farbstoffe
durchdringt.
Nur der außerordentlichen Festigkeit und Zähigkeit der Bastfaser ist es zu verdanken,
daß sie der rohen Behandlung beim Brechen überhaupt noch
widerstehen kann. Trotz ihrer großen Elasticität wird sie hierdurch bleibend bis auf
ihre doppelte Breite flachgedrückt. Wie sehr durch diese gewaltsame Quetschung die
Haltbarkeit beeinträchtigt seyn muß, ist einleuchtend. Bei einem jeden Schlage den
das Brechinstrument ertheilt, erleidet ein beträchtlicher Theil der Fasern eines
jeden Stengels die beschriebene Einwirkung, wonach sich der Gesammtverlust an Haltbarkeit, der
durch das Brechen herbeigeführt wird, ungefähr überschlagen läßt.
Gegenüber der gewöhnlichen Wasser- oder Thauröste ist mit dem günstigsten
Erfolge das in England und Frankreich patentirte Verfahren der Behandlung mit
verdünnter Schwefelsäure (½ Proc. beim Hanf, ¼ Proc. beim Lein)
belohnt worden, das in seinen Resultaten große Sicherheit gewährt, in 48 Stunden
beendigt ist, an keine Jahreszeit gebunden ist und keinen nachtheiligen Einfluß auf
die Gesundheit ausübt. Hiemit ließe sich vielleicht noch vor der Aussonderung der
Bastfasern ein von Elsner vorgeschlagenes Mittel zum
Bleichen des Flachses in Verbindung bringen, nämlich die Benutzung einer sehr
verdünnten Lösung von unterchlorigsaurem Natron (Eau de
Javelle). Diese Bleichung ist bei dem auf gewöhnliche Weise gesonderten
Flachse in einigen Tagen beendigt und fällt ganz vorzüglich aus, ist aber mit dem
Uebelstande verbunden, daß die eingetauchten Fasern sich leicht in einander
verschlingen, was natürlich bei der hier vorgeschlagenen Anwendung nicht eintreten
könnte.
Ein geeigneteres Verfahren als das Brechen würde vielleicht das Zerquetschen der
Stengel in feuchtem Zustande gewähren, welchem die Sonderung des Bastes nach dem
Trocknen folgen könnte, worüber natürlich nur Versuche im Großen entscheiden
können.
Mit der Lein- und Hanffaser stimmen im wesentlichen die Fasern der
Nesselarten, sowie die des Bastes überhaupt in ihrem Baue überein.
Von ganz abweichendem Ursprünge ist die gegenwärtig am meisten benutzte
Pflanzenfaser, die Baumwolle. Die Baumwollenpflanze
gehört zu den malvenartigen Gewächsen mit Kapselfrucht. Ein großer Theil der Zellen
der äußern Samenhaut erhebt sich einige Zeit nach der Befruchtung in Wärzchen, die
allmählich zu langen Haaren auswachsen, welche bei der Reife die Abtheilungen der
dreifächerigen Kapsel gedrängt erfüllen, und beim Aufspringen der Fächer daraus
hervorquellen. Die Wandungen dieser Haare sind weit dünner als die der Bastfasern,
auch werden sie von diesen weit an Länge übertroffen. Nur im noch unreifen feuchten
Zustande zeigen sich die Baumwollenhaare rund; indem später ihr Inhalt austrocknet,
fallen sie zusammen und bilden nun breite Bänder, die sich sehr leicht
schraubenförmig um ihre Achse drehen. Die eigenthümliche Einwirkung der baumwollenen
Zeuge auf unsere Haut ist wohl mehr ihrer stärkern Wärmeleitung und ihrer im
Vergleich zur Flachsfaser sehr beträchtlichen Dünnwandigkeit zuzuschreiben, als
einem mechanischen Reize ihrer Kanten, da deren Form auf dem Querschnitte eine
solche Annahme nicht rechtfertigt. Hiefür spricht auch die bewährte Erfahrung, daß lose Baumwolle
sich mit günstigstem Erfolge anstatt der Charpie aus Leinwand zum Verbinden anwenden
läßt.
Abnutzung der Faserstoffe.
Mit der dargelegten Structur der Faserstoffe hängt aufs innigste die Art zusammen,
wie sich dieselben bei der Abnutzung verhalten. Ein gleichmäßiges Abschleifen findet
nur an den in gleicher Richtung nach außen gekehrten Spitzen der Fasern statt, was
sich namentlich bei Tuchen, beim Sammet und Manchester leicht beobachten läßt. Die
durch das Scheren scharfkantig abgestutzten Enden erhalten hier allmählich in
ähnlicher Weise eine Abrundung und Zuspitzung, wie die Drahtenden bei der
Nadelfabrication durch Schleifen. Von den sämmtlichen Fasern dagegen, welche die
Fäden eines Gewebes bilden, sind diejenigen welche entweder besonders nach außen
oder an den Kreuzungen liegen, der Abreibung am meisten ausgesetzt. Die
mikroskopische Beobachtung zeigt, daß so bald hiedurch erst eine Stelle an der
Oberfläche einer Faser angegriffen ist, sehr bald auch die gänzliche Zerstörung
erfolgt, während die zwischen zwei derartigen Stellen gelegenen Theile der Faser
anscheinend unversehrt bleiben. Die abgebrochenen Faserstücke welche im Gewebe
keinen Halt mehr finden, müssen endlich im Verlauf der Abnutzung als Staub abfallen.
Nach dem verschiedenen Baue zeigt das Zerfallen der Fasern in Stücke Besonderheiten,
deren Kenntniß bei der Frage, inwieweit die Mischung verschiedenartiger Fasern
rathsam wäre, von Wichtigkeit ist.
Sobald bei der Wolle ein Stück der Rinde abgerieben ist,
ist auch gewissermaßen die Bildung eines Gelenkes an dieser Stelle eingeleitet,
indem jeder Stoß der die Faser trifft, hier eine Unterbrechung in der Fortleitung
erfährt, wodurch eine vermehrte Reibung an dieser Stelle veranlaßt wird. Allmählich
kommt so eine Auflockerung der ineinander geschobenen Elementarfasern zuwege, die
endlich ihren Zusammenhang aufgeben müssen, so daß nach der Trennung die beiden
einander zugekehrten Seiten der Bruchstelle ein pinselförmiges Ansehen zeigen.
Bei den Leinenfasern ist an den Querwänden und an den beim
Brechen gequetschten Stellen die Anlage zu dergleichen gliederartigen Ablösungen von
vornherein vorhanden, und demgemäß finden wir häufig an einer abgenutzten
Leinenfaser eine Reihe solcher Stellen gleichmäßig eingeknickt. Während der
beträchtlichen Zeit aber, in welcher die Faser diesem allmählichen Zerbrechen
Widerstand bietet, spalten sich die naheliegenden Stellen ihrer Wandungen vielfach
der Länge nach, so daß an den abgebrochenen Stücken die Enden sich in eine große
Menge feiner Längsfasern aufgelöst haben. Dieses Zerfallen der Wandungen in
Theilfasern steht übrigens nicht, wie bei der Wolle, in Beziehung mit der
ursprünglichen Bildung, sondern ist lediglich als Folge der mechanischen
Einwirkungen zu betrachten, welche die Faser während ihrer Abnutzung erfährt.
Bei der Baumwolle sind es, wie man erwarten konnte,
vorzugsweise die Windungsstellen der Fasern, welche zunächst durch die Reibung
angegriffen werden, worauf entweder sofort Zerreißung eintritt, oder in ähnlicher
Weise wie bei der Leinenfaser, noch eine Zerspaltung in viele Theilfasern vor dem
gänzlichen Zerreißen stattfindet.
Bei der Seide möchte man wegen der durchgängigen
Gleichartigkeit ihrer Substanz besonders geneigt seyn, ein allmähliches Dünnwerden
der Fasern ihrer ganzen Erstreckung nach zu erwarten. Es sind indessen hier, wie bei
allen Geweben, einzelne Stellen schon durch Lage und Drehung vorzugsweise dem
Angriff durch Abnutzung ausgesetzt, worauf dann die einmal getroffenen Stellen aus
den bereits bei der Wolle erörterten Gründen entweder ohne bemerklichen Einfluß auf
die benachbarten Theile der Faser vollständig durchgerieben werden, oder auch vor
der völligen Zerreißung eine Langsspaltung eintritt, die jedoch selten in mehrfacher
Zahl zu beobachten ist. Da die Abnutzung an den besonders ausgesetzten Stellen viel
schneller vorschreitet, als anderweitig, so ergibt sich, daß ein bereits
abgetragenes Kleidungsstück noch eine große Menge fast unversehrter Fasern enthalten
muß, weßhalb die Versuche, Lumpen in ihre Fäden aufzulösen, diese dann aufzukratzen,
zu verspinnen und zu weben, nicht ungünstig ausgefallen sind. Es zeigen indessen die
Fasern von dergleichen Geweben vielfach die Eigenthümlichkeiten der abgenutzten
Fasern, obgleich die meisten angegriffenen Stellen schon bei der Verarbeitung
herausfallen.
Wenn das Sortiren mit großer Sorgfalt geschehen ist, so ist eine Täuschung durch
dergleichen Stoffe für die Prüfung ohne Unterstützung des Mikroskops sehr schwierig.
Da die Auflösung der Gewebe zum Zweck der Wiederverspinnung viel Handarbeit in
Anspruch nimmt, so ist sie mit allerdings nur kärglichem Erfolge bei allgemeinem
Nothstande verarmter Webergegenden in Anwendung gekommen.
Mikroskopische Prüfung gemischter
Gespinnste und Gewebe.
Die charakteristischen Eigenthümlichkeiten im Baue der verschiedenen Faserstoffe
machen es möglich, daß man mit Hülfe des Mikroskopes jede Vermischung, möge sie im
Gespinnste oder Gewebe vor sich gegangen seyn, mit Leichtigkeit und was die
Hauptsache ist, mit juridischer Beweisfähigkeit auffinden und nachweisen kann. Es
bedarf nur der Untersuchung ganz kurzer Fadenabschnitte, um mit Entschiedenheit über
das Material eines solchen Stoffes urtheilen zu können. Daß die Mischungen im
Gespinnste, welche für das bloße Auge die größten Schwierigkeiten darbieten, bei der
mikroskopischen Prüfung sich am leichtesten enthüllen, da hier die erste
Untersuchung schon zum Resultate führt, braucht wohl kaum besonders hervorgehoben zu
werden, wohl aber, daß bei gefärbten Stoffen selbst die vollste Uebereinstimmung
sämmtlicher Fasern eines Fadens in der Farbennüance keineswegs volle Sicherheit über
die Gleichförmigkeit des Stoffes gewährt, da man für die Herstellung von dergleichen
Mischgespinnsten, namentlich aus Wolle und Baumwolle, selbst die Mühe nicht gescheut
hat, beide Stoffe erst im losen Zustande zu färben und dann zu vermischen.
Da übrigens in vielen Fallen durch die Mischung das äußere Ansehen der Gewebe nicht
beeinträchtigt wird, und da bei vielen Stoffen eine besondere Dauerhaftigkeit nicht
erlangt wird, so werden gemischte Stoffe immer eine wichtige Rolle in der Manufactur
spielen. Daß dabei die Möglichkeit einer Täuschung über das Material eines Gewebes
obwaltet, muß andererseits zu sorgfältiger Prüfung auffordern, bei welcher immer das
Mikroskop die letzte und sicherste Entscheidung geben wird. Die meisten
Schwierigkeiten für anderweite Prüfung bietet die am weitesten verbreitete, tief in
den Verkehr eingreifende Vermischung der Leinen- und Baumwollfasern, entweder
im Gewebe oder, wie es in neuester Zeit mit Erfolg versucht worden ist, im
Gespinnste dar, deren Nachtheil darauf beruht, daß durch die viel früher erfolgende
Abnutzung der Baumwollfasern, der Zusammenhang des Gewebes aufgelöst wird, während
die Leinenfasern desselben noch fast unversehrt sind.
Da vor einer unbefangenen Beurtheilung keines der andern, bis jetzt in Vorschlag
gebrachten Unterscheidungsmittel als genügend gelten kann, so fragt es sich, in
welcher Weise die untrügliche Entscheidung durch das Mikroskop hierfür gemeinnützig
gemacht werden könne. Trotz aller Unannehmlichkeiten, welche die obwaltende
Unsicherheit mit sich führt, würde doch eine amtliche Beglaubigung, etwa durch einen
aufgedruckten Stempel,
wie es in früheren Zeiten von den Schauämtern geschah, gegenwärtig schon wegen ihres
präventiven Charakters keine Billigung finden. Dagegen läßt sich von jedem Verkäufer
mit Recht verlangen, daß er die Gewährleistung für seine Waare übernehme. Diese wird
dann auch mit der größten Bereitwilligkeit mündlich gegeben, aber sie ist
meistentheils illusorisch, da sie gewöhnlich später nicht bewiesen werden kann, da
es sogar Schwierigkeiten hat, die Identität der in Frage stehenden Waare
nachzuweisen.
Vollständige Beweiskraft dagegen würde bei jedem Streite über die ausbedungene
Qualität einer Waare eine schriftliche Verkaufsbescheinigung gewähren, wenn sie sich
untrennbar mit der Waare verbinden ließe. Bei Geweben nun, und so besonders bei
Leinenwaaren, läßt sich ein solcher Garantieschein sehr leicht aufkleben und am
füglichsten durch einen zwischengelegten Oblatenstempel vor etwaiger Vertauschung
schützen. Es würde nur der Einführung dieser Art von Garantie-Uebernahme
durch einige solide Handlungen bedürfen, um bei den Käufern überall das Verlangen
darnach hervorzurufen. Ein solches Certificat, welches die Angabe der Ellenzahl und
des Verkaufspreises enthalten müßte, würde dann, nebst der damit verbundenen
Zeugprobe, sowohl das Material für die mikroskopische Prüfung durch Sachverständige
abgeben, als auch zur Feststellung über den Umfang des etwa stattgehabten Betruges
dienen.
Es unterliegt keinem Zweifel, daß die vorgeschlagene Beweisführung schon bei dem
vorhandenen Gerichtsverfahren den Gang der Untersuchung sehr erleichtern würde; bei
der bevorstehenden Einrichtung von Handelsgerichten aber möchte sich der Gang des
Verfahrens so weit vereinfachen lassen, daß es bloß einer schriftlichen Anzeige
nebst Einreichung der Beweisprobe bedürfte, um Erledigung zu finden. Es versteht
sich von selbst, daß zur Vermeidung unbegründeter Denunciationen jedenfalls die
Untersuchungsgebühren, die sehr gering ausfallen würden, zu deponiren wären.
Mikroskopische Grundlagen zur Theorie
des Färbens.
Die Frage auf welche Weise sich die Farbstoffe mit den zu färbenden Fasern
vereinigen, hat die Bildung verschiedener Theorien veranlaßt, die jedoch sämmtlich
ohne hinlängliche Berücksichtigung des mikroskopischen Baues aufgestellt sind. Eine
umfassende Zusammenstellung derselben findet sich in dem bekannten Werke von Persoz über die Zeugdruckerei.
Die frühesten erwähnenswerthen Vermuthungen über die Art der in Rede stehenden Vereinigung
sind von Hellot und Le Pileur
d'Apligny. Der erstere stellt namentlich über Wolle die Ansicht auf, es
fänden sich in den Fasern Poren, fähig sich zu erweitern und zu verengern, von
welchen die Atome des Farbestoffes aufgenommen würden. Bei der Vorbereitung fürs
Farben käme es darauf an diese Poren zu erweitern, damit sie die Farbepartikeln
aufnehmen könnten, und diese dann durch Verkittung festzuhalten, welches letztere
die Beizmittel bewerkstelligten. Die unächten Farben dringen nach ihm nicht in die
Poren ein, oder werden von denselben nicht festgehalten. Le
Pileur d'Apligny trägt diese Theorie auch auf die übrigen Faserstoffe über.
Er hält die Wolle, wie die Haare, für Röhren, deren Wandungen eine große Menge von
Oeffnungen enthalten, und die im Innern mit einer markartigen Substanz erfüllt sind.
Diese wird zunächst daraus entfernt, um dann dem Farbstoffe Raum zu geben. Aus dem
abweichenden Bau und der Verschiedenheit der Zahl und Größe der Poren wird das
verschiedene Verhalten der Fasern gegen die Farbstoffe erklärt.
Macquer schließt daraus, daß die Seide mehr als die
doppelte Quantität Cochenille erfordert, um mit Wolle auf eine gleiche Stufe der
Intensität gebracht zu werden, daß ein Theil des Farbstoffes durch chemische
Verwandtschaft sowohl als durch Adhäsion sich auf der Oberfläche der Fasern
niederschlüge und allein den Effect hervorbrächte, während der Antheil welchen die
Poren aufnehmen, ohne Wirkung bliebe. Diesen Erklärungen gegenüber, welche sich auf
Voraussetzungen über die Structur der Fasern stützen, stehen andere, welche das
verschiedene Verhalten desselben Farbstoffes gegen die Faserstoffe allein aus der
chemischen Verwandtschaft herleiten wollen. So Bergmann
und Chevreul.
Zu diesen älteren Ansichten ist durch Walter Crum eine
neue Theorie hinzugekommen, welche die Aufnahme der Farbstoffe durch die Fasern mit
der von Saussüre entdeckten Thatsache in Beziehung setzt,
daß durch die Kohle Gasarten verdichtet und Flüssigkeiten entfärbt werden. Während
Hellot seine Theorie auf den hypothetischen Bau der
Wolle allein gründet, bezieht sich Walter Crum ausschließlich auf die Structur der Baumwolle, die
er nach Anleitung der mikroskopischen Darstellungen von Thomson und Bauer in gefärbtem und ungefärbtem
Zustande untersucht hat. Er schließt daraus daß die Röhren, welche die
Baumwollfasern bilden, dem Wasser Eintritt gestatten, auf die Existenz von Poren,
obgleich man diese unter dem Mikroskop auch bei der stärksten Vergrößerung nicht
sehen könne. In das Innere dieser Röhren drängen nun nach einander durch die Poren
der Wandungen, und ohne
diese selbst irgend zu afficiren, die verschiedenen Substanzen ein, welche durch
ihre Verbindung die Farbe bildeten, um sich auf der Innenwand der Röhre
niederzuschlagen, wobei der Farbstoff durch die Wandung hindurch schiene. Zur
Unterstützung wird auf die Farbe der Pflanzen Bezug genommen, wo namentlich die
anscheinend gleichförmige grüne Farbe der Blätter durch die grünen Körnchen im
Innern der Zellen zu Stande gebracht wird, welche durch die farblosen Wandungen
hindurch schimmern.
Persoz dagegen sucht wahrscheinlich zu machen, daß die
Farbstoffe auf der Oberfläche der Fasern niedergeschlagen würden, und daß die
abweichenden Farbennüancen, welche die verschiedenen Faserstoffe bei Behandlung mit
denselben Färbemitteln geben, von der Verschiedenheit ihrer Oberfläche herrühre.
Eine ähnliche Ansicht wird auch von Liebig aufgestellt,
welcher wörtlich folgendes sagt: „Der Indigo schlägt sich auf der
Oberfläche der Wollenfasern nieder, ohne sich chemisch mit denselben zu
verbinden; durch anhaltendes Klopfen im trocknen Zustande wird das Tuch oder die
Wolle wieder weiß, indem die Farbe staubartig abfliegt.“ Für die
Wiederholung dieses etwas zweifelhaften Experiments dürfte man schwerlich in
jetziger Zeit ein ausreichend haltbares Tuch finden.
Die richtige Benutzung des Mikroskopes zeigt eine Sachlage, die in den vorliegenden
Hypothesen nicht vorausgesetzt ist. So lange man die gefärbten Fasern ohne weiteres
unter dem Mikroskop ansieht, läßt sich das eigentliche Verhalten nicht mit voller
Bestimmtheit nachweisen. So zeigt sich namentlich im Innern der Baumwollfasern oft
ein reichlicher Niederschlag in der von Walter Crum
beschriebenen Weise. Aber daraus erhellt noch nicht, daß die Wandung selbst
ungefärbt ist. Andererseits wieder würde man einen dünnen Ueberzug, welcher der
ganzen Oberfläche innig anläge, gar nicht von dieser selbst unterscheiden können.
Alle Zweifel aber verschwinden, wenn man, wie bereits erwähnt, feine Querschnitte
gefärbter Fasern herstellt und diese der mikroskopischen Prüfung unterwirft. Man
steht dann, daß die ganze solide Substanz der Fasern gleichmäßig gefärbt ist. Die
selbst bei der Baumwolle verhältnißmäßig beträchtliche Stärke der Wandung läßt
darüber auch bei dieser keinen Zweifel übrig. Daß indessen, namentlich bei
türkischrother Baumwolle, die äußerste Schicht der Wandungen mitunter eine größere
Intensität in der Färbung zeigt, ist nicht in Abrede zu stellen, wogegen bei Wolle
und Seide die ganze Fläche des Querschnittes die größte Gleichförmigkeit zeigt.
Es ist somit den fernerhin aufzustellenden Theorien über die Färberei durch
Feststellung dieser durchgängigen Thatsache, von der man sich auf dem angegebenen Wege leicht
überzeugen kann, wenigstens ein sicherer Ausgangspunkt gegeben. Eine Ausscheidung
von Farbenpartikeln, die etwa durch die ganze organische Substanz vertheilt wären,
ist hier ebensowenig, selbst nicht bei den stärksten Vergrößerungen wahrzunehmen,
wie die Kalksalze in der organischen Grundlage der Knochen sich gesondert erkennen
lassen, oder die Kieselsäure in den Zellenwandungen des Schachtelhalms und der
Gräser. Wenn man daher nicht eine chemische Verbindung der Farbstoffe mit der
Substanz der Fasern annehmen will, so ist man genöthigt vorauszusetzen, daß die
ausgesonderten Partikeln so klein und so gleichmäßig vertheilt sind, daß sie selbst
der stärksten Vergrößerung sich noch entziehen.
Erklärung der Abbildungen.
18. Gespinnstlage aus einem Cocon. Man sieht die sich vielfachkreuzenden Doppelfäden
vom Baste umgeben. Vergrößerung 250fach.
19. Querschnitt des Gespinnstes. Die meisten Fasern sind senkrecht durchschnitten,
einige liegen in der Richtung des Schnittes. Der Bast bildet eine ziemlich
gleichmäßige Schicht, welche die Fasern umgibt. Vergrößerung 400fach.
20. Dunstseide. Die Farbe ist an einigen Stellen abgesprungen, so daß man die
entblößte Faser sieht. Vergrößerung 400.
21. Grobe Schafwolle. Das Haar bei 2 mit einem Canal. 4–10 Rindenschuppen
bilden den Umkreis. Vergrößerung 400.
22 Electoralwolle. Gewöhnlich nur 2 Schuppen auf einem Durchschnitte. Vergrößerung
400.
23. Kammwolle. An zwei Stellen bei a, a in Folge der
Streckung dünner geworden. Vergrößerung 400.
24. Schafwolle im Querschnitt. Die dunkeln Stellen entsprechenden Lücken, welche die
nicht überall mit einander verschmolzenen Fasern zwischen sich gelassen haben.
Vergrößerung 400.
25. Hasenhaar. Seitenansicht. a Stück aus dem mittlern
Theile eines großen Deckhaares; b Theil eines
Flaumhaares. Vergrößerung 400fach.
26. Hasenhaar. Querschnitt a, Flaumhaar oder Spitze eines
Deckhaares; b breiter Theil vom Schafte eines
Deckhaares; c aus dem verdickten Theile vom Schafte
eines Deckhaares. Vergrößerung 400.
27. Hutfilz von Hasenhaar, auseinandergezogen. Vergrößerung 120.
28. Zugerichtete Flachsfaser. a Spitze; b aus der Mitte, zeigt besonders die Querwände; c aus der Mitte mit einer beim Brechen brcit
gequetschten Stelle. Vergrößerung 400.
29. Querschnitt einiger Bastzellen der Leinpflanze. Vergrößerung 600fach.
30. Baumwollenfasern. Vergrößerung 400.
31. Deßgl. Querschnitt. Vergrößerung 400.
Tafeln