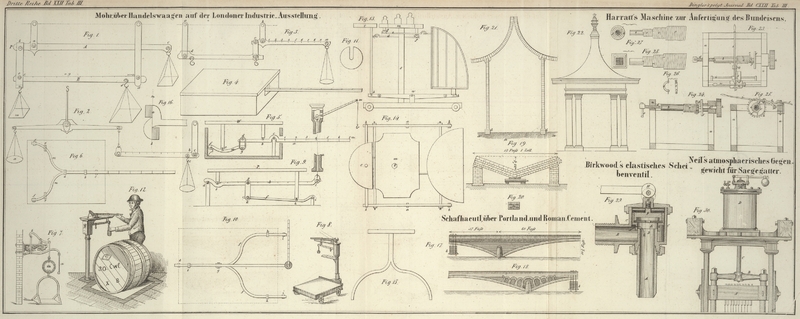| Titel: | Das Portland- und Roman-Cement. Ein Beitrag zur Geschichte der Cemente oder hydraulischen Mörtel in England, nebst einem Anhange über die Theorie der Erstarrung der Mörtel und über den glänzenden Stucco der Alten; vom Conservator Dr. Schafhäutl. |
| Autor: | Karl Emil Schafhäutl [GND] |
| Fundstelle: | Band 122, Jahrgang 1851, Nr. LVIII., S. 268 |
| Download: | XML |
LVIII.
Das Portland- und Roman-Cement. Ein
Beitrag zur Geschichte der Cemente oder hydraulischen Mörtel in England, nebst einem
Anhange über die Theorie der Erstarrung der Mörtel und über den glänzenden Stucco der Alten; vom Conservator Dr. Schafhäutl.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
(Schluß von S.
208 des vorhergehenden Heftes.)
Schafhäutl, über das Portland- und
Roman-Cement.
Daß übrigens bei der Zusammensetzung dieser Cemente sehr viel Vorsicht anzuwenden
ist, lehrt die Erfahrung Pasley's in Bezug auf den veränderlichen Kalkgehalt des
Medwaythones. In den Jahren 1828–29 mußte er eilf Procent mehr Kreide zum
Thone mengen als im Jahre 1836 um Cement von derselben Qualität zu erhalten.
Zum Pulvern der Kreide bedient man sich in England zweier sich um eine horizontale
und dann verticale Achse drehenden verticaler (stehender) Mühlsteine, oder auch der
sogenannten Schlamm-Mühle, wobei, während die Walzen die Kreide zerkleinern,
das Wasser im Troge die feinen Kreidetheilchen mit sich fortnimmt, während das
Gröbere und Kieselige
auf dem Boden des Troges liegen bleibt. Zum Mahlen des gebrannten Cements wendet man
zuerst Quetschwalzen an, welche das zerdrückte Material einem horizontal sich
drehenden Mühlsteine zuführen. Der Läufer ist nur zur Hälfte und zwar am Rande
scharf und hat ziemlich weit auseinander liegende Rillen oder Furchen, welche die
Enden einer vom Mittelpunkte aus radirenden etwas krummen Linie bilden.
Zum innigen Mengen des Schlammes mit der Kreide bedient man sich der gewöhnlichen in
den Töpfereien üblichen Knetmühle (pugmill) mit einer
verticalen sich drehenden Achse, an welcher rechtwinkelig etwa 8 zweischneidige
Messer spiralförmig herumgestellt sind. Jedes dieser Messer trägt zwei vertical
aufgesetzte Messer nach oben, und in den Zwischenräumen zwei nach unten. Nachdem die
Kreide trocken gewogen ist, wird sie mit Wasser angerührt, bis sie einen steifen
Teig bildet (dazu sind ungefähr 1/4 Gewichts- oder 1/6 Maaßtheil Wasser
vonnöthen) und in Ballen geformt, von gleicher Größe mit den Ballen aus blauem
Medwaython. In dieser Gestalt werden sie in die Knetmühle gebracht, die immer voll
erhalten werden muß. Die Masse wird durch die schief gestellten beweglichen
horizontalen Messer gemengt und nach unten gedrängt, und zuletzt durch eine Oeffnung
am Boden des Cylinders oder Fasses herausgedrückt.
Zum Brennen bedient man sich der continuirlichen verlehrt kegelförmigen Kalköfen,
deren jeder 70–90 Tonnen Rohmaterial faßt. Die gebrannten Stücke zieht man
unten heraus und gibt frische mit Kohlenklein oben nach. Bei genauer Arbeit probirt
man die ausgezogenen Ballen mit verdünnter Salzsäure. Brausen sie stark, so werden
sie oben wieder aufgegeben, brausen sie nicht, so sind sie hinlänglich gebrannt;
sind sie dunkler als vor dem Brennen geworden oder zum Theil geflossen, so sind sie
zu stark gebrannt und es müssen die einzelnen glasigen Theile entfernt werden. Die
gebrannten Ballen werden hierauf in die Mühle gebracht und das Pulver vor dem
Zutritt der Luft bewahrt.
Das Pulver soll eigentlich ein unfühlbares seyn; je feiner das Cement gepulvert ist,
desto größer ist seine Wirkung. Wird es mit so viel Wasser angemacht als nöthig ist,
um die Masse in Ballen formen zu können, so werden die einzölligen Ballen warm und
erreichen ihren höchsten Temperaturgrad innerhalb 7, 10 bis 12 Minuten nach dem
Anfeuchten der Masse. Wird die Masse wirklich so heiß, daß sie ein unangenehmes
Gefühl in der Hand erregt und zieht dabei zu rasch an, so hat das Cement zu viel Kalk; werden sie hingegen nicht fühlbar warm und
ziehen nur sehr langsam an, so haben sie zu wenig Kalk,
dagegen zu viel Thon in ihrer Mischung.
Legt man die geformten Ballen, bevor sie wieder kalt geworden sind, ins Wasser, so
sondert sich auch beim besten Cement eine Art Schlamm von den Ballen, der dann das
Wasser trübe und schmutzig macht.
Die Einwirkung der Luft hat nachtheiligen Einfluß auf das gepulverte Cement. In
dünnen Schichten der Luft ausgesetzt, verliert es in wenigen Wochen seine
Eigenschaft unter Wasser zu erhärten; in großen Massen, wie in Fässern, wird
höchstens die oberste Schichte verändert und schützt die darunter liegende gegen den
fernem nachtheiligen Einfluß auf lange Zeit. Indessen kommt selbst in England
manchmal durch langes Liegen verdorbenes Cement in den Handel, und man muß deßhalb
beim Einkaufe von Cement sehr auf seiner Hut seyn, da es selbst dem
gewissenhaftesten Fabrikanten nicht immer gelingt, stets gleich gutes Fabricat zu
erzeugen.
Pasley sagt, daß das Cement Kohlensäure aus der Luft
anziehe und dadurch als Cement unbrauchbar werde, ja er hat ein solches
abgestandenes Cement durch nochmaliges Brennen wieder hergestellt.
Es kann aber noch eine andere Ursache geben, welche das Cement unbrauchbar macht. Es
ist nämlich leicht möglich, daß unter dem Einfluß einer feuchten Luft eine wenn auch
nur unvollkommene Verbindung des Kalkes mit der Kieselsäure vor sich gehe, wodurch
das Cement unbrauchbar würde, ohne durch Brennen wieder hergestellt werden zu
können.
Pasley gibt seinen Erfahrungen gemäß folgende praktische
Vorsichtsmaßregeln beim Einkaufe von Cementen an, die sich übrigens aus der Natur
der Sache von selbst ergeben.
1ste Regel. Man mischt Cement (vollkommen fein gepulvertes) mit gerade so viel
Wasser, daß man dasselbe zu Kugeln formen kann, und macht sich vier oder fünf
Probebällchen daraus, doch nicht größer als 1 Zoll im Durchmesser.
Sie werden nun, während sie anziehen, warm (heiß wie gesagt sollen sie nicht werden).
Wenn sie wieder kalt geworden sind, was bei gutem nicht zu schnell anziehendem
Cemente nach einer halben Stunde der Fall seyn wird, so legt man sie in Gefäße mit
Wasser. Wenn sie nun unter Wasser fort und fort härter werden und im Verlaufe eines
Tages oder auch
zweier Tage innen und außen sehr hart geworden sind, was ebenfalls mit den übrigen,
die nicht unter Wasser gewesen sind, der Fall seyn muß, so ist das Cement gut. Haben
die Ballen in dieser Zeit keine große Härte durch und durch erreicht, so ist das
Cement schlecht und darf nicht verwendet werden.
2 te Regel. Wenn die Probekugeln im Wasser nicht erhärten wollen, so muß man sehen,
ob dieser Fehler von abgestandenem oder wirklich schlecht gemachtem oder auch
verfälschtem Cemente herrühre. Man legt zu diesem Zwecke die eben besprochenen
Ballen, nachdem sie trocken geworden, in einen gewöhnlichen Schmelztiegel und macht
sie dann in einem Kohlenfeuer rothglühend, bis sie nicht mehr mit Säuren
brausen.
Man reibt dann diese wieder gebrannten Kugeln in einer Reibschale zum feinsten Pulver
und formt sie mit Wasser wieder zu Kugeln. Verhalten sie sich dann in Luft und
Wasser gemäß Regel 1, so ist dieß ein Zeichen daß das Cement ursprünglich gut war,
aber durch Einwirkung feuchter Luft abgestanden sey.
Wird dagegen das Cement auch durch das wiederholte Brennen nicht besser, so ist es
ein Zeichen daß das ursprüngliche zum Cement verwendete Material schlecht gewesen,
oder daß bei künstlichem Cemente die Mischungsverhältnisse nicht gut getroffen
waren, oder daß gutes Cement mit Erde und andern wohlfeilen Materialien verfälscht
worden sey.Das glaube ich dürfte wohl sehr selten vorkommen. Wir haben schon oben die
Ursache erwähnt, die ein früher vortreffliches Cement so verderben kann, daß
es durch Brennen nicht wieder herzustellen ist. Pasley, dem natürlich die chemische Theorie des
Erhärtungsprocesses nicht bekannt war, konnte sich keine andere Ursache
eines nicht wiedergutzumachenden Verdorbenseyns denken, als Beimischung
fremder Körper.
Cement, das bloß durch Einsaugung von Kohlensäure abgestanden ist, kann durch Brennen
wieder zu gutem Cement gemacht werden, indem man das Pulver wieder mit Wasser
anfeuchtet, in Ballen formt und diese im Kalkofen neuerdings brennt. Wo man gutes
Cement in der Nähe hat, lohnt natürlich diese neue Operation Mühe und Zeit nicht; wo
man hingegen genöthigt ist das Cement von fernen Orten oder Ländern kommen zu
lassen, wird man sich manchmal genöthigt sehen, das angegebene Verfahren zur
Wiederherstellung der hydraulischen Eigenschaften des abgestandenen Cements
anzuwenden.
3te Regel. Die verhältnißmäßige Adhäsionskraft der verschiedenen Cemente zu
bestimmen. Die beste praktische Methode die Adhäsivkraft verschiedener Cemente zu
prüfen ist nach Pasley, wenn man zwei kubische
Steinstücke mit Cement zusammenkittet und dann die Kraft erforscht, welche nöthig
ist die zwei Steine wieder von einander zu trennen. Man darf sich dazu nicht der
Ziegel bedienen, denn diese brechen in der Regel eher als das Cement nachgibt.
Pasley nimmt deßhalb guten dichten Kalkstein und macht
sich zwei Parallelepipeda von den Dimensionen der Lagerflächen der Ziegelsteine
daraus, jedes 10 Zoll lang, 4 Zoll breit und 4 oder mehr Zoll hoch. Um diese Steine
beim Versuche mittelst Zangen halten zu können, werden rechtwinkelige Zapfen-
oder Hängelöcher in die Seiten der Steine gehauen, 1 Zoll breit und 7 tief, 1/2 bis
3/4 Zoll hoch, um das Gebiß der Zange aufnehmen zu können.
Die Flächen, welche aufeinander gekittet werden sollen, müssen mit einem halbzölligen
Steinmeißel rauh gemacht werden, wie die Steinmetzen ihre rauhen Flächen überhaupt
zu erzeugen pflegen. Man trägt das Cement immer sorgfältig auf beide zu vereinigende
Flächen auf, macht die Mauern zuvor naß und taucht die Ziegelsteine zuvor 1/2 Minute
in Wasser.
Um verlässige Resultate zu erlangen, darf man sich auf bloß eine Probe nicht
verlassen; man hält deßhalb für jede Probe zehn solche Steinparallelepipeda
vorräthig, die man für viele Proben brauchen kann, wenn man verhindert, daß sie nach
dem Auseinanderreißen auf den Boden fallen.
Man nimmt nun einen bestimmten aber gleichen Maaßtheil gepulvertes Cement für jede
Fuge, und macht sie gerade vor dem Gebrauche mit dem bestimmten Quantum Wasser an,
kittet nun die Steine mit dem frisch angemachten Cemente rasch zusammen (Pasley nahm für jeden Stein der oben angegebenen
Dimensionen 10 Kubikzoll gepulvertes Cement und mischte es vor dem Gebrauche nach
dem Augenmaaße mit dem erforderlichen Wasser), und läßt sie zehn Tage in diesem
Zustande liegen, damit das Cement Zeit gewinne zu erhärten. Man hängt dann am
einfachsten in zwei Zangen ein solches zusammengekittetes Steinpaar an einem Dreifuß
aus drei Spießbäumen bestehend auf, hängt in das untere Zangenauge eine große
Waagschale und beschwert sie mit Gewichten so lange, bis die zwei Steine von
einander getrennt sind.
Aus den zahlreichen Experimenten Pasley's ging nun das wichtige Resultat hervor: 1) Daß eins reine (nicht mit
Sand gemengtes) Cement an allen Flächen, selbst an polirten granitischen, nahezu mit
gleicher Kraft hafte.
2) Daß das Cement die Steinflächen in einem Zeitraum von 11 Tagen mit einer fünfmal größern Kraft zusammenhalte, als gewöhnlicher
Mörtel nach 30 Jahren. Das Erhärten des Cements in Fugen geht weit langsamer vor
sich als in der Luft oder frei unter Wasser. So wurden zwei zusammengekittete
Ziegelsteine nach 39 Tagen noch mit 1717 Pfund auseinander gerissen; mit derselben
Mischung zusammengekittete Ziegelsteine hielten dagegen nach 74 Tagen ein Gewicht
von 4455 Pfund aus, und auch da brach nur der Ziegelstein während die Fuge noch fest
war.
3) Daß Steinflächen, selbst wenn sie sehr groß sind, durch Cement mit demselben
Vortheil zusammengekittet werden können, als Ziegelsteine und kleinere Steinflächen.
Zwei große Beamleyfallsteine von 39 bei 29 Zoll Flächenseite hingen mit solcher
Kraft zusammen, daß die Masse des Steines selbst nachgab und die Fuge unversehrt
blieb. Nachdem man endlich die Steine durch Keile voneinander getrennt hatte, fand
man daß in der Zeit von 45 Tagen der innere Theil des Cements nicht vollkommen hart
geworden sey, und daß also bloß der äußere erhärtete Cementrand die Steine mit
solcher Kraft zusammengehalten habe. Der General, dem die Theorie der hydraulischen
Kalke wie allen Engländern unbekannt blieb, schreibt diese Ursache dem Mangel an
Luftzutritt zu, während die wahre Ursache wahrscheinlich in der Unmöglichkeit lag,
daß das Wasser aus dem Innern entweichen konnte, während die äußeren Theile der Fuge
bereits erstarrten.
Man war lange der Meinung, daß man große Bausteine durch Cement nicht vereinigen
könne, weil der hydraulische Kalk viel zu schnell anziehe, als daß man Zeit hätte,
die großen Steinflächen vor dem Anziehen auf einander zu richten.
Aus Pasley's Versuchen geht
indessen aufs unzweideutigste hervor, daß auch das in kleinen Kugeln sehr rasch
erhärtende Cement im Großen angewendet weit längere Zeit zum Erhärten brauche,
nämlich 15 bis 20 Minuten. Wenn deßhalb die zu vereinigenden Steinflächen zuvor auf
einander gepaßt und dann auf beide Steinflächen das Cement aufgetragen wird, so hat
man hinlänglich Zeit, die Steine durch einen Flaschenzug auf einander zu legen ehe
der Mörtel anzieht, was immer wie schon gesagt einen Zeitraum von 15–20
Minuten erfordert.
Pasley's Versuche lehrten
ferner: daß der Zusammenhalt des Cementes in den Fugen selbst noch stärker ist, als
seine adhäsive Kraft an
die Steinflächen; denn werden die zusammengekitteten Steine endlich von einander
gerissen, so löst sich das unversehrte Cement gewöhnlich bloß von den
Steinflächen.
Man pflegt ferner die Cemente mit Sand zu vermengen, und in den Ankündigungen der
Cementverkäufer ist gewöhnlich angegeben, wie viel Sand jede Sorte ihrer Cemente
vertrage.
Nach den sorgfältigsten Untersuchungen Pasley's verringert jede Beimischung von
Sand die adhäsive Kraft des Cements, und es ist die in London gebräuchliche Mischung
von gleichen Maaßtheilen Sand und Cement mehr als viermal
schwächer, als reines Cement.
Brunel war deßhalb vollkommen gerechtfertigt, daß er bloß
reines Cement zum Gewölbe des Tunnels nahm, obwohl man bei Wasserbauten die keine
außerordentliche Festigkeit verlangen, wie Schiffswerften, Schleußen etc. die
gewöhnlich übliche Mischung von Sand anwenden kann, weil dadurch die Kosten
bedeutend vermindert werden, das Cement seine hydraulischen Eigenschaften nicht
verliert, und dennoch mit dieser Beimischung fester ist als gewöhnlicher
Kalkmörtel.
Gebraucht man das Cement als Anwurf (Stucco) wie das in England bei allen neuen
Bauten der Fall ist, so muß das Cement mit Sand gemengt werden, um Risse zu
vermeiden.
Die besten Verhältnisse sind 1 Maaßtheil scharfen nicht zu
feinen reinen Sandes auf 2 Maaßtheile Cement. Der Sand kann ohne Schaden so
weit vermehrt werden, daß er an Maaß dem Cement gleich wird. Stucco wird schlecht,
wenn der Sand an Maaß das Cement überschreitet. Je gröber und schärfer der Sand,
desto besser. Der Cementanwurf darf nicht so lose angeworfen bleiben, wie
gewöhnlicher Kalkanwurf, er muß vielmehr mit der Kelle angedrückt werden, noch ehe
er anzieht.
Legt man mehrere Schichten über einander, so muß die zweite aufgetragen werden, bevor
die erste vollkommen angezogen hat. War dieß letztere der Fall, so vereinigen sich
die beiden Schichten nur schwach, und der Frost trennt sie gewöhnlich sehr bald,
wenn sie dem Regen ausgesetzt waren.
Die Oberfläche alter Gebäude, wenn sie von Rauch und Zeit angelaufen sind, muß
abgekratzt und rauh gemacht werden, ebenso der alte Mörtel aus den Steinfugen 1/2
Zoll tief herausgestochen und die Fläche wohl benetzt werden, wenn der Cementanwurf
halten soll.
Eine weitere nicht minder wichtige Anwendung der hydraulischen Cemente ist die zur
Hervorbringung künstlicher Steine, Gesimse, Leisten, Ornamente. Auch hier werden
Steine, aus hydraulischem Cement allein gemacht, die besten seyn, denn, wie wir im
Laufe unserer Untersuchungen gesehen haben: jede Beimischung von Sand vermindert die
Festigkeit des hydraulischen Cementes; allein nur für kleinere Gegenstände mit
geformter Außenseite, wo scharfe Kanten nothwendig sind, und welche die Arbeit des
Steinmetzes ersetzen sollen, erlaubt die Kostspieligkeit der Cemente ihre
unvermischte Anwendung.
Nach Versuchen, die Stärke oder den Zusammenhalt von Blöcken verschiedener Cemente
durch Zerdrücken zu erforschen, die in Hrn. Grissell's
Regents-Canal-Eisenwerken mittelst einer hydraulischen Presse
angestellt wurden (im Juli 1848) ergab sich, daß ein Prisma aus reinem
Portland-Cement 30 Tage alt, 18 Zoll lang und 9 Zoll Seite, bei einer
Anwendung von 52 1/2 Tonnen zu splittern begann, und bei 56 1/4 Tonnen war das
Prisma der Länge nach gespalten, aber bei 75 Tonnen oder 1555 Pfd. auf den
Quadratzoll, noch nicht zerdrückt.
Ein Prisma, zusammengesetzt aus 1 Theil Portland-Cement und 2 Theilen Sand, 52
Tage alt, begann bei 30, 37 Tonnen an einer Ecke etwas zu reißen, und zersprang bei
45 Tonnen oder 1244 Pfund auf den Quadratzoll. Ein Prisma aus 1 Theil
Portland-Cement und 3 Theilen Sand, 52 Tage alt, begann bei 15 Tonnen an
einer Ecke zu splittern und wurde bei 25 Tonnen oder 691 Pfd. auf den Quadratzoll
zerdrückt.
Die beiden Prismen wurden kurze Zeit nachdem sie verfertigt waren, 7 Tage lang in
Wasser gelegt. Das Prisma mit 2 Theilen Sand wog vor dem Einlegen 106 1/2 Pfd., nach
7 Tagen 107 1/2 Pfd. Das Prisma mit 3 Theilen Sand wog vor dem Einlegen 104 Pfd.,
nach 7 Tagen 105 1/2 Pfd. Das erste hatte demnach 1 Proc., das zweite Prisma 1 1/2
Proc. Wasser aufgenommen.
Eine andere Methode die relative Stärke von Cementprismen zu prüfen ist die, welcher
sich vorzüglich General Treussart bediente. Man hängt ein
Steinprisma an den Enden in zwei Bügeln auf, und legt in der Mitte einen andern
Bügel an, der durch Waagschale und Gewicht so lange niedergezogen wird, bis das
Prisma bricht. Die Kraft, welche erforderlich war Steinprismen in ihrer Mitte zu
zerbrechen, hing zum Theil natürlich von der Güte des Cementes, zum Theil von
Beimischungen von Sand ab.
Pasley nahm Sand von drei verschiedenen Dimensionen, aus
Gründen welche wir bald kennen lernen werden. Der gröbste Sand, Grus, war nicht
größer als eine Pferdebohne. Der grobe Sand ging durch ein Sieb mit Oeffnungen im
Lichten zu 1/8 Zoll, und der feinste Sand durch ein Sieb das 30 Maschen auf einen
Zoll hatte.
Die Steine wurden in hölzernen Rahmen oder Formen gemacht, deren Seiten, von Keilen
zusammengehalten, auseinander genommen werden konnten. Sie waren 4 Zoll lang, 2 Zoll
breit und 2 Zoll tief im Lichten. Hierauf wurden Cement und Sand in Maaßtheilen auf
einem Brette gemengt, mit Wasser wohl angemacht, dann in drei Portionen in die Form
gebracht, sorgfältig eingerammt und dann die Oberfläche mit einem Streichholze
geebnet.
Die Prismen mit einer Mischung aus Harwich- und Sheppey-Cement
(Roman-Cement) gaben die besten Resultate bei:
1
Maaßtheil Cement,
1 1/2
„ Grus,
11
„ grobem
„ feinem
Sand
wo die Prismen bei 118 Pfd. brachen; dann
Cement
1 Maaßtheil
Grus
4 „
grobem Sund
1 „
feinem „
1 „
wo das Prisma mit 102 Pfd. brach.
Weit schwächer war Portland-Cement aus 5 Maaßtheilen Kreide und 2 Maaßtheilen
blauem Medwaython, denn die obigen Prismen brachen unter 20 und 27 Pfunden, und wenn
sie 439 Tage alt waren und aus einem Gemenge von
1
Maaßtheil Cement,
4
„
Grus,
2
„
groben,
2
„
feinen Sandes
bestanden, unter einem Gewichte von 55 Pfund.
Dagegen brachen Prismen der besten Ziegelsteine von gleichen
Dimensionen im Durchschnitt unter
752 Pfd.
mittelmäßiger Ziegelsteine erst unter
329 Pfd.
Gleiche Prismen von gewöhnlicher dichter getrockneter Kreide,
wie sie aus den Kreidefelsen Englands gebrochen wird, brachen erst unter 334
Pfund.
Ueber die verhältnißmäßige Festigkeit
von Roman-Cement und Portland-Cement.
Das Portland-Cement begann in England und Deutschland in den letzten Jahren
sehr in die Mode zu kommen. Zum Theile von Interesse, zum Theile von Liebhaberei
getragen, wurden die guten Eigenschaften des Portland-Cements oft weit über
alles Maaß erhoben und die des Roman-Cements in eben dem Verhältnisse
herabgebrückt. So wurden die obigen Zerdrückungs-Proben von
Portland-Cement vergleichungsweise mit Roman-Cement aus derselben
Fabrik angestellt, woraus sich dann ergab, daß die Zusammenhaltungskraft des reinen
Portland-Cements dreimal größer war als die des Roman-Cements, des mit
2 Theilen Sand gemengten gar 15 mal, und des mit 3 Theilen Sand gemengten 8 mal
größer war als die von Roman-Cement.
Da die Bereitungsweise beider Cemente nicht angegeben war, da die Fabrik, welche das
Roman-Cement lieferte, den bedeutendsten Handel mit Portland-Cement
treibt, so läßt sich aus diesen Experimenten kein sicherer Schluß für die Praxis
ziehen; denn wir kennen die Güte des angewandten Roman-Cements gar nicht, und
die Experimente sind so im allgemeinen angegeben, daß man sie als wissenschaftlich
praktisches Resultat gar nicht brauchen kann. Generalmajor Pasley hingegen hatte bei allen seinen Versuchen kein anderes Interesse
als die Wahrheit, und konnte kein anderes haben, da er nicht für Gewinn arbeitete,
sondern für die Welt.
Leider hat er keine Zerdrückungsversuche angestellt. Glücklicherweise hat man aber in
den Regents-Canal-Eisenwerken des Hrn. Grissell auch Adhäsions-Versuche
angestellt, und diese lassen sich deßhalb mit Generalmajor Pasley's Versuchen recht gut vergleichen.
Nach den Versuchen in den Regents-Canal-Eisenwerken hing das
Roman-Cement am stärksten am Portland-Kalk und zwar mit einer Kraft
von 146 Pfd., dagegen Roman-Cement nur mit einer Kraft von 25 Pfund.
An den Bramley-Fallsteinen brachen 36 Pfd. auf den Quadratzoll den Stein und
einen Theil der Fuge ab, während bei demselben Experimente Pasley's mit dem Harwich-Cemente
(Roman-Cement), das nur an den Rändern fest war, der Stein brach, ohne daß
die Fuge im geringsten beschädigt wurde.
Die Adhäsivkraft des besten Roman-Cements war hier bei einer Quadratfläche von
1131 Quadratzollen, in Beziehung auf den weichen innern größten Theil der
Cementfläche auf 50 Pfd. per Quadratzoll herabgesunken,
während bei den Versuchen in Hrn. Grissell's Eisenwerken bei einer kleinen Oberfläche von nur 36
Quadratzollen selbst mit Portland-Cement ein Theil des Steines und der Fuge
mit 36 Pfd. nachgab.
Wenn die Fuge durchaus trocken geworden ist, rechnet Pasley 125 Pfd. Widerstand auf den Quadratzoll und er kam nach allen
seinen mühevollen und umsichtigen Versuchen zu dem Resultate, daß sein
Portland-Cement dem besten natürlichen Cemente, Roman-Cement aus Francis' und Whites's Fabrik
völlig gleich komme, wenn es dasselbe nicht in manchen Fällen übertreffe, und darauf
kann man sich in der Praxis ganz gut verlassen. Das natürliche Cement hat in jedem
Falle mehr adhäsive Kraft, als die besten Ziegelsteine und selbst manche natürliche
Steine Cohäsionskraft besitzen, wie z.B. der Bramley-Fallstein. Um
Cementmauern niederzureißen, mußte man Schießpulver anwenden, und als die Mauer
niedergerissen wurde, welche zur Verwahrung des Eingangs des Themsetunnels angelegt
wurde, während die Fortsetzung der Arbeit im Stocken war, gaben weit eher die
Ziegelsteine als die Cementfugen nach.
Im allgemeinen brauchen, wie wir schon erwähnt, Steinfugen von großer Oberfläche eine
viel größere Zeit zum Erhärten als kleine, und in dieser Hinsicht gibt Pasley die Regel:
Die adhäsive Kraft der Cemente darf nicht nach der Oberfläche der Steine gerechnet
werden, was nur angeht, wenn alle Fugen von gleichem Inhalt und von gleicher
Zugänglichkeit für Luft sind. In der That verhält sich die adhäsive Kraft jeder
Steinfuge gerade wie das Alter des Cements und verkehrt wie die Oberfläche der Fugen.
Mit der Verfertigung von Portland-Cement beschäftigen sich vorzüglich neben
der Blashfield'schen Fabrik: John
Bazley, White, and Sons, Millbank-Street, London.
Die Engländer haben sich auf genaue analytische Untersuchungen ihrer Cemente gar
nicht eingelassen. Was von ihnen nicht gethan worden, ist von Franzosen und
Deutschen geschehen.
Das Portland-Cement ist indessen noch so unbekannt, wie wir im Eingang unserer
Abhandlung bewiesen, daß man in Schriften nicht einmal seinen Namen, viel weniger
seine Verfertigung und Analyse findet. Professor Pettenkofer in München war der erste, der eine
genaue Analyse des Portland-Cements im Jahre 1849 in seinem Laboratorium machen ließ, um den
Unterschied zwischen dem bayerischen natürlichen Cemente und dem englischen
Portland-Cement herauszufinden.Polytechn. Journal Bd. CXIII S.
355. Die Zusammensetzung ergab sich in folgender Weise:
Kalk
54,11
Bittererde
0,75
KaliNatron
1,10 1,66
2,76 Alkalien
Thonerde
7,75
Eisenoxyd mit Spuren von
Manganoxyd
5,30
Kieselsäure
22,23
Kohlensäure
2,15
Phosphorsäure
0,75
Schwefelsäure
1,00
Sand
2,20
Wasser
1
–––––
100,00.
Der starke Natrongehalt ist hier vor allem auffallend, und Pettenkofer schreibt diesem Natrongehalte die vorzüglichen Eigenschaften
zu, welche das englische Portland-Cement vor dem gewöhnlichen in Bayern
bereiteten natürlichen hydraulischen Cemente auszeichnen.
Ein gleichfalls unter Pettenkofer's Leitung analysirtes bayerisches Cement hatte folgende
Zusammensetzung:
Kalk
52,11
Bittererde
3,05
Kali
1,00
Natron
0,25
Thonerde
3,38
Eisenoxyd mit Spuren von
Manganoxyd
3,20
Kieselsäure
20,82
Kohlensäure
4,75
Phosphorsäure
2,55
Schwefelsäure
0,57
Sand
1,90
Wasser
6,00.
Dieses Cement war aus der Kreide oder vielleicht auch den jurassischen Mergeln der
bayerischen Vorgebirge um Tegernsee gebrannt und hatte das unerwartet geringe
specifische Gewicht von 2,723, während das Portland-Cement ein specifisches
Gewicht von 3,05 besitzt.
Das geringe specifische Gewicht, der große Kohlensäure- und Wassergehalt
zeigen, daß der Mergel nicht genug gebrannt war, und das Pulver durch Liegen an der
Luft schon abzustehen anfing.
Ich habe mich durch zahlreiche Proben überzeugt, daß wir in unserem bayerischen
Vorgebirge vom Bodensee bis an die östliche Gränze unerschöpfliche Mergellager
besitzen, von mir Fucoiden-Kalkmergel genanntGeognostische Untersuchungen des südbayerischen Alpengebirgs. München, 1851,
S. 22 und Tabelle II. B, S. 138., von welchem mehrere Schichten richtig gebrannt, eben so schnell erhärtendes
Cement geben als das Portland-Cement selbst.
Leider beschäftigen sich mit der Bereitung dieses wichtigen Handelsartikels
gewöhnlich Leute, welche mit den Bedingnissen, unter welchen hydraulischer Kalk
erzeugt werden kann, nicht oder nicht hinreichend bekannt sind. Das Gelingen ihrer
Operation hängt deßhalb vom Zufalle ab, so daß bald gutes bald schlechtes Product in
den Handel kommt.
Die oben angegebenen einfachen Merkmale Pasley's zur Erkennung eines guten hydraulischen Cementes dienen
natürlich auch zur Erkennung von hydraulischen Mergeln nach dem Brennen. Im
allgemeinen kann auch die sinnreiche Bemerkung von Schnitzlein und Frickhinger
Die Vegetationsverhältnisse der Jura- und Keuperformation in den
Flußgebieten der Wörnitz und Altmühl. Nördlingen, 1848, S. 49. leiten, daß, da die Ericeen Kieselpflanzen sind, folglich, wo auf kalkigem
Boden Ericeen vorkommen, ein Kalkmergel zu erwarten sey.
Die Mergel müssen zuletzt noch durch Brennen in verschiedenen Hitzegraden geprüft
werden, und diejenige Hitze, deren Product die Pasley'sche Probe am besten besteht, auch bei dem Brennen im Großen so genau
als möglich eingehalten werden.
Daß die specifische Dichtigkeit des Cementes wächst je stärker die Hitze beim Brennen
war, ist begreiflich, und so fand auch Pasley, wie wir
oben gemeldet, daß abgestandener Medwaython ein schwieriger zu pulverndes, also
dichteres Product lieferte als frischer Thon, obwohl er auch gutes Cement von Lehm
aus Lehmgruben erhielt, wenn er nur fein genug vertheilt war. Daß ein Natron-
und Kaligehalt als eine Art von Flußmittel eine Art von Sinterung noch unter
gewöhnlichen Hitzgraden veranlassen müsse, wie Prof. Pettenkofer sehr schön in seiner oben erwähnten
Abhandlung dargethan, ist einleuchtend, und in dieser Hinsicht wäre der Thon des Medwayflusses seines
wahrscheinlichen Natrongehaltes halber zum Portland-Cement der geeignetste.
Von großem Interesse würde die Analyse aller Thonarten seyn, welche in England zu
künstlichen Cementen verwendet werden. Ich hoffe diese Arbeit mit der Zeit
durchführen zu können, oder wenigstens zu veranlassen daß sie ausgeführt werde.
Künstliche hydraulische Cemente nach Art des Portland-Cementes
zusammenzusetzen, würde sich in Bayern bei seinem Reichthum an hydraulischen Mergeln
der Mühe, noch mehr der Kosten nicht lohnen.
Schon in England ist das Portland-Cement bedeutend höher im Preise als das
Roman-Cement. Wenn der Bushel von Roman-Cement in der Blashfield'schen Fabrik 1 Shill. 6 Pence kostet, so kommt
der Bushel Portland-Cement auf 2 Shill. 3 Pence und in andern Fabriken auf 2
Shill. 6 Pence zu stehen.
Ueber das englische Concrete
.
Concrete (künstlicher Stein) der Engländer, ist eine Art
Béton der Franzosen. Es besteht aus einem
Gemenge von gewöhnlichem Mörtel mit größern Steinen, Grus, das man in verlorenen
Formen oder Verschalungen aus Holz (unsere Gußmauern) oder in bleibenden, aus
Ziegel- oder Quadermauern (unsere Futtermauern) bestehend, erstarren
läßt.
Die Römer, die Mauren und auch die alten englischen, deutschen Baumeister wendeten
diese Art von Stein zu ihren Bauten an. Man findet Mauern alter Burgen im Norden
nicht selten zum Theil wenigstens aus diesem Gemenge bestehend, z.B. Kendal Castle;
auch mehrere ältere und neuere Werke handeln vom Béton, z.B. Belidor; indessen war dieser
Mörtel in England in der neuesten Zeit ganz vergessen, bis ihn ein Zufall wieder,
seit etwa 1812, zu Credit und sogar in die Mode brachte.
Als die Arbeiter den Grund für einen der Pfeiler der Waterloo-Brücke
ausgruben, fanden sie den Grund gerade hier aus einem festen Conglomerat von Grus
bestehend, während der letzte im übrigen Theile des Flußbettes vollkommen lose war;
Nachforschungen ergaben sehr bald, daß an dieser Stelle ein Schiff mit einer Ladung
von Aetzkalk versunken sey, der sich während des Löschens in einem breiartigen
Zustande zwischen die losen Rollsteine gelegt und erhärtend dieselben zu einem
Conglomerate verbunden hatte. Der bekannte Baumeister dieser Brücke, John Rennie, erzählte diesen Vorfall dem gegenwärtigen Sir
Robert Smirke.
Die größte Strafanstalt in London an dem linken Ufer der Themse, Millbank Penitentiary, war auf einem sehr sumpfigen
Grund erbaut, die Grundmauern eines Theiles des Gebäudes begannen deßhalb zu sinken,
als der zu Rath gezogene Sir R. Smirke beim übrigen Theil
des Gebäudes, sich an Rennie's
Bemerkungen erinnernd, den Grund aus einem Gemenge von Kalk und Gerölle goß, eine
Methode die sich so sehr bewährte, daß dieser Baumeister den Grund zu allen seinen
Bauten aus Concrete machte, die nie ihren Dienst
versagten. Das neue schöne Customhouse (Zollhaus) im Hafen von London 1814 auf einem
Pfahlrost erbaut, gab ein neues Beispiel der guten Dienste, welche das Concrete zu leisten im Stande ist. Der mittlere Theil
des Pfahlrostes war gesunken und zwar so, daß der Boden des im Mittlern Theil des
Gebäudes befindlichen 190' bei 66' haltenden langen Saales einstürzte und das ganze
Gebäude in Gefahr gerieth.
Sir Robert Smirke wurde in diesem mißlichen Falle zu Rathe
gezogen, und um nur wenigstens die Seitenflügel zu erhalten, unterbaute er alle
Mauern in einer Breite von 12 Fuß mit Concrete, das er
auf dem Geschiebe des Grundes in einer Tiefe von 12 Fuß aufsetzte, so daß die
gegenwärtige Fronte des Gebäudes von seiner Restauration herrührt.
Seit dieser Zeit wurde das Concrete von allen Architekten
nicht allein zu Grundbauten, sondern auch zu Füll- und Hinterbauten (Futtern)
von Werft-Mauern und Kai's, ja zuletzt sogar zu künstlichen Steinen und
ganzen Mauern, Gewölben und Häusern angewendet.
Nach Smirke's Vorgang ist das
Concrete gewöhnlich aus frisch gebranntem und fein
gepulvertem Kalke bestehend, der trocken mit Grus und Sand gemengt wird, worauf man
erst Wasser hinzufügt und das Ganze so rasch als möglich von zwei Arbeitern in der
Nähe des ausgegrabenen Grundes zu einem steifen Brei anrühren läßt, der dann ohne
Säumen so rasch als möglich von einem temporären Gerüste und so hoch als möglich in
den ausgegrabenen Grund geworfen wird. Was sich durch den Fall nicht festgedrückt
hat, wird geebnet und gerammt oder festgestampft.
Das Gemisch erhitzt sich mäßig während des Löschens des Kalkes, und beginnt so rasch
anzuziehen, daß, wenn nur die Masse gehörig geebnet ist, man ohne Gefahr mit dem
Mauerwerk auch des größten Gebäudes beginnen kann.
Man bedient sich hier stets des gewöhnlichen Kalkes, der nicht zu mager oder strong (stark) ist, wie ihn die Engländer nennen. Sie
bezeichnen nämlich Mauerkalke, welche als Mörtel besser der Einwirkung des Wassers widerstehen als
reiner Kreide-Kalk, aber dennoch nicht für sich unter Wasser erhärten wie
Cement – mit dem Namen Wasserkalke (waterlimes), und unterscheiden sie, je mehr sie sich dem
Cemente nähern, durch das Wort stärker (stronger.) In London werden sie von den Maurern auch Steinkalk genannt, hie und da thonige Kalke. Alle diese Wasserkalke löschen sich noch mit Wasser, jedoch
nicht ganz so rasch und aufschwellendEin Kubikfuß reiner Aetzkalk in Stücken von der Größe einer Mannsfaust wiegt
im Durchschnitt 35 Pfund und ist aus 63 Pfunden kohlensaurem Kalk
entstanden. In Pulver verwandelt nimmt er natürlich weniger Raum als einen
Kubikfuß ein, wenn er jedoch gelöscht und successive in ein trockenes Hydrat
verwandelt wird, wozu etwa 2 1/2 Stunden nöthig sind, so nimmt er mehr als 1
1/2 Kubikfuß Raum ein. als reiner Aetzkalk, und sie löschen sich desto langsamer, je mehr sie sich
dem Cemente nähern.
Wenn man den gepulverten Aetzkalk dieser Wasserkalke mit etwa 1/3 Maaßtheil Wasser zu
einer Kugel formt und sie ins Wasser legt, so dehnt sich die Masse aufschwellend aus
und zerfällt zuletzt in Stücke. Das geschieht stets, jedoch früher oder später, je
nachdem der Wasserkalk schwächer (fetter), oder stärker (mager) ist.
In England bilden ein häufig gebrauchter Kreidemergel, in der Nähe von Halling
gebrochen, und der blaue Liaskalk die Gränzen von fettem Kalk und Cement.
Eine einzöllige Kugel von Halling-Kalk schwillt während 1 1/2 Stunden unter
Wasser zu ihrem doppelten Durchmesser auf, wird also achtmal größer und fällt dann
sogleich in Stücke, und zwar unter Entwicklung von so viel Hitze, daß das Wasser in
dem Gefäße warm wird.
Der blaue Liaskalk dagegen, in derselben Weise behandelt, zieht unter Wasser rasch
an, und nur mit der Zeit, das heißt nach mehreren Tagen, beginnt er etwas zu
schwellen, was sich durch zahlreiche Risse an der Oberfläche kund gibt, worauf er
zuletzt auch in Stücke fällt.
In England gehören zu den Wasserkalken alle gefärbten Kreide- oder Kalksteine.
Die aus der Kreideformation geben die schwächsten, die aus der Liasformation die
stärksten Wasserkalke.
Die obere Kreide, weiße Kreide, gibt reinen Aetzkalk. Die untere Kreide (lower chalks, Kreidemergel)
ist gefärbt, gewöhnlich grau oder blaulich-grau (grey
chalks) und gibt wegen ihres obwohl geringen Thongehalts Wasserkalk.
Dahin gehören in England vorzüglich die geschätzten Halling-Kalksteine am linken Ufer des Medway-Flusses
oberhalb Rochester, auch bei Burham am rechten Ufer desselben Flusses; dann der Dorking- oder Merstham-Kalk aus derselben
Gegend. Alle diese Kalke gehören zu den schwächsten Wasserkalken; da hingegen die
blauen Liaskalke von den entgegengesetzten Ufern des Bristol-Canals bei
Watchet in Sommersetshire und Aberthaw in Glamorganshire, dann noch zu Lyme Regis in
Dorsetshire die stärksten Wasserkalke bilden.
Sie vertragen im umgekehrten Verhältnisse ihrer Thonerdegehalte weniger Sand, während
der reinste Kreide-Kalk die größte Quantität verträgt. So hat Pasley aus einer Menge von Versuchen den Schluß gezogen,
daß 1 Kubikfuß frisch gebrannter Kalk, in Stücken nicht größer als eine Mannsfaust,
der 35 Pfund wiegt, mit 3 1/2 Fuß gutem scharfem Flußsand und ungefähr 1 1/5
Kubikfuß Wasser wohlvermengt 3 1/2 Kubikfuß des besten Mörtels gaben, der mit diesem
Kalke hervorgebracht werden kann.
Die Maurer in England gebrauchen indessen weniger Sand, 2 Theile nämlich zu 1 Theil
Kalk, weil sie weniger Mühe im Mengen haben, rascher fertig werden, und der Kalk
leichter zu verarbeiten (länger oder zäher) wird, obwohl diese Mischung nicht so gut
ist als die erste.
Unerläßlich ist, daß das Concrete-Fundament stets
breiter sey als die Mauern, die darauf gesetzt werden. Bei großen Gebäuden pflegt
man auch die ganze Grundfläche, welche das Gebäude einnehmen soll, mit dem Concrete auszufüllen. Die erfahrensten Baumeister
stimmen darüber überein, daß das Concrete nie weniger
als 4 1/2 Fuß Tiefe haben soll, eben so braucht es nie tiefer als 6–7 Fuß zu
seyn, wenn man nicht etwa in etwas größerer Tiefe auf einen festen Grund gelangen
kann.
Der Nutzen des Concrete schien so schlagend, daß man bei
seiner Anwendung zu Grundmauern nicht mehr stehen blieb. Der Architect Thomas Cooper zu Brighton hatte den kühnen Gedanken, die ganze
Mauer gegen die See an der östlichen Klippe zu Brighton aus Concrete in einzelnen Theilen zu gießen, und zwar in derselben Weise wie
der Tapia- und Pisé-Bau in Spanien und Frankreich seit
undenklichen Zeiten ausgeführt wird.
Die Kisten oder Rahmen (Verschalungen), in welche das Concrete gegossen ward, waren 20 Fuß lang und 4 Fuß hoch, so daß man in
dieser Weise eine Mauer in successiven Operationen zu Wege brachte, die an manchen Stellen 60 Fuß
hoch, unten 22 1/2 Fuß und oben 2 1/2 Fuß dick ist.
Hierauf folgte Ranger, der in zerlegbaren hölzernen Formen
gewöhnliche Mauersteine und auch große Blöcke aus Concrete machte, und sich sein Verfahren patentiren ließ, was übrigens gar
nichts Abweichendes von dem bisher beschriebenen Verfahren hatte, ausgenommen daß er
sich zum Anmachen des Gemisches des heißen anstatt des kalten Wassers bediente, was
den einzigen Vortheil hat, daß das Gemenge schneller erstarrte, und man also weniger
Formen nöthig hatte. Eine halbe Stunde nach dem Gießen aus den Formen genommen,
müssen die Steine nur zwei oder drei Monate stehen bis man sie mit Sicherheit
gebrauchen darf. Eine Menge Häuser wurden in London aus diesen Steinen erbaut, wovon
ich nur das berühmte Collegium der Chirurgen (College of
Surgeons), Lincolns-Inn-Fields, anführen will.
Der Admiralitäts-Architekt Taylor hatte ferner den
riesigen Gedanken, die größten Kais- und Schiffswerftmauern aus den
künstlichen Steinen nach Ranger's Patent aufbauen zu wollen. Er führte seine Idee auch aus,
nur daß er, was unerläßlich war, die der See ausgesetzte Seite seiner Mauern in den
Docks mit Granit bedeckte und schützte.
Ja sogar ein Gewölbe für Casematten, 18 Fuß lang, 5 Fuß hoch und 6 Fuß dick über der
Krone des Bogens, ward vom Anfang Februar bis 17. März zu Woolwich gebaut und zwei
Monate darauf mit schwerem Wurfgeschütz und Kanonenfeuer geprüft; 13zöllige Bomben
drangen nicht tiefer als einen Fuß in das Gewölbe, obwohl das Innere desselben noch
ganz weich war.
Die Vorschriften Ranger's und
andern in Hinsicht auf die Mischungsverhältnisse sind 6–8 Theile Grus und
Sand mit 1 Theil gepulverten und gesiebten Aetzkalks. Mergel mit hydraulischen
Eigenschaften vertragen weniger Sand.
Es ist durchaus nothwendig, daß der Sand aus größern Steinen, Grus und aus kleinern
Sandtheilchen bestehe, sonst erhält man auf einer Seite nichts als Mörtel, auf der
andern Seite würde gar kein Zusammenhalt bewirkt werden können.
In Hinsicht auf den gepulverten Kalk scheint es jedoch wohlfeiler und besser,
wenigstens bei Mauern an der Luft, den Kalk zuvor zu löschen, mit feinem Sand zu
Mörtel zu machen und dann erst den Grus mit dem Mörtel zu vereinigen. Die große
Seemauer zu Brighton, von welcher wir oben sprachen, ist aus einem Concrete dieser Art gemacht. Ja nach den
sorgfältigen Untersuchungen Pasley's soll zu künstlichen Steinen durchaus kein gepulverter
Aetzkalk genommen werden, weil er sich nie vollkommen und gleichzeitig löscht und
nach der Hand während des allmählichen Löschens unganze Stellen im Steine
veranlaßt.
Es ist hier wieder zu bemerken, daß die eigentlichen Cemente viel zu kostspielig
sind, um, bestimmte Fälle ausgenommen, zu künstlichen Steinen und Concrete mit Vortheil verwendet werden zu können.
Nach Pasley's Untersuchungen
sind die Steine aus Cement, wie wir schon früher gesehen haben, in Bezug auf ihre
relative Stärke viel schwächer als selbst dichte Kreide, und Concrete aus gewöhnlichem reinem oder etwas mergeligem Kalke sind eben so
fest als die, bei denen Cement angewendet worden ist.
Ein Gemenge aus 1 Maaßtheil Halling-Kalkpulver und 3 1/2 Maaßtheilen groben
Sandes brach bei einem Gewichte von 211 Pfunden. Von dem blauen Liaskalk 1
Maaßtheil, 4 2/3 Maaßtheile Grus und 1 2/3 feinen Sandes brachen mit 188 Pfd.; also
waren alle diese stärker, als die oben angeführten mit Cementpulver.
Nach allen Erfahrungen kommt Pasley zu dem Schlusse:
„Concrete, wenn es innerhalb gewisser
Gränzen angewendet wird, ist ein sehr vorzügliches und brauchbares Baumaterial,
vorzüglich z.B. zu Grundmauern auf sandigen Inseln, wo weder Ziegelthon noch
Steine überhaupt zu haben sind, auch für Hinter-, Füll- und
Böschungsmauern; ich halte es aber verwerflich für alle Frontmauern, die der
Wirkung des Seewassers, der Ebbe und Fluth ausgesetzt sind, und würde selbst
eine Ziegelmauer mit Cement angeworfen jedem künstlichen Steine
vorziehen.“
Eine andere Art von Concrete wird in England erzeugt
durch eine uralte Manipulation, die man grouting nennt.
Es entstehen dadurch wahre Gußmauern, die gleichfalls schon im höchsten Alterthume
verwendet wurden.
Man legte nämlich bei den Mauern aus irregulären Steinen gebildet nur die Außenmauern
jeder Lage in Mörtel, füllte die Zwischenräume mit Steinen und Geschieben aus, und
goß dann flüssig gemachten Aetzkalk entweder mit oder ohne Sand gemengt hinein, der
alle leeren Räume ausfüllte und zuletzt die einzelnen Stücke zu einer sehr festen
Masse zusammen kittete. So schritt man dann mit einer neuen Lage in die Höhe, bis
die Mauer beendigt war.
Auch diese alte Art der Mauerung wurde in den neuesten Zeiten bei den größten Bauten
Englands aus Ziegelsteinen angewendet. Man macht nämlich auf dem Theil der vollendeten Mauern ein
Bett aus gewöhnlichem Mörtel und legt zuerst die Ziegelsteine der beiden äußern
Seiten darauf, so daß eine Art Canal in der Mitte offen bleibt; man gießt nun Wasser
über die Mauer, rührt dann den Mörtel mit so viel Wasser an, daß er ausgegossen
werden kann, und gießt ihn rasch auf die ohne Mörtel gelegten Ziegelsteine, so daß
er alle leeren Zwischenräume zwischen ihnen ausfüllt. Man hat nämlich häufig die
Bemerkung gemacht, daß bei vielen Mauern die verticalen
Fugen oft ohne allen Mörtel, also vollkommen trocken waren. Man sieht
leicht ein, daß auf diese Weise alle Fugen mit Mörtel ausgefüllt werden müssen, und
die Erfahrung hat gelehrt, daß dieser flüssige Mörtel alle verticalen Fugen mit
derselben Kraft verbindet, als der gewöhnliche die horizontalen Fugen.
Die Mauern des brittischen Museums sind durch den oft genannten Baumeister Sir Robert
Smirke in der eben beschriebenen Art mit Gußmörtel
hergestellt worden. Bei der wenigstens 2 1/2 Ziegelsteine dicken Mauer wurde jede
Lage mit Gußmörtel versehen, bei den schmälern Zwischenmauern wurde diese Operation
jedoch nur bei jeder dritten oder vierten Lage angewendet.
Zum Schlusse will ich noch von einer Art von Fugenmörtel, in England sehr häufig
angewendet, sprechen, da er dennoch für manchen Leser einiges Interesse haben
könnte.
Da in England die meisten Mauern gewöhnlich keinen Anwurf erhalten, so werden die
Steinfugen häufig und wohl am besten mit Cement herausgeputzt. In der Regel bedienen
sich indessen die Maurer eines Fugenmörtels (pointing
mortar) aus einem Theil Aetzkalk, 1 Theil Sand und 2 Theilen gesiebter
Steinkohlenasche, der sehr fest wird und der Fuge ein etwas dunkleres Ansehen
gibt.
Ein gewisser Martin aus Derbyshire erhielt im Jahre 1834 unterm 8. October ein Patent
auf eine Mischung aus Aetzkalk, schwefelsaurem Eisenoxydul und Potasche. In Blashfields Fabrik kostet der Bushel 4 Shilling; im Jahr
1836 erhielt auch Troughton ein Patent für künstliche
Steine.
Am meisten angewendet wird gegenwärtig Keene's Marmor-Cement, das im Jahre 1838 am 27. Februar für
Keene, Wyne und Greenwood
etc. patentirt wurde, das jedoch nur für Auskleidung innerer Räume gebraucht werden
kann, da seine Grundlage Gyps ist.
Es beruht auf der zuerst von Pauware angeregten Kunst, den
Gyps zu härten, indem man sein salinisches Wasser durch ein Salz ersetzt. Der Gyps wird nämlich gelinde gebrannt, bis er sein Wasser
verloren hat, und
dann in Tröge mit Alaunlösung geworfen. Wenn er sich vollgesogen hat, wird er noch
naß neuerdings in den Ofen gebracht und gebrannt. Die oben angeführte Firma, welche
ihr Portland-Cement in London bereitet, ist auch Eigenthümerin von Keene's Marble-Cement
geworden.
In Blashfields Fabrik kostet der Bushel 4 Shillinge und
die allerfeinste Sorte in John Bazley White's Fabrik beinahe 8 Shillinge.
Wahrscheinlich um mit Keene's
Cement nicht in Collision zu kommen, nahm Vincent Bellman
in London und Keating unterm 11. Februar 1846 ein Patent
auf sein Parian-Cement. Die Grundlage ist Gyps und
die Bereitung des Parian-Cementes beruht auf denselben Principien wie
Keene's Verfahren.
Indessen statt in Alaunlauge wirft er den seines Wassers durch Glühen beraubten Gyps
in eine Lösung von 5 Pfund Borax oder gar Boraxsäure in 6 Gallons Wasser, gemischt
mit einer Lösung von 5 Pfd. Weinstein in 6 Gallons Wasser. Wenn sich der Gyps
vollgesogen hat, werden die Gypsstücke noch naß in den Ofen gelegt, der so geheizt
ist, daß die Rothgluth bei Tage sichtbar ist. Nach 6 Stunden werden sie
herausgenommen und dann gemahlen.
Alle diese empirischen Vorschriften haben Elsner's Untersuchungen überflüssig gemacht, und der mehrerwähnte
Blashfield hat mehrere Clubhäuser in London mit einem
Gypsmarmor ausgekleidet, der, was Härte und Schönheit betrifft, vom Marmor selbst
kaum unterschieden werden kann, und einfach aus Gyps mit Leimwasser und ein wenig
schwefelsaurer Zinkoxydlösung zusammengesetzt
ist.
Anhang.Ueber die Theorie des Erstarrens (Anziehens) und Hartwerdens der Mörtel und
über den glänzenden Stucco der Alten.
Die Ursache der Erstarrung (des Anziehens) des Mörtels sowohl als des hydraulischen
Kalkes hat noch immer keine genügende Erklärung gesunden.
Die Chemie beschäftigt sich vorzüglich mit der Wirkung von Körpern auf einander, die
entweder durch Wasser oder Feuer in einen Zustand von vollkommener Flüssigkeit
versetzt sind. Corpora non agunt
nisi soluta ist der alte Wahlspruch aller Chemiker und bei allen Lehren
von chemischer Verwandtschaft wird dieser Flüssigkeitszustand der Körper
stillschweigend vorausgesetzt.
Vollkommene Verschiebbarkeit der Molecule, ohne Veränderung ihres gegenseitigen
Abstandes, also stabiles Gleichgewicht bloß in Beziehung auf die Entfernung der
Molecüle von einander, und nicht in Hinsicht auf ihre Position, sind Grundbedingung
des vollkommenen Flüssigkeitszustandes aller Körper, und
gelten auch in Beziehung auf den Zustand von vollkommenen Lösungen.
Der zweite Zustand, in welchem die Körper erscheinen, der Zustand der Festigkeit, hat für den Chemiker bei seinen Operationen nur
eine secundäre Bedeutung, und der dritte mittlere Zustand zwischen Flüssigkeit und
Festigkeit ist einer speciellen allgemeinen Aufmerksamkeit noch kaum gewürdigt
worden.
Er ist es aber gerade, wo das Verhalten der Körper nicht allein von der Stabilität
des Gleichgewichtes in Hinsicht auf die Entfernung der Molecüle von einander
abhängt, sondern wo sich der Einfluß der relativen Position der Molecule
gegeneinander geltend zu machen beginnt.
Berthollet, der in seinem berühmten Werke (1803) Essai de statique chimique zuerst die Erscheinungen
chemischer Verwandtschaftskräfte auf einfache mechanische Principien zurückzuführen
versuchte, und unbestreitbar darthat, daß die Intensität chemischer
Verbindungskräfte nicht allein von dem Grade der Verwandtschaft, sondern auch von
der Masse abhängt, betrachtete den Einfluß von Flüssigkeit und Festigkeit bloß in
Hinsicht auf die Verbindung einzelner Körper unter sich in bestimmten oder innerhalb
gewisser Gränzen in unbestimmten Verhältnissen, und es muß deßhalb noch eine Lehre
von den Verbindungen weicher Körper mit einander eine Staito-Chemie im Gegensatze zur Hygro-Chemie geschaffen werden, die namentlich für die Theorie der
chemischen Verbindungen, wie sie aus dem großen Laboratorium der Natur hervorgehen,
allein den Schlüssel liefern wird.
Es ist eine längst bekannte Thatsache, daß wenn man gewöhnlichen guten Mörtel in
dünnen Lagen auf einer Steinfläche ausbreitet, oder diesen gewöhnlichen Mörtel nur
mit größeren Steinbruchstücken oder auch Rollsteinen mengt, das Gemenge in wenigen
Minuten seine Ductilität verliert und erstarrt, was man in der technischen Sprache
in Deutschland anziehen, in England set (setting) nennt. Smeaton sagt sehr wahr: „Anziehen (setting) bezeichnet den ersten Schritt oder Grad des Erhärtens;
indessen bildet der Kalk, obwohl er seine Ductilität verloren hat, in diesem
Zustande eine sehr zerreibliche Substanz.“
Stört man den Zusammenhang des Mörtels in diesem Zustande, nachdem er nämlich
angezogen hat, so nimmt er seinen frühern Zusammenhang nicht mehr an, und er hat
deßhalb seine Bindekraft verloren. Ganz dasselbe findet beim hydraulischen Kalke
statt.
Es ist ebenso bekannt, daß als Sand jedes kleine Steinfragment von der Größe groben
Sandes gebraucht werden kann.
Die Römer bedienten sich zu dem glänzend Pointen Stucco, mit welchem sie ihre
Zimmerwände überzogen, bloß des gröblich gepulverten Kalkspathes, oder auch krystallinischen Marmors der in den Werkstätten der
Marmorarbeiter abfiel.
Vitruv gibt zur Verfertigung dieses Stucco-Mörtels
die einfache praktische Vorschrift, den Sumpfkalk so lange mit dem Kalkspathpulver
zu vermengen, bis er nicht mehr an der Kelle hängen bleibt. Dieß beginnt sich nach
meinen Versuchen zu zeigen, wenn man unter einen
Maaßtheil dicken Kalkbreies (gewöhnlichen Sumpfkalkes) gegen 3/4 Theile groben
Marmorsandes mengt. Die Gränze tritt bei zwei Theilen Marmorpulvers ein. Da ist der
Mörtel nach dem technischen Ausdrucke sehr kurz.
Vitruv's gibt im Capitel VI
Buch VII die Anweisung dreierlei Lagen von diesem Stuccomörtel über einander zu
legen. Die erste von dem gröbsten Marmorpulver, die zweite vom Mittlern und die
dritte von dem feinsten, wobei jede Lage vor dem Auftragen der neuen fest,
geschlagen (subactum) und wohl gerieben werden muß (Cap.
III), dieß alles aus dem Grunde, daß der Ueberzug nicht reiße und zuletzt einen
schönen Glanz annehme.
Bei den schönsten von mir untersuchten römischen und pompejanischen Stuccos konnte
ich indessen nur zwei Lagen wahrnehmen, eine gröbere dickere und eine äußerst dünne
feinere.
Nach meinen Versuchen ist ein Theil Marmorstaub das beste Verhältniß für den letzten
feinern Ueberzug.
Dieser eigentliche Stucco wurde noch auf einen Untergrund (arenatum) aufgetragen, der einsaugend wie die Ziegelsteine selbst war, und
gröblichen Meeressand statt des Marmorstaubes als Bestandtheil hat. Vitruv will sogar auch diesen wie den Marmorstucco aus
drei Lagen zusammengesetzt wissen. Statt des Meersandes kann man sich sehr wohl des
Ziegelsteinpulvers bedienen. 1 Maaßtheil Sumpfkalk mit 1 1/2 Maaßtheilen groben
Ziegelsteinpulvers geben nach meinen Erfahrungen auf einer einsaugenden Ziegelsteinmauer
einen sehr guten Grund; saugt die Mauer nicht gut, so muß man die Quantität des
Ziegelsteinpulvers vermehren, sonst scheidet sich etwas Wasser aus, und die
Oberfläche überzieht sich mit einer Kruste halb-kohlensauren Kalkes.
Auf einem der schönsten Ueberreste antiken römischen Stuccos, aus den Bädern des
Titus, ist die Dicke des groben Marmorstuccos 8 Millimet., die der obersten feinsten
Kruste 1 Millimet., denn es sind da nur zwei Lagen (coria). Die gröbsten Körner sind Kalkspath 1 1/2 Millimet. breit, 2
Millimet. lang; die häufigsten 1 Millimet. lang und breit, auch etwas weniges
größer. Dieser antike Stucco absorbirt Wasser auf der frischen Bruchfläche; hingegen
die mit dem feurigsten Zinnober bedeckte polirte Oberfläche absorbirt nicht allein
kein Wasser mehr, sondern wird nur schwer vom Wasser benetzt.
Daß hier zwischen Kalk und Kalkspath in der kurzen Zeit von 2 Minuten eine chemische
Verbindung vor sich gehe, ist nach dem gegenwärtigen Standpunkte unserer Kenntnisse
nicht denkbar; die Erklärung des Erstarrens muß also auf rein mechanischem Wege
geschehen.
Schon bei dem zähen Kalkbreie findet ein stabiles Gleichgewicht der Masse in
Beziehung auf die Entfernung der Molecüle von einander nicht mehr statt, allein es
wirkt hier auch stabiles Gleichgewicht in Beziehung auf die Position der Molecüle
Mit, und deßhalb ist die Verschiebbarkeit der Molecüle nicht mehr absolut
leicht.
Kommen nun die Anziehungskräfte fester Körper mit ins Spiel, bei denen Gleichgewicht
in Rücksicht auf Position vorherrschend ist, so wird das stabile Gleichgewicht, von
der Entfernung der Molecüle allein herrührend, das in dem zähen Kalkbrei an und für
sich nur mehr untergeordnet auftritt, durch die Berührung des festen Körpers mit der
durch die Masse vertheilten wenigen Flüssigkeit vollkommen aufgehoben und der Brei
erstarrt in dem Verhältnisse, in welchem die innigste Berührung der festen Flächen
mit dem Kalkbrei vollständig hergestellt ist. Darum vernichtet eine, in dem
Erstarrungsmomente hinzutretende, wenn auch nur geringe Wassermenge, die Erstarrung
ganz.
Beim Auftragen dieses Stuccos muß, wie bei jeder andern gröbern Sorte, der Stein auf
den man ihn trägt, vollkommen naß und vom Wasser durchzogen seyn. Es darf aber kein
überflüssiges Wasser vorhanden seyn, das den aufgetragenen Stucco verdünnt. In
diesem letzten Falle schwillt der aufgetragene Stucco auf, verliert beim Anziehen
sein körniges Ansehen, wird glatt, überzieht sich mit einer dichten glänzenden
Kalkfruste und springt dann an diesen Stellen in viele Stücke.
Der mechanischen Wirkung des festen Körpers im Innern des Stuccos kommt gar sehr äußere
mechanisch comprimirende Kraft zu Hülfe. Ja der gewöhnliche Anwurf hat seinen Namen
daher, weil er mittelst der Kelle mit Kraft auf die Mauer geschleudert oder geworfen
wird. Hydraulischer Mörtel bleibt nur haften, wenn er noch überdieß nach dem
Anwerfen mit der Kelle angedrückt wird. Darum erstarrt auch das Concrete rascher, wenn man es von einem Gerüste in den
Grund wirft, und gewöhnlicher Mörtel erstarrt in Fugen gegossen, weil sich der Kalk,
ehe er erstarrt, ausdehnt, und sich selbst gegen die Wände der Fuge drückt, was sich
beim hydraulischen Kalk gerade umgekehrt verhält. Deßhalb schreibt auch schon Vitruvius vor, um die glänzende Oberfläche des Stuccos
hervorzubringen, müsse man den Stucco während des Anziehens mit Stäben schlagen (baculorum subactionibus fundare soliditates) und wohl
reiben. Und wirklich erstarrt während dieses Reibens die Oberfläche rasch zu einer
beinahe spiegelglänzenden Kruste (wenn das Reiben nach Plinius mit glatten Steinen geschah) die zuletzt eine äußerst dünne Haut
kohlensauren Kalkes trägt und nun vom Wasser nicht mehr benetzt wird, so daß es nur
möglich ist, mit sehr zähen Farben auf diesen glatten Grund zu malen. Vitruv gibt im Cap. VI. Buch VII. die Vorschrift, die
letzte Schichte durch fleißiges Reiben (diligente tectoriorum
fricatione) zu glätten und dann erst die Farben aufzutragen, daß sie durch
diesen Grund schönen Glanz erhalten. Er prägt indessen im dritten Capitel dem Leser
wohl ein, daß die Farben noch auf die nasse Bekleidung (udo
tectorio) gelegt werden müssen, sonst läßt sie die Farben fahren, wenn sie
abgewischt wird.
Das Auftragen von Farben auf den geebneten, obwohl noch nassen Grund hat große
Schwierigkeiten. Trägt man die Farbe mit Wasser angerieben auf, so macht sie
entweder den bereits geglätteten Grund so flüssig, daß eine Politur unmöglich wird,
denn der Kalk des Grundes vermischt sich mit der Farbe und macht sie lichter und
unscheinbar. Ich trage deßhalb am liebsten die feingeriebenen Farben trocken
mittelst Baumwolle auf, und glätte dann die gefärbte Oberfläche. Auch hier darf man
wenn die Stelle fleckig wird, nicht mit Wasser nachhelfen oder nur höchst
vorsichtig, denn dann reibt sich die Farbe während des Glättens nur allzuleicht von
der benetzten Fläche weg und es erscheint der weiße Untergrund, auf welchem auch die
trockene Farbe schwer haftet.
Selbst wenn man die Oberfläche färbt ehe man sie polirt, wie dieß beim Stucco der
Römer fast immer der Fall war, so trägt man die Farbe am besten in Pulverform
mittelst Baumwolle oder dergleichen auf, denn rührt man die Farbe mit Wasser an, so reicht das Wasser
der Farbe hin die Oberfläche wieder flüssiger zu machen, und ihn am Erstarren zu
verhindern.
Auf einer bereits erstarrten nicht mehr einsaugenden Oberfläche zieht ein zweiter
Stucco-Auftrag nicht mehr an, so daß er sich glätten ließe. Die feinste
letzte Decke beim Stucco muß deßhalb auf den geebneten, jedoch noch nassen gröbern
Stucco aufgetragen und dann geglättet werden.
Zum Glätten, das erst beginnen darf, wenn der Stucco im Anziehen begriffen ist,
bedient man sich nach Plinius glatter Steine mit etwas
gewölbter Oberfläche, da beim Glätten nur ein kleiner Theil der geglätteten
Steinoberfläche wirken darf, denn eine ebene glatte Oberfläche saugt sich sehr rasch
am Steine fest, so daß man sie nicht mehr verschieben kann ohne den Stucco zu
zerreißen.
Ich bediente mich anfangs zum Glätten einer Leiste oder eines Lineals von
Spiegelglas, dessen einen Rand ich abrundete und polirte. Da mußte dann das Lineal
schief gehalten werden, so daß nur ein kleiner Theil des Randes die zu polirende
Stuccofläche berührte, und da gelang das Poliren am besten, wenn man das Lineal bloß
in einer Richtung führte, nämlich mit von sich abgewendetem polirendem Rande gegen
den Körper zu.
Die polirte Fläche beginnt nach dem Anziehen in einigen Tagen zu schwitzen, wenn man
den Stucco nicht zuvor festgearbeitet oder geschlagen hat, indem sich ein lichter
Thau von Kalkwasser ausscheidet und auf die Oberfläche legt, der vorsichtig
weggewischt werden muß, ehe er auftrocknet und die polirten Flächen mit einer
Kalkkruste überzieht.
Auf diese Weise sind alle Wände der Alten in den römischen Bädern in Herculanum und
Pompeji überzogen. Ihr Glanz ist nach der Methode, die wir so eben angegeben,
hervorgebracht und nicht durch Wachs. Ich habe überhaupt in ganz Italien nie Spuren
von sogenannter enkaustischer oder Wachsmalerei gefunden, denn die Gemälde in
Neapel, die man als Muster von enkaustischer Malerei anführte, waren erst in unsern
Zeiten zum Theil mit Sandarach-Firniß überzogen worden, um sie vor den
Einflüssen der Witterung zu schützen.
Obwohl alle Zimmer in den pompejanischen Häusern mit gefärbtem Stucco überzogen sind,
so findet man doch nur geglätteten Marmorstucco in den vornehmen Zimmern, und unter
diesen ist der weiße, rothe und gelbe Stucco der glänzendste. Der blaue mit Smalte
erlangt nie den Glanz der oben angegebenen Farben. Ich fand auch mehrere verschieden
gefärbte Anwürfe
oder auch bloß Anstriche übereinander, indem man z.B. ein
grünes oder blaues Zimmer in ein rothes verwandelt hatte.
Die Farben sind alle Kalkfarben, und will man auf den bereits geebneten Grund malen,
so muß man das Gemälde vollenden noch ehe der Grund hart geworden ist, und deßhalb
so schnell als möglich arbeiten. Man findet daher auch bei den alten pompejanischen
Gemälden, daß die Umrisse zu den Figuren mittelst eines stumpfen Griffels in den
noch weichen Grund eingedrückt, also nach unserer noch üblichen Weise durchpausirt
waren. Das Befestigungs- oder Bindemittel ist in allen bloß Kalk und wohl
auch eine geringe Quantität hydraulischen Kalkes. Die Farben sind dick aufgelegt,
aber alle brausen mit Säure betupft. Da der geglättete Grund sich nur schwer
befeuchten läßt, so würde sich mit bloßen Wasserfarben in der kecken kräftigen Weise
der Alten gar nicht malen lassen. Man muß sie deßhalb mit einem ätherischen Oele,
etwa Spicköl, oder einem zähen Firnisse anmachen; gewöhnlich gebrauchten die Alten
beim Ruß eine Art Gummi und Leim (glutinium).
Indessen auch mit Kalk und Cement befestigt halten die Farben nie so fest auf dem
gefärbten Grunde als die Farbe des Grundes selbst auf dem noch nassen Mörtel. Ich
fand, daß in Pompeji sich einige Farben mit Wasser aufweichen ließen, und Winckelmann und die Akademiker für die herkulanischen
Entdeckungen hatten mehrere Gemälde mit Wasser von den polirten Wänden
abgewaschen.
Der Staitochemie gehörte dann das Erhärten der hydraulischen Cemente unter Wasser an,
das auf der chemischen Wirkung zweier oder mehrerer teigartiger Körper aufeinander
besteht.
Die größere Dichtigkeit dieser chemischen Gebilde bedingt ihre Wirkung den flüssigen
Körpern gegenüber, und eben diese größere Dichtigkeit ist es, die größere Nähe der
Molecüle, welche eine im flüssigen Zustande oft schwache Verwandtschaft eines
Körpers zur prädominirenden steigert, so daß eine der stärksten Basen, das Kali, im
aufgelösten flüssigen Zustande der schwächeren Basis des Aetzkalks weichen muß, so
lange sich die letztere im größeren Dichtigkeitszustande befindet.
Tafeln