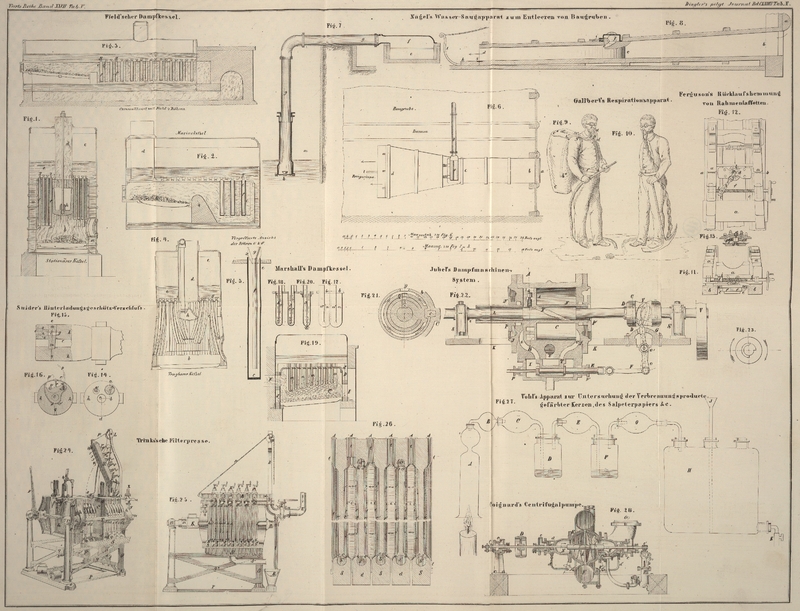| Titel: | Die Trinks'sche Filterpresse. |
| Fundstelle: | Band 177, Jahrgang 1865, Nr. LX., S. 278 |
| Download: | XML |
LX.
Die Trinks'sche
Filterpresse.
Mit Abbildungen auf Tab.
V.
Trinks'sche Filterpresse.
Im vorigen Jahrgange dieses Journals, Bd. CLXXIV S. 354, wurde die Abhandlung der
Civilingenieure Riedel und Kemnitz in Halle a. S. mitgetheilt, worin dieselben die von ihnen
construirten eisernen Filterpressen nach Danek'schem
System beschrieben und eine Geschichte der Filterpressen beifügten. Zur Ergänzung
entnehmen wir dem kürzlich erschienenen vierten „Jahresbericht über
Zuckerfabrication von Scheibler und Stammer“ (Breslau, 1865) das Nachfolgende
über die Trinks'sche Presse.
„Die Erfahrung hat nun ergeben, daß die in Filterpressen nach Needham-Danek'schem System gewonnenen
Schlammkuchen ungeachtet ihrer äußerlich harten und trockenen Beschaffenheit
immer noch eine nicht unbedeutende Menge Saft eingeschlossen enthalten, und daß
dieser Saft concentrirter ist, als er seyn müßte, wenn der Dampf oder das Wasser
den Kuchen wirklich gleichmäßig aussüßte, d.h. dessen ganze Masse in allen
Theilen durchdränge, durchfeuchtete und endlich den verdünnten Saft verdrängte. Das Nichteintreten einer so vollständigen
Einwirkung wird erklärlich, wenn man bedenkt, daß der einströmende Dampf oder
das Wasser zunächst nur die Kante des Schlammkuchens, und zwar nur einen kleinen
Theil derselben trifft, und daß er, um nach dem unteren Ausgange zu gelangen,
nicht den schwierigeren, weil mehr Widerstand bietenden Weg durch den Kuchen, sondern den leichteren Weg um den
Kuchen herum, dessen beide Außenflächen entlang, wählen, also nur letztere bis
auf eine geringe Tiefe berühren und durchfeuchten wird. In der That blieb das
Innere des Kuchens selbst dann unberührt, wenn man das Aussüßen dadurch
forcirte, daß man erst Wasser, dann Dampf einströmen und beide hinreichende Zeit
einwirken ließ.
Dieser Uebelstand führte sehr bald darauf, Pressen zu construiren, bei welchen
der Dampf nicht auf die Kante, sondern auf die volle Fläche des Kuchens einwirkt und letzteren behufs der Aussüßung nicht
der ganzen Länge nach von Oberkante zu Unterkante, sondern nur der ungleich
geringeren Dicke nach von einer Breitseite zur anderen zu durchdringen hat, und
bei denen ferner eine Umgehung des Kuchens seitens des Aussüßmittels (Dampf oder
Wasser) dadurch unmöglich gemacht wird, daß der Raum, wo letzteres in den Kuchen
eintritt, von dem
Raume, in welchem der durchgepreßte Saft abfließt, durch die Fläche des Kuchens
absolut getrennt ist, so daß Aussüßwasser oder Dampf keinen anderen Ausweg haben
und die Masse des Kuchens durchdringen müssen. Der
Maschinenfabrikant Trinks in Helmstädt führte zuerst
eine solche Filterpresse aus.Die folgende Beschreibung und beigegebene Zeichnung derselben nach dem
Artikel „Nachtrag zur Zuckerfabrication“ im Handwörterbuch der Chemie (1865), Bd. IX S.
1177 ff. deren Wirksamkeit sowohl durch ihre Arbeitsergebnisse im Großen, als
auch durch zahlreiche vergleichende Versuche als eine dem angestrebten Zwecke
vollständig entsprechende, die der Needham-Danek'schen Presse übertreffende erkannt wurde. Man
erhielt z.B. bei Versuchen in einer Braunschweiger Zuckerfabrik aus 12 in der
Needham-Danek'schen Presse völlig
erschöpften Schlammkuchen mittelst der Trinks'schen
Presse noch 34 Liter Saft von circa 6 Proc.
Zuckergehalt, und fand im Allgemeinen den Wassergehalt der Trinks'schen Kuchen zu durchschnittlich 26 Proc., den der Danek'schen dagegen nicht unter 33 Procent.
Die Fig.
24–26 zeigen die Trinks'sche Presse: Fig. 24
perspectivische Ansicht der vollständigen Presse; Fig. 25 senkrechter
Durchschnitt der ganzen Presse ohne Tucheinlage und
Schlammfüllung; Fig. 26 senkrechter Durchschnitt einzelner Kammern im vergrößerten
Maaßstabe, mit Tucheinlage und Schlammfüllung.
Sie ist ganz von Eisen construirt. Man erkennt leicht, daß ihre Haupttheile und
deren Anordnung im Allgemeinen nicht wesentlich von der Needham-Danek'schen Presse verschieden sind. Die Grundplatte
P mit den durch die Stäbe q, q verbundenen Säulen C, C und Füßen G, G, dem Holme h' und
den in diesen eingekeilten runden Tragbalken T, T
bilden das feste Gestell der Presse. Auf T, T hängen
mittelst der Handgriffe g, g verschiebbar die
Preßplatten s, d, s, d, welche durch den ebenfalls
verschiebbar auf T hängenden Holm h mittelst Anziehen der Muttern m, m gegen den festen Holm h' gepreßt werden können. Jede der Preßplatten d und s hat gerade wie bei der Danek'schen Presse eine circa 3/4 Zoll breite Vertiefung i'' mit
Cannelirungen r, r und r',
r', so daß je zwei aneinander gepreßte Platten eine 1 1/2 Zoll breite
Höhlung i (Fig. 26), die
„Preßkammer,“ einschließen; welche durch die Oeffnung
A mit R, dem
Schlammzuführungsrohre, in (durch Ventile v, v
abschließbarer) Verbindung steht. Die cannelirten Wände r, r und r', r' der Preßkammern sind
bekleidet 1) mit einem sehr feinmaschigen Messingdrahtsiebe i', welches mittelst Einfalzung befestigt ist und ein für
alle Mal sitzen bleibt;Auch hier bekanntlich in jüngster Zeit wegfallend. 2) darüber mit dem Tuche t, welches neben
seiner Function als filtrirende Fläche innerhalb der Kammern zugleich letztere
nach Außen abschließt, indem es sich beim Anziehen der Presse rings um die
Kammer zwischen die vortretenden Rahmen der Platten s, d,
s, d dichtend einklemmt. Behufs der Dichtung zwischen den oberen
Kammeröffnungen A, A (mit Zahlen 1–12
bezeichnet) und den Oeffnungen 1, 2, 3.. des Rohres R (Fig. 24) wird zwischen beide eine dicke, der Unterfläche von R congruente Gummiplatte mit 12 über die 12
Oeffnungen A passenden Löchern gelegt und durch den
Druck des schweren, überdieß durch b aufgeschraubten
Rohres R fest angepreßt.
Im ersten Stadium der Arbeit ist nun die Wirkungsweise der Trinks'schen Presse ganz wie bei der Needham-Danek'schen.
Sind sämmtliche Preßtücher eingehängt (jedes Tuch hat zu dem Zwecke ein Loch, das
über den Rohrstutzen u' paßt), darauf die Kammern
zusammengepreßt, auch das vierkantige Rohr R
heruntergelassen und mittelst der Schraubenbügel b,
b auf der Oberfläche der Preßplatten befestigt, so läßt man durch
Oeffnen der Ventile v, v und des Hahnes Z durch das Rohr Z', das
Steigrohr des Schlammmontejus, den Schlamm einströmen und die Filtration
beginnen. Der durch A, A in der in Fig. 24 durch Pfeile
angedeuteten Richtung eintretende Schlamm wird, den Raum i der Kammer erfüllend, gegen die Tuchflächen t, t gepreßt, sein Saftinhalt nach beiden Seiten durch Tuch-
und Siebfläche gedrückt, während der feste Schlammkuchen zurückbleibt. Der
durchgepreßte Saft rinnt in den Cannelirungen r, r
und r', r' hinunter, durch die Löcher e, e und o, o in die
Canäle s', s' und d', d'
um durch die auf beiden Seiten angebrachten Hähne d⁴, d⁴ und s'', s'' in die Sammelrinne S und von da durch S' abzulaufen.
Sobald die Hähne d⁴ und s'' nicht mehr laufen, also die Preßkammern ganz mit festem Schlamm
gefüllt sind, schließt man die Ventile v, v und den
Hahn z' und beginnt mit dem zweitem Stadium der
Arbeit, der Aussüßoperation, die sich wesentlich von der bei der Danek'schen Presse beschriebenen unterscheidet und
welche eben das Eigenthümliche und Vortheilhafte des Trinks'schen Verfahrens ausmacht. Der aussüßende Dampf tritt nicht wie
sonst durch die oberen Schlammeinströmungsöffnungen A,
A in die Kammern, sondern mittelst folgender Einrichtung auf der einen
Breitseite jedes Kuchens ein. Sämmtliche Preßrahmen rahmen und Holme sind zu dem
Zwecke oben in der Richtung vom Hahne u nach dem
Rohre W durchbohrt, so daß die Hähne u (ein Dreiweghahn) und W', wenn die Presse geschlossen ist, mittelst eines die Preßplatten
durchziehenden Canals u, W mit einander
communiciren. Von diesem Canale u, W führen
horizontal und rechtwinkelig Seitencanäle d'', d''
ab, im oberen Theile der Preßrahmen entlang, aber nicht in jedem, sondern
abwechselnd in dem je zweiten Rahmen, nämlich immer nur in den mit d bezeichneten, während die mit s bezeichneten nicht
durchbohrt sind.
Jeder Dampfcanal d'' steht durch Löcher o', o' nach beiden Seiten mit dem durch die
Cannelirungen r, r gebildeten schmalen freien Raume
hinter dem Siebe i' in Verbindung. Die unteren
anfangs zum Saftablauf mitbenutzten Austrittsöffnungen e,
e und d', d' dieses Raumes werden beim
Aussüßen durch Schließen sämmtlicher Hähne d⁴, d⁴ nach außen hin
abgesperrt, nur die Ausgänge der Canäle s', s', also
die an der anderen hier nicht sichtbaren Seite der Presse befindlichen Hähne,
bleiben noch für den Saftablauf offen. Sobald man jetzt durch u entweder directen Dampf aus x oder Retourdampf aus y in die Canäle d'', d'' treten läßt, dringt derselbe durch o', o' die Rinnen r, r
hinunter, erfüllt den Raum hinter dem Siebe i' und
durchdringt, als eine der Oberfläche des Schlammkuchens gleich große pressende Fläche, Tuch, Sieb und Kuchen in der
Richtung der in Fig. 26 gezeichneten Pfeile, treibt den Saftinhalt des letzteren in
die Cannelirungen r', r' der benachbarten
Preßplatte, in denen er hinab- und durch oo, s' und endlich s'' ausfließt. Eine Umgehung des Kuchens durch den Dampf, die man sich
nur an dessen Kanten denken könnte, findet in Wirklichkeit nicht statt, da
ringsherum das Tuch in doppelter Lage dichtet, überdieß der nur 1 Zoll starke
Kuchen dem Dampfdurchgange äußerst geringen Widerstand bietet.
„Dampfkammern“ nennt man in der Praxis die Räume r, r hinter dem Siebe, in welche beim Aussüßen der
Dampf tritt; „Saftkammern“ dagegen die entgegengesetzten
r', r', in welche der Saft getrieben wird; man
nennt auch wohl schlechtweg die Preßrahme d
Dampfkammern, die Preßrahme s Saftkammern.
Ein Reißen des Tuches ist hier weniger zu fürchten wie bei der Needham'schen Presse, da das Sieb i' demselben eine feste immer ebene Unterlage
gewährt, während es ohne diese Unterlage in die Rinnen der Preßkammern gedrückt
und dadurch eine bedeutende Reibung erleiden, auch den Saftabfluß erschweren
würde.
Um das Rohr R ausdämpfen zu können – was immer
vor Beginn der
Filtration geschehen muß – paßt dessen vorderste Oeffnung W'' auf die des Hahnes W'; der Dampf strömt dann aus u durch den
Canal u, W und den Hahn W' in das Rohr R und tritt durch den Hahn
a (Fig. 25) und den
Schlauch l aus – gewöhnlich in einen Eimer
E, um den mitgerissenen Schlamm aufzufangen.
Ueber die am Bocke B befestigte Rolle läuft die Kette
p, an welcher beim Neubeschicken der Presse
(Auswechseln der Preßtücher) das Rohr R in die Höhe
gezogen wird. F Hebel zum Anziehen der Muttern m, m, zwischen welche und dem Holm h die Hülsen k, k (Fig. 24)
zur Raumausfüllung gelegt werden. n, n
Schraubenköpfe der Balken T, T.
Im Allgemeinen hat man bemerkt, daß sich der nach der alten Scheidungsmethode
gewonnene Scheideschlamm wegen seiner zähen, gummigen und leichten
Beschaffenheit nicht so gut in der älteren Needham-Danek'schen Filterpresse behandeln läßt als der aus der
neuen (z.B. Jelinek'schen) Scheidungsart resultirende
Schlamm, der, weil größtentheils aus kohlensaurem Kalk bestehend, schwer,
pulveriger, „kürzer“ ist und sich weit leichter vom
anhängenden Safte trennt. In der Trinks'schen Presse
dagegen sollen sich beide Arten Schlamm gleich gut und schnell
verarbeiten.“
Tafeln