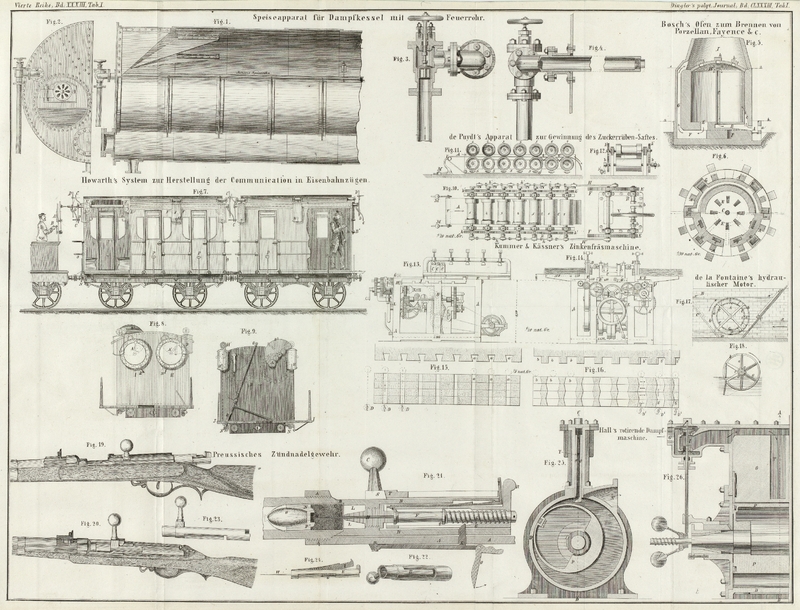| Titel: | Englische und amerikanische Mittheilungen über das preußische Zündnadelgewehr. |
| Fundstelle: | Band 183, Jahrgang 1867, Nr. V., S. 8 |
| Download: | XML |
V.
Englische und amerikanische Mittheilungen über
das preußische Zündnadelgewehr.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
Ueber das preußische Zündnadelgewehr.
Der Engineer vom
20. Juli und der Scientific American vom 1. September
1866 enthalten mit Abbildungen versehene Artikel über das preußische
Zündnadelgewehr, deren auszugsweise Mittheilung wenigstens einem Theile unserer
Leser nicht uninteressant seyn dürfte, obgleich die deutsche Fachliteratur bezüglich
dieses Gewehres schon eine sehr reichhaltige ist.
Die theils der einen, theils der anderen der erwähnten Zeitschriften entnommenen
Zeichnungen stellen in Fig. 19 und 20
Seitenansichten des zur
Patronenaufnahme in seinem Hinterladungsgewehr-Verschluß geöffneten,
beziehungsweise des geschlossenen und gespannten Gewehres dar, dessen combinirter
Verschluß- und Schloß-Mechanismus in seinen einzelnen Theilen verkürzt
durch die Figuren
21, 22, 23 und 24 versinnlicht ist, von denen die erstere das, mit Visir und Korn oben,
nach seiner Achsenrichtung hin vertical durchschnittene Rohr etc. als von links oben
her gesehen darstellt. – A bezeichnet in dieser
Figur 21
die in Wirklichkeit etwa 9,4 Zoll lange, sogenannte große
Hülse, welche das hintere Rohrende des Gewehres in ihrem sechskantigen
Kopfe mit Mutterschraubengewinde umfaßt und zugleich den Rahmen seines
Verschluß- und Schloßapparates bildet. Unten ist diese Hülse vermittelst
einer durch ihren Schweiftheil hindurch in das Abzugsblech des Gewehres gehenden
Schraube mit dessen Schafte verbunden und mehr nach vorn hin von einer für den
Stollen der Abzugsfeder K bestimmten vierkantigen
Oeffnung durchbrochen, oben aber dicht hinter ihrem sechskantigen Kopfe so
ausgehauen, daß dadurch ein bequemes Einführen der Patrone in den Lauf stattfinden
kann und zugleich ein rechts in die Hülsenwand eingreifendes Lager für den
Stollen- oder Warzen-Ansatz S entsteht,
welcher mit der Verschluß-Kammer B aus einem
Stücke bestehend und mit dem, oben eine Kugel bildend, in ihn eingeschobenen Griff oder Hebel
C versehen, im oberen Theile dieser großen Hülse dann
auch noch seine Führungsnuth findet, die rechtwinklich gebrochen, zum gänzlichen
Herausnehmen der Kammer und beziehungsweise zum Oeffnen des Verschlusses dient. Das
hiernach von dieser großen Hülse aufzunehmende eigentliche Verschlußstück oder die
sogenannte Kammer
B (Fig. 21, 22 und 23) bildet, ihren
Warzen- oder Stollenansatz S abgerechnet, einen
hohlen Cylinder, dessen Inneres aber durch das in ihn eingeschobene sogenannte Nadelröhrchen
H (Fig. 21) in zwei Theile
geschieden ist, und so nach vorn hin die sogenannte Luftkammer
L, nach hinten hin aber den Behälter für den
eigentlichen Gewehrschloß-Mechanismus oder das sogenannte Schlößchen bildet, dessen unten der Länge nach theilweise
aufgeschlitzte Federhülse
E (Fig. 21 u. 24) die den
Nadelbolzen
F umgebende und an dessen mittleren Ansatz Q sich oben anlehnende Spiralfeder
G in sich aufzunehmen hat, und in einem Lager ihrer
äußeren Mantelfläche die Sperrfeder
I trägt, welche vorn mit einem Zahne in die
Federhülsenwand eingelassen, nach hinten hin auf ihrer oberen Fläche zwei
Einkerbungen zeigt, die bei gespanntem und beziehungsweise in Ruhe gesetztem
Gewehrschlosse in einen ihrer Form entsprechenden Rand des oberen Theiles der
hinteren inneren Kammerwand eingreifen und so diese Functionen des Schlößchens
regeln. – Der
hintere Vorsprung oder die sogenannte Nase
R dieses Schlößchens dient theils zur bequemeren
Handhabung desselben und theils als Anlage für die Sperrfeder I, welche mit ihrem aufwärts stehenden hinteren Arme nebst dieser
Schlößchen-Nase in eine Classe des hinteren Kammerrandes eingreift. Ferner
ist die Kammer B in ihrer unteren Wandung mit einem
rechtwinklich geführten Längen- und beziehungsweise Quereinschnitte für den
Abzugsfederstollen K und vorn mit conischer Aussenkung
zum festen Anschlusse an den hinteren Rohrmund D
versehen. Der aus einem Stücke mit dieser Kammer B
bestehende Stollen, oder die sogen. Warze derselben, mit dem eingeschraubten Griff
oder Hebel C versehen (Fig. 21), ist mit seiner
hinteren Fläche genau an die vordere Fläche des Stollenlager-Ansatzes
T der großen Hülse angepaßt,
so daß dadurch und wegen Abschrägung dieser
Stollenlager-Ansatzfläche, ein immer stärker werdendes Auftreiben der
conischen Austrichterung des Kammermundes auf den Kegelmantel des hinteren
Rohrmundes eintritt, wenn der Griff oder Hebel C fest
zum Eindrücken dieses Stollens oder dieser Warze der Kammer B in das Stollenlager der großen Hülse
A gehandhabt wird. Das in die Kammer B eingeschraubte Nadelröhrchen H, welches, seiner Länge nach durchbohrt, zur Führung der Zündnadel dient,
ist in seinem vorderen, in die Luftkammer eintretenden Theile kegelförmig gestaltet,
unterhalb seiner Schraubengewinde aber zunächst mit einem diese Schraube
begrenzenden Teller, sowie mit einem Vierkant und einem darunter liegenden Cylinder
versehen, welcher letztere den Stoß des Nadelbolzens beim Abschießen des Gewehres
aufzunehmen hat. – Zur Milderung dieses Stoßes ist der vordere von den zwei
cylindrischen Ansätzen des Nadelbolzens mit einer Kautschuk- oder
Lederfütterung versehen, welche sich in der zu diesem Zwecke etwas ausgesenkten
Stirn desselben befindet, und beim Schusse zugleich einen dichteren Verschluß der
Nadelröhrchen-Durchbohrung herbeiführt. – Die cylindrischen
Ansatzscheiben des Nadelbolzens haben Heide, im Vollen gemessen, den lichten
Durchmesser des vorderen, weiteren Theiles der Nadelhülsen-Bohrung und sind
nach hinten mit, auf ihre Basis aufgesetzten abgestumpften Kegeln versehen, deren
Mantelfläche bei der vorderen Ansatzscheibe bis an die Cylinderwand des Nadelbolzens
und bei der hinteren Ansatzscheibe bis an denjenigen Nadelbolzenabsatz führt,
welcher zum Stützpunkte des vorderen Endes der Spiralfeder G dient, die, zum Tragen eines Gewichtes von 10 bis 11 Pfund befähigt,
sich mit ihrem hinteren Ende an den Boden der hinten engen cylindrisch ausgebohrten
Federhülse anlegt, und so den Federbolzen F aus diesem
für ihn durchbohrten Federhülsen-Boden des Schlößchens nach rückwärts hin
heraustreibt, wenn der
hintere cylindrische Nadelbolzenansatz von der hinteren Fläche des vorn
abgeschrägten Abzugsfeder-Stollens K gehalten und
dabei das Schlößchen, vermittelst Pressung gegen seine Nase R hin, nach vorn getrieben wird. Die aus Stahl gefertigte und zur
Nadelröhrchen-Bohrung genau passende Zündnadel
selbst endlich, ist in einen cylindrischen und nach vorn hin conoidisch verlaufenden
Schaft von Messing eingelöthet, welcher unten mit
einem durchlochten Kopf und Schraubengewinde zum Einschrauben in den Nadelbolzen
versehen ist, dessen centrale Ausbohrung an deren hinterem Ende das entsprechende
Muttergewinde trägt.
Zum Laden des Gewehres hat man also, bei geschlossenem
Zustande seines Verschlusses, zunächst die Sperrfeder I
niederzudrücken und so das Schlößchen mit Federhülse E
aus der Kammer B heraustreten zu lassen, hierauf diese
Kammer vermittelst des mit Kugelknopf versehenen Griffes C nach links zu schlagen und so weit zurückzuziehen bis ihr Stollen oder
ihre Warze S an das Knie des rechtwinklich gebrochenen
oberen Schlitzes der großen Hülse A anstößt und
eventuell die Patronenreste des vorhergegangenen Schusses zu beseitigen. –
Dann wird die neue Patrone, mit Kugel nach vorn, durch den rechts oben liegenden
Ausschnitt der großen Hülse A hin in das Patronenlager
des Rohres eingeführt und die Kammer B vermittelst des
Griffes C wieder so weit an den Rohrmund D herangeschoben, daß ihr Stollen oder ihre Warze S nach rechts gedreht und an der vorderen schiefen
Fläche des Ansatzstollens T der großen Hülse
niedergetrieben werden kann, was, hiernach ausgeführt, den conisch ausgesenkten
Kammermund zum festen Anschlusse an den äußerlich conisch abgedrehten Rohrmund
bringt. – Zum Spannen des Gewehres hat man dann
nur das nach hinten hin etwas herausstehende Schlößchen, vermittelst seiner Nase R, bis in den betreffenden Ausschnitt des hinteren
Randes der Kammer B vorzuschieben, so daß die hinterste
Ausfeilung der Sperrfeder I sich an die zugehörige
innere Leiste des oberen Kammermundes anlehnt und dadurch die um den Nadelbolzen F herumliegende Spiralfeder G gespannt wird, indem dabei der mittlere Scheibenansatz dieses
Nadelbolzens sich an den Abzugsfeder-Stollen K
anstemmt, welcher letztere erst vom Abzuge O, als einem
Winkelhebel der, wie aus der Figur ersichtlich, drei Grade von Pressung gestattet,
niedergedrückt werden muß, damit die Zündnadel vorschnellen und von dem
Nadelröhrchen H geführt, sowie durch die Pulverladung
L der Patrone hindurchfahrend, deren Zündpille P zum Feuergeben bringen kann, welche letztere in den
Boden des aus zusammengerolltem, beziehungsweise zusammengeleimtem Papiere
bestehenden und das „Langblei“
genannte Geschoß in sich
aufnehmenden sogenannten Zündspiegels N central
eingepreßt ist. – Dementsprechend läßt sich der Schloßmechanismus dieser zum
Schusse fertig gemachten Waffe auch sofort wieder in Ruhe
setzen, wenn man die Sperrfeder I des
Schlößchens niederdrückt und letztere hiernach bis zum Anstoßen der anderen
Sperrfeder-Rast an die im Inneren des Randes der Kammer B vorstehende Leiste zurücktreten läßt. –
Die noch weiter mitgetheilten Detail-Angaben über die Behandlung dieses
Gewehres, sowie Beschaffenheit und Herstellung seiner Munition, werden im Engineer als dem vortrefflichen Werke des Hrn. Hauptmann
v. Plönnies: „Das Zündnadelgewehr,“
entnommen bezeichnet; hinsichtlich des sogen. Zündpillen-Geheimnisses weist
dann jene Zeitschrift auf die längst bewirkte Lösung dieser Frage, beziehungsweise
die darauf bezüglichen und vom Referenten, als damaligem
Artillerie-Hauptmann, unter der Chiffre Dy zur
Aufnahme in jenes Werk gelieferten Veröffentlichungen hin, welche (später auch im
polytechn. Journal Bd. CLXXV S. 357
mitgetheilt) mit Bestimmtheit darthaten, daß das seit 1860 bei der Fabrication von
Percussions-Zündhütchen für das kleine Gewehr und seit 1862 zur Herstellung
von, weder dem Unempfindlichwerden, noch spontaner Zersetzung ihres Satzes
unterworfenen, vollkommen gebrauchssicheren Zündschrauben für die auf
Nadelstichzündung basirten Zündervorrichtungen der Granaten und Shrapnels des
gezogenen Geschützes mit bestem Erfolge vom Referenten verwendete muriatische Pulver
– bloß aus chlorsaurem Kali und Schwefelantimon bestehend, die in dem
Verhältnisse der Einheit (oder, wenn man das Pulver wegen sehr beschränkten
Aufnahmeraumes noch etwas kräftiger haben will, in dem von 5 chlorsaures Kali: 4
Schwefelantimon) zusammengemischt sind, – einen vollkommen kriegstüchtigen
Zündsatz für Frictions-Zündröhren, Percussions-Zünd- und
Sprenghütchen, sowie Nadelstich-Zündschrauben und Zündspiegel etc. abgibt und
somit als Universalmittel zur Herstellung leichtexplodirender Zündungen jeder Art in
der Kriegsfeuerwerkerei zu verwenden steht, wenn man bei seiner Anwendung nur immer
diejenigen Vorsichtsmaßregeln beobachtet, welche schon im Januar 1863 durch Nr. 4
der zu Darmstadt erscheinenden Allgemeinen Militär-Zeitung mitgetheilt
wurden.
In den betreffenden Schlußbetrachtungen wird vom Engineer
noch lobend hervorgehoben, daß dieses Zündnadelgewehr, wenn auch bezüglich seiner
Schloßtheile, z.B. beim Einschrauben des Nadelröhrchens in die Kammer, dem
Wiedergeraderichten verbogener und dem Ersatze gebrochener Nadeln, eine sehr
vorsichtige Behandlung erfordernd, seine Dauerhaftigkeit und Güte nun schon seit dem
Jahre 1848 bewährt habe;
dagegen glaubt der Scientific American in der
Nothwendigkeit, die Patronenreste vorhergegangener Schüsse des Zündnadelgewehres mit
dem Finger entfernen zu müssen, ferner in dem Entzünden der Pulverladung von vorn
her, dessen Vortheil ein sehr in Zweifel zu ziehender sey, sowie in einigen von ihm
als solche bezeichneten Mängeln des Schlößchens, als da sind: mangelnde Gasdichtheit
seines Nadelröhrchen-Verschlusses, leichtes Verbiegen mit Zerbrechen der
Nadel und eintretendem Sichsetzen der Spiralfeder, genügende Gründe für die von ihm
aufgestellte Behauptung zu finden, daß die großen Erfolge, welche mit diesem Gewehre
errungen wurden, weniger seiner Eigenschaft als Zündnadelgewehr, als vielmehr der
ihm zu Theil gewordenen geschickten Führung und Behandlung, sowie seiner Eigenschaft
als Hinterladungs-Gewehr beizumessen seyn dürften, in welcher letzteren
Beziehung jedoch die neueren amerikanischen Gewehre noch vorzüglicher seyen.
Cassel, im October 1866.
Darapsky, Major im
Generalstabe.
Tafeln