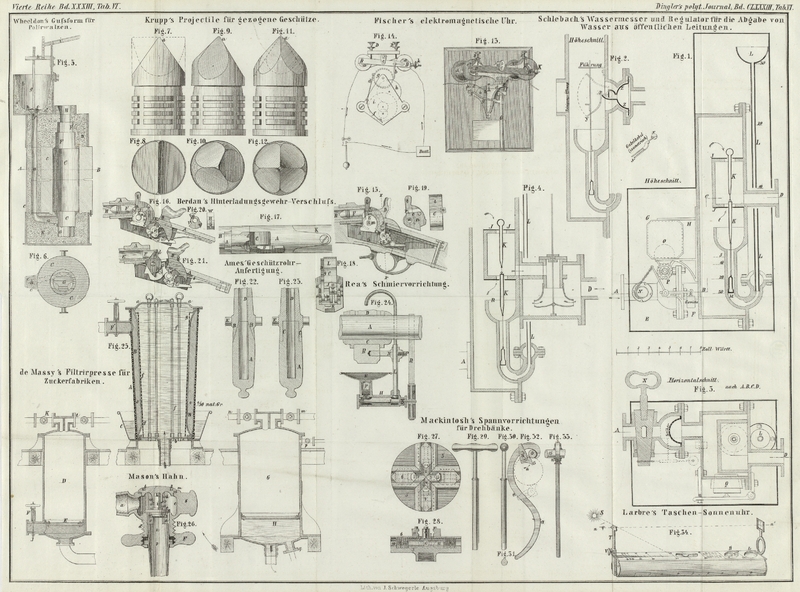| Titel: | Filtrirpresse von Robert de Massy in Paris. |
| Fundstelle: | Band 183, Jahrgang 1867, Nr. LXXII., S. 265 |
| Download: | XML |
LXXII.
Filtrirpresse von Robert de Massy in Paris.
Patentirt in Bayern am 18. März 1865. – Aus
dem bayerischen Kunst-
und Gewerbeblatt, 1866 S. 678.
Mit einer Abbildung auf Tab. VI.
de Massy's Filtrirpresse für Zuckerfabriken etc.
Bei den Pressen meines Systems lasse ich das Wasser oder die Gase unmittelbar auf die
zu pressende Substanz wirken, indem ich Zwischenglieder, die gewöhnlich gebraucht
werden, wie hydraulische Presse und dergleichen, um die Kraft überzuleiten,
auslasse.
Zu diesem Ende schalte ich eine Hülle oder Scheidewand zwischen dem Stoffe, der durch
Pressen Flüssigkeiten abgeben soll, und dem Agens (Wasser oder Luft), welches den
Druck ausübt, ein. Diese Scheidewände können aus allen Arten von Zeugen oder
plattenförmigen Stoffen bestehen; ich wähle aber vorzugsweise solche, welche am meisten
Elasticität besitzen. Ebenso können die Gefäße die verschiedenartigsten Formen
haben, so daß man diejenige auswählen kann, welche am meisten den Bedingungen des
Widerstandes im Verhältniß des hervorzubringenden Druckes entspricht. Als Beispiel
für die Construction einer Presse nach meinem Systeme wähle ich die in der
beigegebenen Zeichnung dargestellte, welche zur Saftgewinnung
aus Runkelrüben bestimmt ist.Eine Notiz über die Anwendung und Leistung dieses Apparates zur Verarbeitung
des Rübenbreies wurde im polytechn. Journal Bd. CLXXX S. 396 mitgetheilt.A. d. Red.
Der Apparat, Fig.
25, stellt äußerlich einen abgestumpften Kegel A aus starkem Eisenblech dar, der von Löchern mit einigen Centimetern
Durchmesser durchbohrt ist. Er ist innen mit einem metallenen Gewebe bekleidet, das
seinerseits wieder mit einem Gewebe bedeckt ist, welches fähig ist, als Filter zu
dienen. Dieser erste Kegel, welcher den Eisenbeschlag der Presse ausmacht, und sehr
solid auf einem passenden Gestell befestigt ist, nimmt in seinem Inneren einen
zweiten Conus auf, dessen Wand B dehnbar ist, und der
den geschlossenen Raum bildet, in welchem das pressende Agens unter den Bedingungen
wirkt, die ich schon oben auseinandergesetzt habe, und die ich jetzt speciell
erklären werde.
Dieser innere Kegel wird von einer sehr ausdehnbaren Wand B gebildet, wie schon gesagt, und zwar von Kautschuk von bedeutender
Dicke. Die äußersten Ränder der Wand B sind fest
verbunden mit zwei Platten a und b, so daß sie den Druck der pressenden Flüssigkeit, der nöthig ist,
aushalten können. Der ganze innere Kegel steht nun in der Umgebung A, mit der er an beiden Enden zusammenstößt, indem er
mit seinem unteren Ende ganz auf einem Bande e ruht,
durch Vermittelung einer elastischen Scheibe d, welche
er mit seinem Rande deckt und auf welcher er von selbst durch sein Gewicht
festgehalten ist.
Man operirt mit dem auf diese Weise construirten Apparat folgendermaßen:
Da der innere Conus B von kleinerem Durchmesser ist als
die Umgebung A, so entsteht ein ringförmiger Raum e zwischen ihnen, der die zu pressende Substanz
aufnimmt. Das Einführen der Substanz in den Raum e werde
ich später auseinandersetzen. Ich bringe die Preßflüssigkeit (angenommen es sey
Wasser) in den Kegel B, dann wird die Wand desselben
durch den Druck ihre Gestalt ändern, sie dehnt sich nach dem Raume e hin aus, und überträgt den Druck auf die sie umgebende
Substanz. Die ausgepreßte Flüssigkeit geht durch das Filter und die Löcher des Conus A und sammelt sich in einer Rinne c, welche am unteren Theil des Apparates angebracht ist.
Wenn man eine Pressung vorgenommen hat, öffnet man einen Abzugshahn um den Druck im
inneren Conus zu beseitigen, dann hebt man den Conus B
in die Höhe, um die Rückstände zu entfernen, welche frei durch die untere Basis des
Kegels A fallen können. Für die folgende Pressung läßt
man den Presser wieder herab auf seinen Platz, füllt den leeren Raum e wieder mit der zu behandelnden Substanz, läßt wieder
den Druck des Wassers wirken, und so weiter wie früher. Ich muß darauf aufmerksam
machen, daß die Grund- und Deckplatte des Conus B
durch eine gewisse Anzahl Säulen f zusammengehalten
werden, die oben und unten durch Schraubenmuttern befestigt sind. Zwei dieser
Schraubenmuttern an der oberen Platte sind mit Handhaben versehen, um den Druckkegel
B bequem in die Höhe heben zu können, wie ich es
eben erklärt habe. Man bemerkt auch, daß der Kegel B in
seinem Inneren eine durchbrochene metallene Wand hat, die keinen anderen Zweck hat,
als die biegsame Wand zu unterstützen, wenn sie vor Anwendung des Druckes durch das
Gewicht der zu pressenden Substanz sich nach Innen auszubauchen strebt.
Ich will jetzt zur Beschreibung der Apparate übergehen, die ich anwende, um
einestheils die zu pressende Substanz, anderntheils die pressende Flüssigkeit in die
Presse einzubringen.
Der Kegel A steht durch eine starke Röhre in Verbindung
mit einem cylindrischen Recipienten D, in welchem sich
eine horizontale Scheidewand E befindet. Diese
Scheidewand, die im Recipienten auf- und abgeschoben werden kann, besteht aus
einer kreisförmigen Scheibe. Ihr Umfang ist mit einem biegsamen Ansatz (Leder)
versehen, der zur Dichtung dient.
Diese Scheidewand, eigentlich ein Kolben ohne Stange, hat zum Zweck, den Druck des
Dampfes, der von oben in den Recipienten einströmt, auf die einzufüllende Substanz
zu übertragen. Man vermeidet dabei die Uebelstände, welche allezeit entstehen,
sobald man den Dampf bei ähnlichen Apparaten direct auf die Masse wirken läßt, die
sich in einem fast teigigen Zustande befindet; in diesem Falle treibt nämlich der
Dampf nur die flüssigen Theile der Masse vorwärts und hüllt schließlich den festen
Rückstand ein, welcher dann nicht weiter getrieben werden kann. Durch die
Einschaltung der Scheidewand ist die Trennung der festen von den flüssigen Theilen
der Substanz nicht möglich, ebensowenig ein Vermischen derselben mit dem Dampf.
Der Recipient D ist mit zwei Röhren K und t (mit Hähnen)
versehen, von denen die
eine zum Einlassen des Dampfes, die andere zum Ablassen desselben dient. Am unteren
Ende befindet sich eine andere Röhre j, durch welche die
einzufüllende Substanz einströmt, wenn der Schutz F
aufgezogen wird, mit dem sie versehen ist.
Ich speise die Presse auf folgende Weise mit meinem Apparat:
Der Einleitungshahn K ist geschlossen, und der Ablaßhahn
t offen, um die Luft oder was vom Dampf, der bei der
vorhergehenden Operation gebraucht wurde, übrig blieb, ausströmen zu lassen. Ich
öffne den Schutz F und die Substanz strömt ein und
erfüllt den Recipienten, indem sie die Scheidewand E in
die Höhe treibt; ich schließe dann den Ablaßhahn, hebe den Schutz F' an dem Conus A auf, und
nachdem ich den Schutz F geschlossen habe, lasse ich den
Dampf in den Recipienten einströmen, indem ich den Hahn K öffne. Der Dampf drückt auf die Scheidewand, die Substanz wird vorwärts
getrieben und erfüllt den ringförmigen Raum e, der dem
Recipienten an Volumen gleich ist. Der Schutz F' wird
dann herabgelassen und die Operation des Pressens, wie ich sie oben schon
auseinandergesetzt habe, nimmt ihren Anfang.
Der zweite Apparat, mit dessen Hülfe ich den Druck im inneren Kegel B hervorbringe, ist in allen Punkten genau wie der
vorige.
Er besteht aus einem geschlossenen cylindrischen Recipienten G mit innerer Scheidewand H, die das Wasser
oder die pressende Flüssigkeit von dem bewegenden Dampf trennt, der in den
Recipienten einströmt.
Der Recipient ist oben mit zwei Röhren versehen, die eine m zum Einlassen, die andere n zum Auslassen
des Dampfes, wie beim vorigen Apparat; sein Boden ist mit einem Ansatze versehen, um
ihn mit einer langen und biegsamen Röhre verbinden zu können, die durch dasselbe
Mittel mit dem Conus B verbunden ist; endlich wird diese
Dampfpresse noch vervollständigt durch einen Hahn p zum
Austreiben von Wasser und Luft, und einen Röhrenansatz q, der zu dem Rohre, welches das nöthige Wasser dem Apparat zuführt, gehört,
und durch einen Hahn geschlossen werden kann.
Man sieht hiernach ein, wie der Dampf das ganze Volumen des im Recipienten
enthaltenen Wassers durch seinen Druck auf die Scheidewand H nach dem inneren Kegel B erhebt, und darauf
durch Vermittelung desselben Wassers und der biegsamen Wand B seinen ganzen Druck auf die zu pressende Substanz überführt.
Wenn die Pressung vollendet ist, öffnet man den Ablaßhahn n; der Dampf der jetzt austreten kann, entlastet die Scheidewand H, so daß sie dem hydrostatischen Drucke des Wassers
weichen kann, welches den Kegel B verläßt, und in den
Recipienten zurückkehrt. Jetzt kann man den Conus B herausnehmen, um
die Rückstände aus der Presse zu entfernen. Zu dieser Operation dient die bedeutende
Länge des biegsamen Rohres, weil dabei kein Auseinandernehmen des Apparates nöthig
ist.
Ich muß bemerken, daß ich bei Anwendung von Dampf als eigentlichen Motor der Pressung
auch seine Expansion benutzen werde, so daß die Pressung wirklich methodisch und
progressiv ausgeführt wird, wobei eine bedeutende Ersparniß an Brennmaterial
stattfindet, da derselbe Dampf nach und nach für mehrere Apparate benutzt wird. Ich
erkläre dieß deutlicher:
Nehmen wir z.B. an, daß in demselben Arbeitsraum vier solcher mit Rübenbrei gefüllter
Apparate aufgestellt sind; ferner daß der Dampf aus dem Dampfkessel mit 18–20
Atmosphären Spannung kommt, und daß außer den directen Dampfzuleitungen die
dampferfüllten Räume der einzelnen Apparate unter einander in Communication gesetzt
werden können, mittelst angebrachter Hähne oder Ventile, so kann der Dampf nach
einander aus einem Apparat in den anderen eingelassen werden, und nachdem er
zunächst in dem ersten seine volle Wirkung ausgeübt, im zweiten Apparat eine etwas
geringere, im dritten eine noch geringere Pressung bewirken, und im letzten den Rest
seiner effectiven Druckkraft nutzbar machen.
So geht derselbe Dampf, aus dem Kessel kommend, nach einander durch die verschiedenen
Apparate, indem seine Spannung abnimmt und damit seine Druckkraft sich
vermindert.
Es ist natürlich, daß der so abgespannte Dampf in dem letzten Apparat nur einen
vielleicht 3 oder 4 Atmosphären entsprechenden Druck ausüben wird; dieser Druck
reicht indessen für den Anfang der Operation aus, denn der ganz und gar mit Saft
erfüllte Rübenbrei gibt sehr leicht auch ohne kräftigen Druck einen Theil desselben
ab.
Auch muß ich bemerken, was leicht aus der Zeichnung zu erkennen ist, daß meine
Apparate so construirt werden können, daß sie mit ihrem oberen Rand am Gebälk oder
auf irgend eine andere Weise aufgehängt werden können, statt sie mit ihrem unteren
Theil auf den Boden zu stellen. Diese Einrichtung hätte den Vorzug, daß dabei der
darüberliegende Raum ganz frei bleibt, so daß die Bedienung der Apparate
außerordentlich erleichtert wird, eine wichtige Rücksicht für Zuckerfabriken, wo die
einzelnen Operationen möglichst schnell aufeinander folgen müssen, die Handarbeit
also auf die einfachsten Vorrichtungen beschränkt werden muß.
Es besteht daher diese Erfindung darin, daß ich fabrikmäßig das Wasser und die Gase
unmittelbar anwende, um verschiedene Stoffe zu pressen, indem ich zwischen die zu pressende Substanz und
das Druck ausübende Agens ein Gewebe, eine Platte, oder irgend einen biegsamen und
undurchdringlichen Körper einschalte. Ich habe hier die conische Form gewählt, nur
weil sie mir bei der Anwendung in einer Zuckerfabrik sehr handlich erscheint.
Indem ich mein System ausdehne, kann ich auf gleiche Weise den Apparat anordnen, um
im geschlossenen Gefäße zu operiren. In diesem Falle ist das Preßwerkzeug eine Art
Blase, die zuvörderst in dieses Gefäß gethan wird. Man bläht sie auf, indem man
unter Druck die Preßflüssigkeit durch eine Röhre in sie eintreten läßt, welche mit
einem Druckapparat in Verbindung steht. Dieser Druckapparat kann entweder der seyn,
den ich speciell hier beschrieben habe, oder irgend ein anderer, z.B. eine
Pumpe.
Tafeln