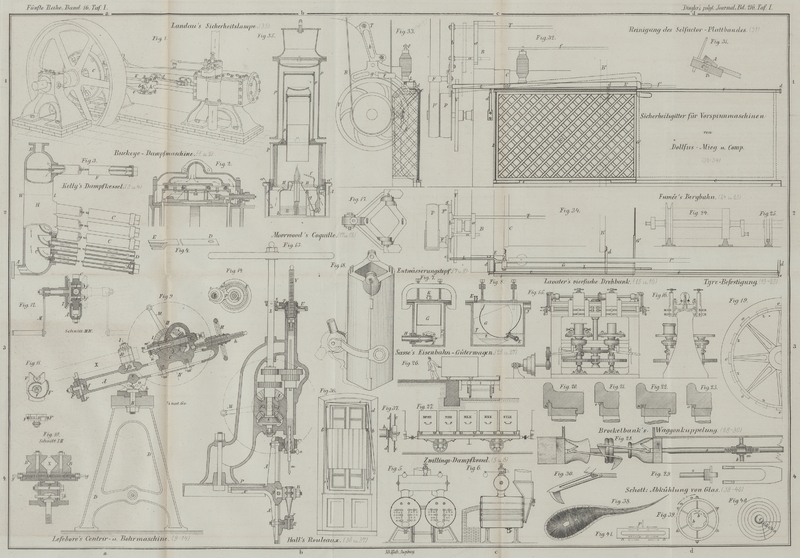| Titel: | Miscellen. |
| Fundstelle: | Band 216, Jahrgang 1875, Nr. , S. 282 |
| Download: | XML |
Miscellen.
Miscellen.
Hydraulischer Motor für Orgelgebläse.
Engineer empfiehlt in einer seiner jüngsten Nummern
(April 1785 S. 260) einen von Hubbard und Aller in Brooklyn (Amerika) patentirten Wassermotor, der
sich auch seiner Einfachheit und sicheren Functionirung halber vorzüglich zum
Antrieb der Blasebälge von Orgeln eignen soll. In diesem Falle wird dann in der
Druckleitung ein Hahn eingeschaltet, welcher von den gefüllten Blasebälgen gesperrt
gehalten wird, beim
Entleeren derselben sich allmälig öffnet und die Maschine in Gang treten und frische
Luft zuführen läßt. Interessant und neu bei diesem Maschinchen ist nur die
selbstthätige Steuerung, welche mit Vermeidung aller äußeren Steuerungstheile und
ohne Federn und Ventile durch zwei Schlitze in der Kolbenstange in Thätigkeit
gesetzt wird und zwar auf folgende Weise. Der Vertheilungsschieber ist als
Rundschieber vollkommen entlastet in einem cylindrischen Gehäuse eingeschlossen
derart, daß zu seiner abwechselnden Verschiebung nur eine ganz geringe Kraft
erforderlich ist; dieselbe wird dadurch erhalten, daß hinter eines der beiden Enden
des Kolbenschiebers am Ende des Hubes einen Moment lang frisches Druckwasser
zugelassen wird. Hat nämlich der Kolben nahezu das Ende seines Hubes erreicht, so
kommt ein durch die Kolbenstange gebohrter Längsschlitz in das nach innen
fortgesetzte Ende der Stopfbüchse und stellt hier, ähnlich dem Wirbel eines Hahnes,
die Verbindung her zwischen einer zum Kolbenschieber führenden Bohrung und einer
zweiten, diametral gegenüberstehenden Bohrung, welche mit der Druckleitung
communicirt. Hierdurch wird der Schieber umgesteuert, der Kolben geht zurück, und
nun ist die Communication der beiden erwähnten Bohrungen durch den vollen
Querschnitt der Kolbenstange unterbrochen, bis endlich am anderen Ende des Cylinders
ein zweiter Schlitz in der nach rückwärts fortgesetzten Kolbenstange Druckwasser
hinter das andere Ende des Kolbenschiebers zuläßt und denselben wieder in seine
frühere Lage zurückbringt.
Boulton's Röhrenkessel.
Dieser Kessel ist im Engineer, April 1875 S. 261,
illustrirt und soll nach unserer Quelle schon vielfach bei schmalspurigen
Locomotiven sowie bei Locomobilen mit Erfolg angewendet sein. Er besteht aus einem
cylindrischen Mantel mit eingesetztem Heizrohre, das an seinem vorderen Ende zur
Aufnahme des Rostes dient, hinter dem Rost aber von quergestellten Heizröhren
durchzogen ist. Dieselben sind in zwei abwechselnd entgegengesetzten Lagen unter ca.
30° Neigung gegen die Horizontale eingezogen, haben 38 Mm. Durchmesser und
sind mit Zwischenräumen von 20 Mm. nebeneinander angeordnet. Auf diese Weise ist
eine äußerst günstige Ausnützung der Heizfläche erzielt, indem der Zug der
abströmenden Gase durch die quergestellten Rohre fortwährend unterbrochen und
genöthigt wird, den größten Theil seiner Wärme abzugeben. Die Reinigung der Röhren
auf ihrer inneren Fläche von Kesselstein, obwohl sich derselbe hier in Folge der
raschen Circulation nur mäßig ansetzen dürfte, ist nach Herausnehmen des Heizrohres
— durch Lösung zweier Schraubenverbindungen — leicht zu erzielen;
unmöglich dagegen ist die Reinigung der Röhren von außen, wo sich jedenfalls bald
eine dichte Rußkruste bilden wird. Wenn dagegen der Erfinder behauptet, daß
hierdurch nie Schwierigkeiten entstehen könnten, weil der angesetzte Ruß entweder
mitverbrannt oder durch den Zug herausgerissen werde, so dürfte er wohl durch die
Beobachtung des in den Siederöhren eines Locomotivkessels angesammelten Rußes eines
besseren — respective schlechteren belehrt werden.
R.
Mittel zur Verhinderung des Losdrehens von
Schraubenmuttern.
Um das Losewerden der Muttern bei Schraubenverbindungen, welche vielen
Erschütterungen ausgesetzt sind, möglichst zu verhüten, hat man die verschiedensten
Mittel in Vorschlag gebracht — darunter Paget
(vergl. 1867 183 348) eine federnde Unterlagscheibe,
welche die fest niedergeschraubte Mutter mit großer Reibung gegen die Schraubengänge
andrückt. Zu dieser Kategorie von Sicherungen gehört die (im Journal of the Franklin Institute März 1875 S. 162 mitgetheilte) Winslow'sche elastische Unterlage für Schraubenmuttern,
die aus einer spiralförmig gewundenen Drahtfeder besteht,
welche unterhalb der Mutter eingelegt und durch Anziehen derselben zusammengepreßt
wird.
J.
Waggon-Reinigung durch Dampfkraft.
Vor einigen Wochen wurde auf der Great-Northern-Railway in England ein
Versuch mit einer neuen, vom Earl of Caithneß erfundenen Vorrichtung gemacht, die schon der
Curiosität halber einige Aufmerksamkeit verdient — dies aber umsomehr, als
die Resultate nach vorliegenden Berichten höchst befriedigend ausfielen.
Es handelt sich nämlich darum, die von Zeit zu Zeit unbedingt erforderliche äußere
Reinigung der Eisenbahnwaggons von Staub und Schmutz, welche mit Handarbeit
verrichtet, einen bedeutenden Zeit- und Geldaufwand verursacht, durch
Maschinenkraft zu verrichten, und dieses zu erreichen, wurden auf beiden Seiten
eines Seitengleises in drehbaren Rahmen zwei colossale Bürstwalzen (mit
Pferdehaaren) aufgestellt, und durch Riemen und Zahnräder von einer kleinen
4pferdigen Dampfmaschine aus in rasch rotirende Bewegung versetzt. Hierauf wird ein
zusammengestellter Zug der zu reinigenden Wagen langsam von einer Locomotive
vorgeschoben, um zwischen den rotirenden Bürsten, welche mittels eines langen
Handhebels gegen die Waggons angedrückt werden, durchzupassiren. Dabei werden die
Waggons vor und hinter den Bürsten von siebartig durchlochten Röhren mit Wasser
bespritzt. Auf diese Weise ward ein aus 12 Personenwagen verschiedener Art
bestehender Zug bei einer Durchfahrt in 4 Minuten vollkommen gereinigt, selbst mit
Einschluß der Fenster und aller vorstehenden Metallbestandtheile. Um Züge hin und
zurück zwischen den Bürsten schieben zu können, ist die Antriebsmaschine zu
reversiren.
Ersatz einer hölzernen Schachtzimmerung durch Gußeisen.
In einer Grube der Société du Couchant du Flénu in
Quaregnon (Arr. Mons, Belgien) gab ein 113 Meter tiefer, mit Holz ausgezimmerter
Schacht zu fortwährenden Reparaturen Anlaß. Die Zimmerung war in Gestalt eines
Zwölfeckes mit eingeschriebenem Kreise von 2,92 M. Durchmesser angeordnet, und aus
dem stärksten erhältlichen Eichenholz ausgeführt; trotzdem war sie nicht im Stande,
dem enormen äußeren Wasserdruck zu widerstehen, so daß fortwährend Auswechslungen
vorgenommen werden mußten.
Um diesen kostspieligen Reparaturen zu entgehen, kleidete man endlich den unteren
Theil des Schachtes mit gußeisernen Röhren aus, welche in Stutzen von 2,500 M.
Durchmesser und 1,225 M. Höhe übereinandergestellt und mit Bleiplatten abgedichtet
wurden. Diese Verkleidung, obwohl vollkommen undurchlässig, bewährte sich
gleichfalls nicht auf die Dauer, indem in Folge ungewöhnlicher Erschütterungen
außerhalb des Schachtes einer der Rohrstutzen einen Riß von 1,200 M. Länge (in
beiläufig horizontaler Richtung) erhielt, aus welchem nun das Wasser in großen
Mengen ausströmte. Nachdem sich der Riß fortwährend zu vergrößern strebte, so mußte
das Project der Abdichtung durch eine aufgeschraubte Kupferplatte bald aufgegeben
werden; ebensowenig konnte man daran denken, den schadhaften Stutzen durch einen
neuen zu ersetzen, weil in der Zwischenzeit der Wasserzufluß gar nicht zu bewältigen
gewesen wäre, und so entschloß man sich endlich zu folgendem (von der Revue universelle, 1875 S. 223 mitgetheilten) Mittel.
Die Rohrstutzen hatten zum Behufe der Verschraubung an beiden Enden einen 85 Mm. ins
Innere des Schachtes einspringenden Flansch, und zwischen diese zwei Flanschen der
gebrochenen Trommel ward nun durch daubenartige Gußsegmente (in 3 übereinander
stehenden Reihen von je 12 Stück) und zwischen getriebene Holzkeile ein innerer
Kranz gebildet, der ohne Schwierigkeit in zwei Tagen hergestellt war, absolut dicht
hielt und nie mehr einen Anstand ergeben hat.
R.
Thum's Ofen zum Verhütten von
Erzen, welche Zink, Blei und Silber enthalten.
Es gibt Erze, welche aus einem so innigen Gemenge von Zinkblende und Bleiglanz
bestehen, daß eine Trennung des letzteren auf mechanischem Wege sehr schwierig, wenn
nicht praktisch unmöglich ist. Hierher gehört z. B. das auf Anglesey bei Amlwich
unter dem Namen „Bluestone“ gewonnene Erz. Dasselbe enthält ca.
28 Proc. Zink, 11 Proc.
Blei mit 70 Unzen Silber in der Tonne und 1 bis 2 Proc. Kupfer. Trotz des nicht
unbedeutenden Gehaltes an edlem Metall ist der Werth solcher Erze ein sehr geringer.
Als Bleierze kann man sie nicht verschmelzen, und auch auf nassem Wege läßt sich
selten etwas damit anfangen; wenigstens ist die oft versuchte Extraction des Kupfers
und Silbers beim Bluestone, seiner stark kieseligen Begleitung wegen, bis jetzt
nicht gelungen.
Für solche Erze schlägt der Verf. einen (in der berg- und hüttenmännischen
Zeitung, 1875 Taf. I skizzirten) Ofen vor, welcher
die gleichzeitige Gewinnung von Zink und Blei, einschließlich des Silbers
ermöglicht. Derselbe ist auf beiden Längsseiten in der Weise der belgischen Zinköfen
zugestellt, und die Destillirröhren sind auf beiden Seiten offen. Im erhöht
liegenden Ende der Röhre wird die Vorlage eingesetzt, während sie an dem tiefer
liegenden Ende auf der entgegengesetzten Seite des Ofens sich räumen und chargiren
läßt. Ist die Charge eingetragen, so verschließt man das tiefer liegende Ende mit
einem Thonpfropfen. Das Zink destillirt alsdann in die Vorlage ab, und das Blei
sammelt sich in den tiefer liegenden Theilen der Röhre über dem Thonpfropfen an, von
wo es durch ein Stichloch, wenn nöthig, während des Destillationsprocesses entfernt
werden kann.
Man braucht bei dieser Einrichtung zum Zwecke des Ausräumens und Wiederbeschickens
der Röhren deren Vorlagen natürlich nicht erst abzunehmen, wodurch dem gewöhnlichen
belgischen Ofenbetriebe gegenüber, abgesehen von dem damit zu erzielenden
Zeitgewinne, die Dauer der Vorlagen selbst wesentlich erhöht und der Verlust an Zink
verringert wird.
Relative Wärmeleitungsfähigkeit verschiedener
Bodenarten.
Littrow (Wiener akademischer Anzeiger, 1875 S. 4) faßt die
Resultate seiner Untersuchungen über die relative Wärmeleitungsfähigkeit
verschiedener Bodenarten in folgenden Sätzen zusammen.
1) Den Haupteinfluß auf die Wärmeleitungsfähigkeit trockener Bodenarten übt ihre
mechanische Zusammensetzung, und zwar dermaßen, daß die durch das Mikroskop
feststellbare Qualität der abschlämmbaren Theile ganz unzweideutig ihre Wirkung
zeigt. Mit dem Steigen der Feinheit der Constitution des Bodens nimmt seine
Wärmeleitungsfähigkeit ab. Gehalt an organischer Substanz verringert die Leitung der
Wärme bedeutend.
2) Die petrographische und chemische Zusammensetzung verschwindet in ihrer Wirkung
neben der mechanischen fast ganz. Gehalt an Kalk und Magnesia scheint die
Wärmeleitungsfähigkeit zu verringern.
3) Naß leiten, wie vorauszusehen war, alle Bodenarten die Wärme besser als trocken,
da in ihren Zwischenräumen die Luft durch den besseren Leiter, Wasser, ersetzt
ist.
4) Die nassen Bodenarten leiten die Wärme besser als Wasser.
5) Die den Boden bildenden Materialien leiten somit an und für sich die Wärme besser
als Wasser.
6) Die Curven des Wärmeleitungsvermögens der trockenen Bodenarten fallen zwischen die
für Wasser und Luft erhaltene, während die der nassen Böden im wesentlichen jenseits
der für Wasser erhaltenen Curve zu liegen kommen, so daß die Wärmeleitungsfähigkeit
des Wassers den Uebergang bildet zwischen der der nassen und der trockenen
Bodenarten.
Die Beobachtungen von Becquerel (Comptes rendus, 1875 t. 80 p. 141) über das Eindringen
der Kälte in unbedeckten und mit Rasen versehenen Boden haben ergeben, daß bei
Lufttemperaturen von 0°bis — 12° in der Tiefe von 0,5 Meter
unter dem berasten Boden die Temperatur vom 23. December 1874 bis zum 1. Januar 1875
niemals auf 0° gesunken ist, während sie unter dem gleichen aber nackten
Boden bis — 5° herabging. Um Knollen, Wurzeln u. dgl. im Winter vor
Frost zu schützen, empfiehlt sich daher das Bedecken mit Rasen.
Verbesserung in der elektrischen Beleuchtung; von Ladyguine.
Am 29. December 1874 hat die kaiserl. Akademie in Petersburg an Ladyguine den Lomonossow-Preis verliehen
für wichtige Entdeckungen in der elektrischen Beleuchtung. In seinem Berichte darüber an
die Akademie erinnert der Director des physikalischen Central-Observatoriums
zunächst daran, daß man, seit Davy 1821 den galvanischen
Lichtbogen entdeckte, diese glänzendste künstliche Lichtquelle vielfach praktisch
verwendet habe; doch sei man sofort auch auf Schwierigkeiten gestoßen. Trotz
verwickelter Regulatoren für die Bewegung der verbrennenden Kohlenspitzen bleibe das
elektrische Kohlenlicht einem raschen Wechsel in seiner Stärke unterworfen; außerdem
sei es für das gewöhnliche Leben zu grell, eine Auflösung desselben in mehrere
weniger grell leuchtende Punkte aber scheine unmöglich; endlich sei seine Erzeugung
mittels galvanischer Batterien zu theuer. Allein seit man in neuester Zeit mittels
durch Dampfkraft getriebener magneto-elektrischer Maschinen das elektrische
Kohlenlicht bei gleicher Stärke zum dritten Theile des Preises vom Gaslicht
herzustellen gelernt habe, wurden die Anstrengungen verdoppelt, es gleichmäßiger zu
machen und nach Belieben in minder grelle leuchtende Punkte aufzulösen. Bei einer
Benützung des elektrischen Lichtes in Geißler'schen
Röhren habe sich dasselbe als zu schwach und zu veränderlich erwiesen. Besseren
Erfolg habe Ladyguine erreicht. Bekanntlich verdanke man
das elektrische Kohlenlicht blos der Eigenschaft des elektrischen Stromes, die von
ihm durchlaufenen Leiter zu erwärmen und zwar um so mehr, je größeren Widerstand sie
ihm entgegensetzen. Die hohe Leuchtkraft des gewöhnlichen elektrischen Kohlenlichtes
rühre von der sich zwischen den Kohlenspitzen befindenden, schlecht leitenden
Luftschicht her, welche sich stark erhitze und die Verbrennung der weißglühend
werdenden Kohlenspitzen veranlasse; wegen des großen Leitungswiderstandes dieser
Luftschicht, welchen nur ein sehr kräftiger Strom überwinden könne, müsse dieses
Licht so grell sein. Man könne zwar auch ohne Mithilfe eines Gases einen festen
Körper weißglühend machen, z. B. dünne Platindrähte; das so erzeugte Licht sei auch
schwächer und gleichmäßiger, und lasse sich nach Belieben verstärken und schwächen;
doch sei es niemals praktisch verwendet worden, weil es zu theuer sei und weil bei
größerer Lichtstärke der (nicht durchaus gleichartige) Platindraht leicht schmelze.
Daher ist Ladyguine auf den Gedanken gekommen, den
Platindraht durch dünne Stäbchen von einer dem Graphit nahe stehenden Kohle (Coaks),
also durch einen guten Leiter zu ersetzen. Die Kohle besitzt bei gleicher Temperatur
ein viel größeres Ausstrahlungsvermögen als das Platin; die Wärmecapacität des
Platins übertrifft die der fraglichen, gut leitenden Kohle beinahe um das doppelte,
so daß dieselbe Wärmemenge die Temperatur eines kleinen Stäbchens der Kohle beinahe
auf einen doppelt so hohen Grad erhöht, als die eines Platindrahtes von demselben
Rauminhalte. Außerdem ist der elektrische Leitungswiderstand der fraglichen Kohle
etwa 250 mal größer als der des Platins; das Kohlenstäbchen kann also 15 mal so dick
sein als ein gleich langer Platindraht, wenn der durchgehende Strom dieselbe
Wärmemenge liefern soll. Endlich ist bei der Kohle ein Schmelzen selbst bei der
größten Erhitzung nicht zu befürchten. Deshalb mußte die von Ladyguine vorgeschlagene Art der elektrischen Beleuchtung sich so
erfolgreich erweisen, als sie es bereits gethan hat. Den einzigen Uebelstand dabei,
nämlich daß sich die Kohle allmälig mit dem Sauerstoff der Luft verbindet und
verbrennt, hat der Erfinder bereits durch Einschließung der Kohle in ein luftdicht
geschlossenes Gläschen beseitigt, aus dessen Innerem der Sauerstoff in einfachster
Weise entfernt wird. (Nach der Revue universelle, 1875
S. 213.)
E—e.
Ueber den angeblichen Uebelstand, welchen die Anwendung von
Gefäßen aus böhmischem Glase bei Analysen und besonders in der Alkalimetrie
darbietet.
Truchot (Comptes rendus, t. 79 p. 1412) behauptet,
daß Gefäße aus böhmischem Glase in der Alkalimetrie nicht verwendet werden können,
da sie an die Flüssigkeiten Alkali abgeben. Benrath
(Glashütte, 1875 S. 120) kritisirt mit Recht die Naivität, mit welcher dieses
Urtheil abgegeben ist. Bekanntlich haben schon Emmerling
(1869 194 251), Pelouze (1856
142 121. 1865 178 134) und
Stas (1868 188 163)
nachgewiesen, daß die größere oder geringere Widerstandsfähigkeit des Glases gegen
Wasser u. dgl. nicht davon abhängt, ob es kali- oder natronhaltig ist, sondern von den
Mengenverhältnissen der Bestandtheile. Truchot's
oberflächliche Verurtheilung der aus Deutschland in Frankreich eingeführten Gläser
ist daher zurückzuweisen.
Chromsaures Eisenoxyd.
Nach Dr. Kayser (Mittheilungen
des bayerischen Gewerbemuseums zu Nürnberg, 1875 S. 42) besteht der
hellorangefarbene Niederschlag, welcher durch Fällung einer Lösung von neutralem
chromsaurem Kali mit einer angesäuerten Lösung von Eisenchlorid entsteht aus Fe2(CrO4)3 oder Fe2O3, 3CrO3. Verf. empfiehlt diese Verbindung, von Kletzinsky (1873 207 83) Sideringelb genannt, als billige, giftfreie Farbe.
Gewinnung des sogen. Guignet' schen
oder Smaragd-Grüns.
Dieses Pigment, an Farbe und Feuer dem Schweinfurter Grün sehr nahe stehend und dabei
nicht giftig, ist ein auf eine eigenthümliche Weise bereitetes Chromoxydhydrat. Man gewinnt dasselbe im Großen sehr leicht, indem man in
einem eigens dazu construirten Flammofen auf dem Herde bei Dunkelrothglühhitze ein
Gemenge von 3 Th. Borsäure mit 1 Th. doppelt-chromsaurem Kali
zusammenschmilzt. Die Masse bläht sich dabei auf, entwickelt viel Sauerstoffgas und
verwandelt sich schließlich in eine schön grüne Doppelverbindung von borsaurem
Chromoxydkali. Diese wird dann durch mehrmaliges Auswaschen mit siedendem Wasser in
Chromoxydhydrat und unauflösliches borsaures Kali zersetzt. Nach gehörigem
Auswaschen und aufs Feinste zerrieben, erscheint nunmehr dieses Chromoxyd in
schönster Farbennüance, deckt gut, ist luft- und lichtbeständig und wird nur
von siedenden concentrirten Säuren angegriffen. Im Kleinen läßt sich dieses Grün
auch recht gut in Porzellantiegeln bereiten. (Jahresbericht des phsikalischen
Vereins zu Frankfurt 1873/4.)
Pruneau's decorative Platten mit
imitirten Marmorgebilden.
Man nimmt eine Tafel aus Fenster- oder Spiegelglas und trägt auf diejenige
Fläche, welche der Berührung unzugänglich bleiben soll, die Farben des
nachzubildenden Objectes. Ebenso überzieht man die eine Seite einer anderen Tafel
aus Glas oder einem sonstigen Material mit einem gleichmäßigen Farbengrunde. Handelt
es sich um die Nachahmung eines durchscheinenden Gebildes, z. B. um den Durchschnitt
eines Onyx oder Achates, so erhalten beide Glastafeln ein identisches Muster.
Pruneau erzeugt die in Rede stehenden Gebilde, deren
Haltbarkeit und Unveränderlichkeit er verbürgt, mit Hilfe von Kalisalzen, welche
durch Metalloxyde verschiedenartig gefärbt sind. Sie werden theils mit dem Pinsel
aufgetragen, theils durch Bewerfen des präparirten Grundes hervorgebracht; in
gewissen Fällen sind mehrere Bäder hinter einander nothwendig. Auf diese Weise
erhält man ein naturgetreues Abbild der Farbentöne und Nüancirungen des Marmors. Die
Marmorirung wird sodann einer ziemlich hohen Temperatur ausgesetzt, um sie hart zu
machen und in eine Art dem Glase aufs innigste anhaftenden Kitt zu verwandeln.
Endlich werden beide Tafeln an den Rändern mit Mastixkitt oder mit einer Masse aus
arabischem Gummi und gepulvertem Alabaster zu einer einzigen Platte vereinigt.
Solche Platten, als Marmorimitation, kommen in einfachem Glas auf 16, in stärkerem
Glas auf 18, und in Spiegelglas auf 21 Franken per Quadratmeter. (Nach dem Bulletin de la Société d'Encouragement, April 1875 S.
166.)
P.
Wilde Vanille.
Wie bekannt, sind nach dem Genusse von Vanille-Eis wiederholt zahlreiche
Personen erkrankt, und es hat sich ungeachtet sorgfältigster chemischen
Untersuchungen bis jetzt nicht ermitteln lassen, welches die Ursache dieser
Erscheinung gewesen ist.
Aus Südamerika soll nun eine wilde Vanille in bedeutender Menge und zu sehr billigem
Preise eingeführt werden; diese könnte wohl die Vergiftungen veranlaßt haben, da die
Pflanze im wilden Zustande giftige Eigenschaften besitzen soll, welche durch die
Cultur sich verliert. Diese Angabe verdient nähere Prüfung.
W.
Butteruntersuchung.
Prof. Moser (Stummer's Ingenieur, 1875 S. 97) hat bei der
in Wien unter dem Namen „Sparbutter“ verkauften künstlichen
Butter einen weit niedrigeren Schmelzpunkt gefunden als bei der echten Butter.
Dasselbe gilt auch für das aus den Buttersorten durch Ausschmelzen auf dem
Warmtrichter gewonnene reine Fett oder „Schmalz“. In der
folgenden Tabelle sind die Resultate dieser Versuche zusammengestellt.
Buttersorte Nr.
Schmelzpunkt der Butter
Schmelzpunkt des Schmalzes
Wassergehalt der Butter
1
34°
30°
15,09
Proc.
2
36
34,5
nicht
3
37
36
bestimmt
4
34,5
24,5
20,1
Proc.
5
33
29
15,15
Proc.
6
36
29,5
14,9
Proc.
7
27
22,5
6,4
Proc.
8
31,7
31,5
7,77
Proc.
Nr. 1 und 2 sind die sogen. „Theebutter“ (aus süßem Rahm
dargestellt), und zwar wurde Nr. 1 im Sommer, Nr. 2 im Spätherbst bezogen. Nr. 3 ist
Butter, die im November 1874 aus schwach saurem Rahm im Laboratorium dargestellt
wurde. Die Milch stammte von Kühen der Wiener Versuchsstation, die ungefähr im
mittleren Lactationsstadium standen und mit Wiesen- und etwas Kleeheu unter
Beigabe von Roggenkleie gefüttert wurden. Nr. 4 ist Sommer- oder
Alpenweidebutter aus Kärnten. Nr. 5 und 6 sind Marktbutter, und zwar Nr. 5 erste,
Nr. 6 zweite Qualität. Nr. 7 ist künstliche, unter dem Namen
„Sparbutter“ in der Markthalle und im Consumverein
verkaufte Butter; Nr. 8 künstliche Butter aus Paris.
Um Butter auf einen Talggehalt zu untersuchen, machte sich
Kunstmann (Pharmaceutische Centralhalle 1875) aus
Drahtstücken Dochthalter, brachte in dieselben etwa 3 Mm. breite Dochtstückchen,
setzte sie in kleine Gläser, worin die betreffenden Butterfette erwärmt worden
waren, zündete die Dochte an, blies die Flammen nach 1 bis 2 Min. wieder aus und
prüfte die dann aus den Dochten aufsteigenden Dämpft auf ihren Geruch. Sofort war zu
erkennen, welche Butter rein und, welche verfälscht war. Versuche durch
Zusammenschmelzen reinen Butterfettes sowohl mit Rindertalg als auch mit Hammeltalg
und Schweinefett gaben dieselben Resultate; jedoch riecht der Dampf aus der Mischung
mit Schweinefett weniger intensiv. — Der Docht darf nicht zu stark sein,
damit er nicht kohlt und glimmt, sonst tritt der Geruch nicht so charakteristisch
hervor.
Berichtigung.
In Dr. Schott's Aufsatz „über Abkühlung des Glases“ in
diesem Bande S. 77 Z. 22 v. u. ist statt „dicker“ zu lesen:
„dieser“.
Tafeln