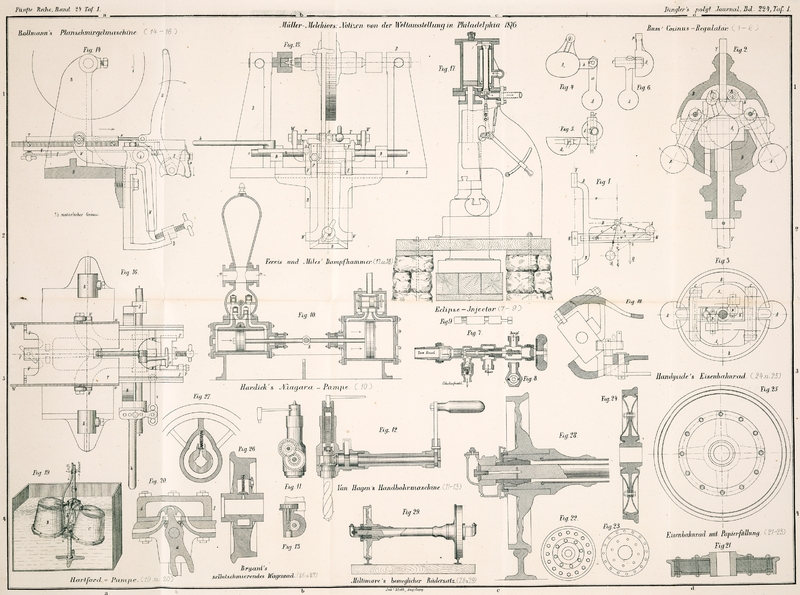| Titel: | Notizen von der Weltausstellung in Philadelphia 1876; von Ingenieur Müller-Melchiors |
| Fundstelle: | Band 224, Jahrgang 1877, Nr. , S. 121 |
| Download: | XML |
Notizen von der Weltausstellung in Philadelphia 1876; von Ingenieur
Müller-Melchiors
Mit Abbildungen auf Tafel
I.
(Schluß von S. 26 dieses Bandes.)
Müller-Melchiors, Notizen von der Weltausstellung in
Philadelphia 1876.
76. Planschmirgelmaschine von Bollmann
in Wien. (Fig. 14 bis 16 [a/1].)
Die bekannte Magdeburger Firma Schäffer und Budenberg hat zwei Planschmirgelmaschinen, Patent Bollmann, ausgestellt, welche ein neues Arbeitsprincip in
die Verwendung der Schmirgelscheibe einführen und aus diesem Grunde, sowie der
gelungenen constructiven Durchführung halber vollstes Interesse verdienen.
Während nämlich die bisher üblichen Schmirgelmaschinen entweder die Führung des zu
bearbeitenden Stückes völlig der Handgeschicklichkeit des Arbeiters überlassen, oder
anderseits das Arbeitsstück in gleicher Weise fest einspannen, wie dies bei einer
Drehbank oder Hobelmaschine geschieht, hat Bollmann bei
seinen Planschmirgelmaschinen einen elastischen Druck
eingeführt, welcher das Arbeitsstück gegen die Schmirgelscheibe preßt.
Selbstverständlich ist die Intensität dieses Druckes, sowie die Dicke der
abzuschleifenden Schichte genau regulirbar, und endlich ist noch Vorkehrung
getroffen, beim Rückgänge des Tisches das Arbeitsstück von der Schneidkante der
Schmirgelscheibe zu entfernen.
In dieser Weise wirken die beiden in Philadelphia ausgestellten Maschinen; die
einfachere derselben, zum Seitwärts- und Vorwärtssteuern von Hand
eingerichtet, ist in Fig. 14 bis 16
dargestellt; die Beschreibung der zweiten Ausstellungsmaschine mit vollständig
automatischem Gang möge einer spätern Gelegenheit vorbehalten bleiben. Aus den
Zeichnungen Fig.
14 bis 16 sind in Aufriß, Kreuzriß und Grundriß die wesentlichen Bestandtheile
der Bollmann'schen Handschmirgelmaschine ersichtlich: Der Ständer B welcher die durch Riemenantrieb bewegte
Schmirgelscheibe trägt, der Arbeitstisch T sammt seinem
Bewegungshebel
H, die Führung F des
Arbeitstisches und endlich der Winkelhebel W. Letzterer
dient dazu, die Aufwärtsbewegung des Tisches T zu
begrenzen, indem sein wagrechter Arm (Fig. 14 und 16)
beiderseits ausgebogen ist und hier zwei Stellschrauben trägt, gegen welche die
Führungsleisten des Tisches T anstoßen; gleichzeitig
stemmt sich der nach abwärts gerichtete Arm des Hebels W
gegen eine Stellschraube im Ständer B. Seinen
Drehungspunkt findet der Winkelhebel W auf einer Spindel
s, die in zwei Hülsen des Ständers B fest gelagert ist und außer W noch die Führung F des Arbeitstisches
trägt.
Mittels des Handhebels h und der in F eingreifenden Zugstange z
kann die Führung F und der von ihr umfaßte Winkelhebel
W auf der Spindel s hin
und her verschoben werden; zu diesem Zwecke ist auch der verticale Arm von W am untern Ende verbreitert, um bei allen Stellungen
die im Ständer B angebrachte Stellschraube berühren zu
können. Hiedurch ist die Querbewegung von W und F, sowie des auf der
Führung aufliegenden Arbeitstisches T erklärt.
Zur Längsbewegung von T und
des darauf eingespannten Arbeitsstückes dient der Hebel H, welcher in zwei Angüssen am vordern Ende der Führung F gelagert und mit dem Tische T durch die Zugstange x verbunden ist. Beim
Abwärtsbewegen von H im Sinne des Pfeiles der Figur 14
findet somit Vorwärtsgang des Tisches T statt, beim
Aufwärtsbewegen von H Rückgang; gleichzeitig damit tritt
die schon eingangs erwähnte Eigenthümlichkeit der Maschine auf, daß sie nur beim
Vorwärtsgange des Tisches schneidet.
Der Tisch T wird nämlich, wie aus Fig. 14 und 16
ersichtlich, durch eine Feder f von der Führung F abgehoben und gegen die Schmirgelscheibe mit einer
gewissen Kraft angepreßt, die sich einerseits durch Veränderung der Federspannung
beliebig reguliren läßt, anderseits jedoch in der Aufwärtsbewegung des Tisches durch
die Anschläge des Winkelhebels W eine unübersteigliche
Grenze findet. Dagegen kann sich der Tisch T sammt
seiner Führung F im Ruhezustande frei nach abwärts senken, da die Führung F mit der Spindel s drehbar aufgesetzt ist.
Sobald jedoch der Hebel H im Sinne des Pfeiles der Figur 14
bewegt wird, tritt am vordern Ende der Führung F eine
Kraft auf, welche die Führung im rechtsgängigen Sinne zu verdrehen sucht und daher
das linke Ende derselben sammt dem von der Feder f
aufwärts gepreßten Tische T der Schmirgelscheibe
zuführt. Diese Kraft wird dadurch hervorgebracht, daß der in F gelagerte Hebel H auf seiner Drehungsachse
eine Scheibe trägt, gegen welche eine an F befestigte
Feder p schleift, und es ist klar, daß, je stärker diese
Feder angespannt ist, eine desto größere Reibungscomponente im Sinne des Pfeiles der
Figur 14
nach abwärts wirkend auftritt und hierdurch die Wirkung der Tischfeder f erhöht. Beim Rückgänge des Hebels H dagegen wirkt die Reibungscomponente nach aufwärts; es
erfolgt eine Verdrehung der Führung F in linksgängigem
Sinne, und das Arbeitsstück bleibt von der Schmirgelscheibe entfernt, da die Feder
f den Tisch T nur auf
eine geringere Höhe zu heben vermag.
Die Arbeitsweise der Maschine bedarf nach dem hier Gesagten keiner weitern
Erörterung; selbstverständlich ist der Hinweis, daß die Spannung der beiden Federn
f und p stets der Natur
der jeweiligen Arbeit angepaßt werden muß, was mit Hilfe der Schrauben einfach
erfolgen kann und nur kurze Uebung erfordert. Die Maschine ist speciell für
Metallbearbeitung bestimmt und entspricht diesem Zweck in vollendeter Weise; zum
Schleifen gehärteter Eisen- und Stahlbestandtheile dürfte eine gewöhnliche
Schmirgelmaschine mit festen Führungen vorzuziehen sein.
77. Dampfhammer von Ferris und
Miles. (Holzschnitt und Fig. 17 und 18 [c/2].)
Von den ausgestellten Hammerconstructionen waren besonders die kleinern Sorten
schnellgehender Hämmer stark vertreten, unter diesen zahlreiche Frictionshämmer und
Federhämmer — der bekannte Federhammer von Shaw
und Justice (*1868 187 192)
1874 *213 194. *214 428), ein
ähnlich construirter Schwanzhammer (Palmer *1874 214 429), ein Luft-Federhammer (Hotchkiß * 1875 215 397. Vgl.
auch Browett * 1876 220 404)
u. a. Von Dampfhämmern speciell war kein einziger den Riesen der Wiener
Weltausstellung 1873 zu vergleichen, von Europa hatte überhaupt nur die englische
Firma B. und S. Massey ihre bekannten Dampfhämmer (* 1874
213 286) ausgestellt, von den wenigen amerikanischen
Ausstellern ist vor allen die Firma Ferris und Miles zu nennen.
Der von ihr ausgestellte Dampfhammer ist auf S. 124 in perspectivischer Ansicht, in
Fig. 17
und 18 im
Aufriß und Querschnitt durch die Kolbenstange gezeichnet; zunächst fällt hier die
schiefe Stellung des Hammerbärs und seiner Führungen gegenüber dem Hammergestelle
auf. Diese Anordnung wurde getroffen, um dem Arbeiter sowohl die lange, als die
schmale Seite der Hammerfläche verfügbar zu machen. Zu gleichem Zwecke hat Massey bekanntlich statt des kastenartigen Ständers zwei
getrennte Tragrippen gewählt, zwischen denen das Arbeitsstück in der einen Richtung
durchzuschieben ist; der Ständer von Ferris
und Miles ist jedoch gefälliger als auch solider und gibt für
die Hantirung des Arbeitsstückes größern Spielraum.
Textabbildung Bd. 224, S. 124
Die Steuerung zeigt nichts wesentlich Neues. Als Vertheilungsschieber dient ein
bewegliches Rohr, das außen von Kesseldampf umspült ist, im Innern mit dem
Dampfaustritt communicirt, und mit seinen erweiterten Enden in zwei Bohrungen
einspielt, in welche die Dampfcanäle des Cylinders münden. In der untersten
Stellung (Fig.
17) findet Anhub des Kolbens statt, bei der obern Stellung des
Schieberrohres Niedergang des Hammerbärs mit Oberdampf. Zur Bewegung des
Schiebers tritt eine mit ihm verbundene Stange aus dem Cylinder heraus und steht
hier mit einer Zugstange in Verbindung, die am einen Ende eines doppelarmigen
Hebels angreift, dessen anderes Ende mit seinem gebogenen Arm an einer schiefen
Nuth des Hammerbärs anliegt. Beim Anhub wird dieser Arm nach rechts und damit
das Schieberrohr nach aufwärts geschoben, bis der obere Dampfcanal frei wird;
bei dem dann stattfindenden Rückgänge sinkt der ganze Steuermechanismus, der
Bewegung des Hammerbärs folgend, nach abwärts, bis wieder die untere
Canalöffnung frei wird. Um den Hub zu reguliren, läßt sich der Drehungspunkt des
oben erwähnten doppelarmigen Hebels mittels eines Handhebels verstellen, in
dessen obern Arm der Drehzapfen des doppelarmigen Steuerhebels eingenietet
ist.
Hierdurch kann sowohl ein beliebig starker einzelner Schlag gegeben werden, als auch
die Einstellung auf selbstthätige Steuerung mit variabler Hubhöhe erfolgen.
Der ausgestellte Hammer hatte ein Bärgewicht von 315k und erfordert, wie aus Figur 17 ersichtlich,
eine selbstständige Fundamentirung der Chabotte; bemerkenswerth ist noch, daß die
Schieberstange ohne Stopfbüchse aus dem Schieberkasten austritt, was dadurch möglich
wird, daß sie nur von
expandirtem Ausströmungsdampfe umgeben ist. Die hierdurch erreichte leichte
Beweglichkeit des Steuermechanismus ist wesentlich für die gute Functionirung bei
raschem Gange.
78. Die Hartford-Pumpe.
(Fig. 19
und 20 [a/4].)
Außer den Vacuumpumpen (Bd. 223 S. 563) war noch ein anderes eigenthümliches
Pumpensystem von der „Hartford Pump Company“ in Hartford
(Conn.) ausgestellt, welches in Fig. 19 und 20 in Ansicht
und Querschnitt durch den Schieberkasten gezeichnet ist. Die Pumpe wird in dem
Wasserschachte aufgestellt, aus welchem die Förderung stattfinden soll und wirkt
somit nicht durch Saugen, sondern nur als Druckpumpe. Zum Heben des Wassers dient
jedoch kein Kolben, sondern es wird hierzu comprimirte Luft verwendet, welche in
einem eigenen Rohrstrange in den Schieberkasten A
eingeleitet wird, zur Seite des Druckrohres für das zu hebende Wasser (Fig. 19).
Insofern gleicht demnach die Arbeitsweise der Hartford-Pumpe vollständig den
sogen. Montejus (Safthebern), wie sie speciell in der Zuckerfabrikation so vielfach
angewendet sind, mit dem Unterschiede, daß selbstverständlich eine continuirliche
Action der Pumpe hergestellt sein muß. Zu diesem Zwecke besteht dieselbe aus zwei
Wasserbehältern B und C
(Fig.
19), welche um die Achse z schwingen können; diese
Achse ist an ihrem rückwärtigen Ende durchbohrt und steht mit dem Wasserdruckrohr in
Verbindung. Von der durchbohrten Achse gehen sowohl nach B als nach C Canäle, welche mit Druckklappen
verschlossen sind. Eine zweite Klappe am Boden jedes Wasserbehälters öffnet sich
nach innen, und endlich befindet sich am Deckel beiderseits ein dritter Canal, der
in den Schieberkasten A führt. Letzterer kann
gemeinschaftlich mit B und C
oscilliren; in Folge dessen ist das Rohr b, welches
demselben comprimirte Luft zuführt, durch einen biegsamen Kautschukschlauch mit der
Luftdruckleitung verbunden.
Im Schieberkasten endlich ist ein Muschelschieber enthalten (Fig. 20), dessen innere
Höhlung durch die Oeffnung o mit der freien Luft
communicirt. In der Stellung der Figur 20 tritt somit in
den rechten Wasserbehälter C comprimirte Luft ein,
während sie aus dem linken Behälter B unter der
Schiebermuschel hindurch entweichen kann. Sobald dies geschieht, öffnet sich die
Bodenklappe von B und läßt Wasser durch den Ueberdruck
der Wassersäule eintreten; bei C hingegen, das wir mit
Wasser gefüllt annehmen, bleibt die Bodenklappe geschlossen, und die Druckklappe
öffnet sich, welche mit dem hohlen Drehzapfen communicirt und so dem in C enthaltenen Wasser unter dem Einflusse der
comprimirten Luft das Aufsteigen in die Druckleitung gestattet. Dadurch leert sich C allmälig, während gleichzeitig B immer mehr mit Wasser angefüllt wird, endlich das Uebergewicht gewinnt
und eine Verdrehung des ganzen Systemes um die Achse z
nach links hervorbringt. Dabei rückt der Schieber im Kasten A. dadurch nach rechts, daß er mit einem doppelarmigen Hebel a verbunden ist, welcher in einen festen Arm des
Ständers eingreift; in Folge dieser Verschiebung wird nun comprimirte Luft nach
links eingelassen, von rechts ausgelassen und das in B
enthaltene Wasser in die Druckwasserleitung gepreßt.
Diese Pumpe soll sich in Amerika speciell für Haushaltungsbedarf und kleinere Anlagen
einer besondern Beliebtheit erfreuen und wird zu diesem Zweck mit einem Windrade
verbunden, das eine kleine Luftpumpe antreibt und so die erforderliche comprimirte
Luft liefert.
79. Eisenbahnwagenräder mit
Papierfüllung. (Fig. 21 bis 23 [d/4].)
Außer den gußeisernen Eisenbahnwagenrädern mit gehärtetem Rand oder Stahlbandagen,
welche fast ausschließliche Verwendung im Fahrparke der amerikanischen Eisenbahnen
finden (vgl. *1876 221 298), sind nur wenige
Ausstellungsobjecte bemerkenswerth. Atwood's Wagenrad mit
Hanfpackung (*1876 222 109), Raddin's Rad mit Kautschukfutter (daselbst S. 418) sind nur als
Abnormitäten interessant und nicht als Beispiele bewährter Praxis; zur selben
Kategorie gehört auch Tuthill's
„verbessertes“ Eisenbahnwagenrad, welches innerhalb des
Spurkranzes eine zweite Lauffläche trägt, die im allgemeinen unbenutzt bleibt und
nur an den Schienenstößen auf einem beiderseits abgeschrägten Schienenstück
aufläuft, mittels dessen die Wagen über den Stoß gehoben und dadurch die
Erschütterungen vermindert werden sollen.
Dagegen scheint das Papierrad schon eine gewisse
Verbreitung erlangt zu haben (vgl. 1872* 204 19. 205 71). Figur 21 zeigt einen
Schnitt desselben; Figur 22 die vordere Ansicht des completen Rades und Figur 23 stellt den
Papierkörper allein dar. Die einzelnen Bestandtheile des Rades sind die gußeiserne
Nabe, über derselben die Papierscheibe, beiderseits geschützt durch 5mm starke Bleche,
endlich der mit einer innern Rippe gewalzte Tyre und die 24 Schrauben (20mm stark) mit ihren
Muttern. Dieselben gehen in länglichen Schlitzen durch die Rippe des Tyre, damit die
ganze Belastung nur von der Papiermasse aufgenommen werde; aus gleichem Grunde
stoßen die beiderseitigen Schutzbleche nicht direct wider den Tyre an, sondern
lassen einen kleinen Zwischenraum frei.
Die Herstellung des Papierkörpers geschieht aus Blättern von Strohpappe, welche mit Kleister
aus Roggenmehl zu Scheiben von etwa 13mm Dicke verbunden und durch 5 Stunden
einem Drucke von 350t
ausgesetzt werden. Nach dem Pressen werden diese Scheiben mit erhitzter Luft
getrocknet und mit andern zusammengeleimt, neuerdings gepreßt und getrocknet, bis
die Dicke von 90mm
erreicht ist. Die so hergestellte Papierscheibe wird ausgebohrt und abgedreht, die
Nabe mit 25t Druck
eingepreßt, der Tyre mit 230t aufgezogen und das vordere und hintere Schutzblech
aufgeschraubt.
Auf diese Weise erhält der Tyre eine continuirliche elastische Unterlage, welche
weichern Gang und wesentlich geringere Abnutzung bedingt; die durch die Rippe
gezogenen Schrauben verhindern das Abfliegen eines zufällig brechenden Tyre, ohne
die Festigkeit der Lauffläche zu beeinträchtigen, und so besitzt das Papierrad alle
wesentlichen Vorzüge der bewährten Mansell'schen Holzscheibenräder, während die
Erzeugung unzweifelhaft bei weitem billiger zu bewerkstelligen ist.
80. Handyside's Eisenbahnwagenrad.
(Fig. 24
und 25 [d/3].)
Fried. Krupp in Essen stellte außer seinen Kanonen und
einigen vortrefflichen Schmiedestücken auch ein eigenthümliches Rad aus, über das
wir seiner Zeit in Philadelphia vergeblich eine Aufklärung suchten. Inzwischen wurde
uns dasselbe als Erfindung des Engländers Handyside in
Glasgow bekannt, welcher sein Patent in Essen ausüben läßt. Vgl. Patenliste S. 115 d. B., Schlagwort
„Eisenbahn“.
Der Zweck einer continuirlichen und elastischen Unterstützung des Tyre wird hier
durch zwei Scheiben aus dünnem Stahlblech erreicht, welche in die aus Figur 24
ersichtliche Form im Gesenk gepreßt werden. Diese Scheiben umfassen einerseits die
Nabe, anderseits den Tyre, sind in ihrer mittlern Einbauchung mit zwei Ringen armirt
und werden hier durch 12 Schrauben zusammengehalten (Fig. 25). Um eine Drehung
der Scheiben über die Nabe zu verhindern, hat letztere vier Arme angeschmiedet,
durch welche die betreffenden Querbolzen Passiren.
81. Bryant's selbstschmierendes
Wagenrad. (Fig. 26 und 27 [b/4].)
In der Anwendung für Eisenbahnen, wie es der Erfinder erwartet und bei den in Figur 26 und
27
dargestellten Ausstellungsobjecten ausgeführt hat, dürfte diese Idee kaum eine
Zukunft haben; dagegen empfiehlt sie sich vielleicht zum Schmieren von Losscheiben,
und möge daher kurz erwähnt werden. Die hohl gegossene Radscheibe enthält ringsum
die Nabe der Oelkammer,
welche durch eine Oeffnung gefüllt werden kann, die durch Schraubenverschluß
versperrt wird. — Eine enge Bohrung vermittelt die Verbindung zwischen der
Oelkammer und der Lauffläche der Nabe, ist jedoch durch ein schwammartiges
Schmierpolster verschlossen, das durch eine Spiralfeder angepreßt wird. In Folge
dessen bleibt in der Ruhelage die Schmieröffnung völlig verschlossen, bei rascher
Umdrehung aber wird durch die Wirkung der Centrifugalkraft der Verschluß theilweise
geöffnet, und das am äußersten Umfang der Höhlung mitrotirende Oel wird längs der
Spiralfeder in die Lauffläche eingesaugt.
82. Miltimore's beweglicher
Rädersatz. (Fig. 28 u. 29 [c/4].)
Die Skizzen Fig.
28 und 29 zeigen die absonderlichste Räderconstruction, welche in Philadelphia
zu sehen war. Hier ist die Achse selbst nicht in Lagern beweglich, sondern in festen
Tragklötzern an beiden Enden gelagert; die Räder dagegen sind mit einer Rohrwelle
verbunden und liegen beiderseits mit Kugellagerschalen auf der Achse auf. Die
Schmierung erfolgt vom Ende der festen Achse aus durch eine centrale Bohrung.
„Die starken Punkte unserer Erfindung sind Dauerhaftigkeit, größere
Lebensdauer und Möglichkeit der Verwendung größerer Räder, Verminderung der
Achsabnutzung....und eine Ersparung von 48½ Proc. in der bewegenden
Kraft.“ So schreibt die „Miltimore
Car-Axle Company“ in Philadelphia!
Schlußbemerkung:
In vorstehenden Notizen glauben wir einige der interessanteren Novitäten der
verflossenen Weltausstellung vorgeführt und unsere einleitenden Bemerkungen (1876
221 193) gerechtfertigt zu haben.
Zahlreiches Bemerkenswerthe ist uns sicherlich entgangen, manches andere ließ sich
nicht wohl dem Rahmen dieser Notizen einfügen; doch möge es uns vorbehalten bleiben,
in einer spätern Arbeit eine kurz systematische Zusammenstellung der Dampfmaschinen
der Ausstellung zu geben.
Tafeln