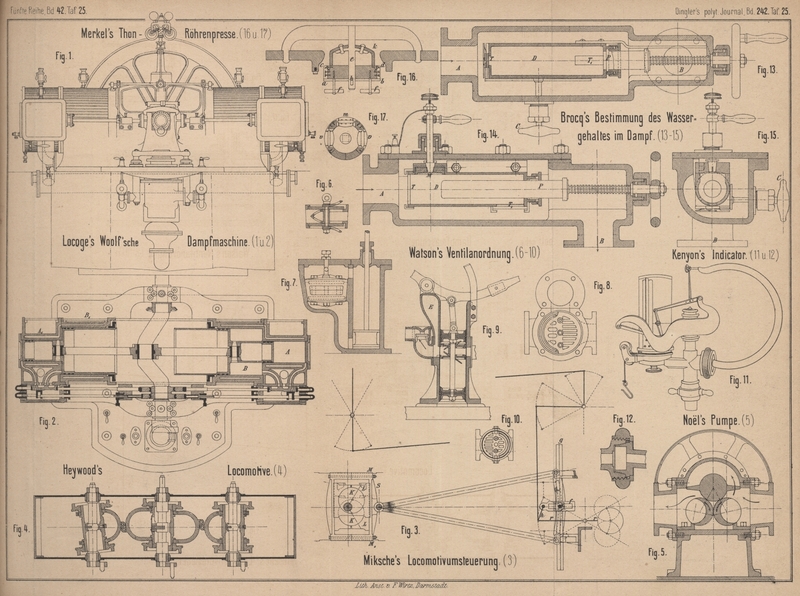| Titel: | F. Brocq's Apparat zur Messung der vom Dampfe mitgerissenen Wassermenge. |
| Autor: | Whg. |
| Fundstelle: | Band 242, Jahrgang 1881, S. 318 |
| Download: | XML |
F. Brocq's Apparat zur Messung der vom Dampfe mitgerissenen
Wassermenge.
Mit Abbildungen auf Tafel 25.
Brocq's Bestimmung des Wassergehaltes im Dampf.
Der Grundgedanke, auf welchem der nachstehend beschriebene Apparat beruht, ist
folgender: Wenn man das Volumen einer bestimmten Menge feuchten Dampfes allmählich
vergröſsert, so wird sich die Pressung so lange nicht ändern, als dem Dampfe noch
Wasser beigemischt ist, vorausgesetzt, daſs derselbe auf constanter Temperatur
erhalten wird, daſs also genügend Wärme zugeführt wird, um das Wasser so schnell zu
verdampfen, als es der Volumenvergröſserung entspricht. Erst wenn alles beigemengte Wasser verdampft
ist, wird die Dampfspannung sinken. Es ist also nur nöthig, den Augenblick, in
welchem eine Abnahme der Spannung beginnt, genau zu bestimmen und die stattgefundene
Volumenvergröſserung zu messen, um den ursprünglichen Feuchtigkeitsgehalt des
Dampfes festzustellen.
Innerhalb eines guſseisernen Kastens (vgl. Fig. 13 bis
15 Taf. 25), welcher so in die Dampfleitung eingeschaltet wird, daſs der
Dampf bei A ein- und bei B
austritt, ist ein kleiner Bronzecylinder D von 40mm innerem Durchmesser befestigt. Derselbe hat bei
T wie bei T1 je eine rechteckige Oeffnung von 40 und 12mm Seite, welche durch einen Schieber geschlossen
werden kann. Beide Schieber werden durch Federn angedrückt und bei der Benutzung des
Apparates mittels des Handgriffes C von auſsen
gleichzeitig bewegt. In den Cylinder taucht ein Plungerkolben P, welcher durch eine Schraube mit Handrad aus- und
eingeschoben werden kann.
Das Wesentlichste des Apparates ist nun ein äuſserst empfindliches Manometer, welches
folgendermaſsen eingerichtet ist. Bei M ist in einem an
dem Cylinder D befestigten Ansätze eine kreisrunde
Vertiefung angebracht, in welcher sich eine sehr dünne gewellte Scheibe aus
Neusilber befindet. Der Raum über dieser Scheibe kann durch einen Hahn von auſsen
mit dem Innern des Cylinders D in Verbindung gesetzt
werden. Der Hahn hat zu diesem Zweck zwei Längsnuthen, welche bei der in Fig.
14 gezeichneten Stellung mit den in dem Ansatz vorhandenen winkelförmigen
Kanälen zusammentreffen. Durch eine Drehung des Hahnes um 90° wird die Verbindung
unterbrochen. In der Achse des Hahnes und von derselben durch eine Glasröhre isolirt
ist eine Schraube mit sehr feinem Gewinde untergebracht, welche oben mit dem einen
Pole einer elektrischen Leitung verbunden ist und deren Spitze bis zu der
Neusilberplatte hinabreicht. Die letztere steht mit dem anderen Pole in
Verbindung.
Soll nun der Apparat zur Verwendung kommen, so werden, nachdem er in die Dampfleitung
eingeschaltet ist, die Schieber T und T1 geöffnet und, wenn
der Dampf lange genug durch den Cylinder D geströmt
ist, um denselben auf die Dampftemperatur zu bringen, beide gleichzeitig wieder
geschlossen. Dieser gleichzeitige Schluſs ist nöthig,
damit der im Cylinder abgeschlossene Dampf genau die Pressung des durch den Apparat
strömenden Dampfes habe. Würde zunächst ein Schieber geschlossen, so würde der an
der noch freien Oeffnung vorbeiströmende Dampf saugend oder auch drückend auf den
eingeschlossenen Dampf wirken. Ist der Kolben P vorher
ganz hineingeschraubt worden, so sind nun in D genau
125cc Dampf abgeschlossen. Der Hahn hat
zunächst die gezeichnete Stellung, damit auch oberhalb der Membran die gleiche
Spannung wie im Cylinder D hergestellt werde. Dann wird
derselbe um 90° gedreht und dadurch der Dampf oberhalb der Membran abgesperrt. Die durch die
Hahnachse gehende Schraube wird darauf vorsichtig nieder geschraubt, bis sie die
neusilberne Membran berührt und hierdurch den Stromschluſs in der erwähnten Leitung
herstellt. Letzterer wird durch ein mit der Leitung verbundenes Läutewerk angezeigt,
welches so lange ertönt, als der Strom geschlossen bleibt. Wird nun der Kolben P langsam herausgeschraubt, so wird das mitgerissene
Wasser nach und nach verdampfen, indem die hierzu nöthige Wärme von dem äuſseren
Dampfe durch die Cylinderwand zugeleitet wird. Sobald aber der eingeschlossene Dampf
trocken ist, wird seine Pressung bei weiterer Vergröſserung des Volumens fallen, die
Membran bei M nach unten durchgebogen und damit der
Strom unterbrochen werden. Schon eine Durchbiegung der Platte um 1/30mm soll hierzu genügen. Die Steighöhe der
Schraube, deren Mutter sich in dem hohlen Kolben P
befindet, beträgt 2mm,25, der Querschnitt von P 5qc, so daſs durch
jede Umdrehung der Schraube der Cylinderraum um 1cc,25, d. i. 0,01 des ursprünglichen Volumens vergröſsert wird. Sind
folglich im Ganzen n Umdrehungen ausgeführt, bis das
Läutewerk verstummte, so enthielt der Dampf \frac{100\,n}{100+n}
Procent Wasser. (Nach der Revue industrielle, 1881 S.
334.)
Whg.
Tafeln