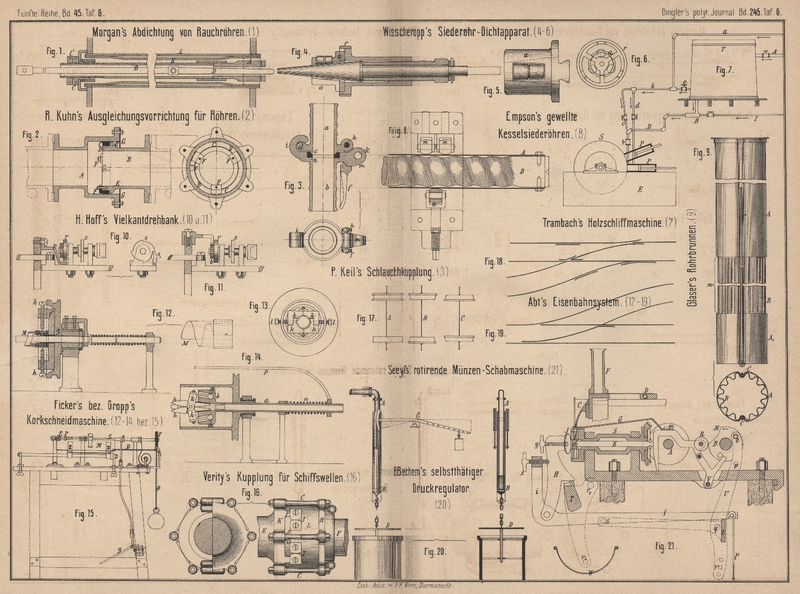| Titel: | Ludw. Seyss' rotirende Schabmaschine für Münzplatten. |
| Fundstelle: | Band 245, Jahrgang 1882, S. 61 |
| Download: | XML |
Ludw. Seyſs' rotirende Schabmaschine für
Münzplatten.
Mit Abbildung auf Tafel 6.
Seyſs' rotirende Schabmaschine für Münzplatten.
C. v.
Ernst beschreibt in der Oesterreichischen Zeitschrift für Berg- und
Hüttenwesen, 1882 S. 263 eine neue, von Ludw. Seyſs in Atzgersdorf bei Wien construirte
Münzplatten-Schabmaschine, bei welcher das Schneidwerkzeug in einiger Entfernung vom
Mittelpunkt der Münzplatte ansetzt und gegen den Umfang hin einen spiralförmigen
Span wegnimmt. Hierbei bleibt die Mitte der Münze für erhabenere Prägung unberührt.
Dieses so nahe liegende Auskunftsmittel scheint auf den ersten Blick nichts Neues zu
bieten, denn Aehnliches wurde schon vor langer Zeit durch das rotirende Schaben in
mehreren Münzstätten bewirkt. Entweder die Münzplatte wurde in die Docke einer
Drehspindel gespannt und das Messer vom Arbeiter gegen dieselbe gedrückt (Venedig),
oder das Messer wurde durch einen Mechanismus in drehende Bewegung versetzt und die
Münzplatte gegen dasselbe gepreſst (Mailand). In beiden Fällen erhielt man
kreisförmige Schabreifen auf der Oberfläche der Münzplatte, welche, wenn es
wünschenswerth erscheinen mochte, das Centrum derselben frei lieſsen. Allein bei
diesen Methoden wurden die Platten in der Regel erst nach wiederholtem Schaben,
welches jedesmal ein Ausheben und Nachwägen derselben nothwendig machte, richtig, da
eben der Arbeiter das Messer oder den Träger der Münzplatte mit der Hand
herandrücken muſs und von einer gleichförmigen Wirkung daher keine Rede sein konnte.
Zudem gehörte eine groſse Geschicklichkeit dazu, die Platte nicht zu verschaben. Sie
wurde daher, ebenso wie bei den Hobelmaschinen mit horizontaler Hin- und
Herbewegung, nur bis zu einer gewissen Grenze beschabt und zuletzt durch Feilstriche
vollkommen just gemacht.
Bei der Seyſs'schen rotirenden Schabmaschine werden alle
diese Operationen selbstthätig zu Ende geführt; es genügt, die Münzplatten nach
ihrer Schwere durch die Sortirmaschine in Klassen von verschiedenem unter sich
gleichem Uebergewichte zu sichten und je nach der Stellung des Schneidwerkzeuges und
der Gewalt, mit welcher die Platte gegen dasselbe gedrückt wird, entfernt dann
ersteres genau jene Menge Metall von ihrer Oberfläche, welche nothwendig ist, um die
Platte auf das richtige
Gewicht zu bringen, wobei, wie erwähnt, das Centrum derselben unberührt bleibt.
Die Art und Weise, in welcher die Maschine diese Aufgabe erfüllt und nebstbei eine
ganze Reihe Bewegungen ausführt, welche ihre Hauptfunction unterstützen und sie
denkbarst vollkommen zu Ende zu führen veranlaſst, möge mit Hilfe der Skizze Fig.
21 Taf. 6 erklärt werden.
Die Münzplatten werden in die cylindrische Büchse F
gefüllt und gelangen eine nach der anderen durch den Zubringer D in den Trichter C, wo
sie sich senkrecht aufstellen. Der Fänger G
verschliefst den Trichter, bis er, im richtigen Augenblick abgezogen, der Münzplatte
gestattet, durch einen Kanal in den Kopf der Spindel S
einzufallen. Die Platte gelangt hierdurch in das Centrum des Spindelkopfes c, wo dieselbe durch den eben herankommenden Kolben K gegen einen Stahlring gepreſst wird. Nun wirkt das
glockenförmige Messer J, welches in H befestigt ist und zurückgeführt worden war, über dem
Centrum auf die Platte und zwar mit einem Drucke, welcher durch das an dem
Winkelhebel I angehängte Gewicht P geregelt ist. Dieses Gewicht P wird durch aufgelegte Metallplatten je nach Bedürfniſs, d.h. je nachdem
mehr oder weniger Metall von der Münzplatte abgeschabt werden soll, regulirt.
Während des Angriffes des Messers wird H allmählich
gehoben, so daſs auf der in Rotation befindlichen Platte ein spiralförmiger
Schabstreifen von 1 bis 3½ Umgängen ausgeführt wird. Nach diesem Vorgang tritt H zurück und senkt sich in seine ursprüngliche
Stellung; auch der Kolben K tritt hinter den
Einfallskanal zurück, der Fänger G öffnet sich, eine
neue Münzplatte gleitet ein und treibt bei der Einpressung in den Ring die eben
justirte Platte hinaus, welche in ein unterhalb angebrachtes Gefäſs W fällt, welches auch die Schabspäne auffängt, gegen
deren Zerstreuung einige Schutzrinnen vorhanden sind.
Diese verschiedenen Bewegungen, welche sämmtlich von der Antriebswelle A ausgehen, werden durch eine Reihe sehr sinnreich
angebrachter und in einander wirkender Mechanismen selbstthätig bewerkstelligt, so
daſs die Bedienung der Maschine nur in der Füllung der Büchse mit den zu justirenden
Münzplatten besteht.
Die Welle A, welche durch eine seitwärts angebrachte
Riemenscheibe bethätigt wird, überträgt die Bewegung einerseits durch ein
aufgesetztes Kegelrad auf die Spindel S, andererseits
durch Zapfeneingriffe (1 : 6) auf die Welle B. Diese
zweite Arbeitswelle wird also nach je 6 Umgängen von A
einmal umgetrieben und jeder Umgang von B bildet einen
Vollzug sämmtlicher Spiele der Maschine zur Abfertigung einer Münzplatte auf je
einen Lauf. Sechs solche Läufe sind auf einem Gestelle neben einander angebracht,
welche sämmtlich von den gemeinschaftlichen Wellen A
und B bedient werden, so daſs also stets 6 Münzplatten
gleichzeitig justirt werden.
An der auf der Welle B aufgesetzten Scheibe M sind kleine Krummzapfen
O angebracht, an welchen die Hebel U hängen. Unter den Winkelhebeln I läuft beiderseits eine im Winkel abgebogene Schiene
t hin, an welcher eine Achse q für die Hebel U
angebracht ist, während die Winkelarme ts beiderseits
am Hauptgestelle angelenkt sind. Daraus folgt, daſs während der Zapfen O einen Kreis beschreibt, der Stift p einen ellipsenartigen Weg im Sinne von O, die Schiene t aber
einen nahezu senkrechten Weg auf und ab und der Zapfen r, in der Verlängerung von U, einen
ellipsenartigen Weg im entgegengesetzten Sinne von p
zurücklegt.
Hierdurch ist bedingt, daſs, wenn die Umdrehung der Scheibe M in der durch den Pfeil angedeuteten Richtung fortschreitet, folgende
Stellungen eintreten: 1) Durch das Ansteigen von O wird
die Schiene t und somit der Hebel I gehoben und in Folge der Verbindung mit dem Hebel H durch die Stellschraube x tritt das Messer J zurück. – 2) Da
gleichzeitig die Rolle R, durch den Doppelarm V genöthigt, in den Ausschnitt der Scheibe M einfällt, tritt der Kolben K von der eben justirten Münzplatte zurück. Zugleich wird der bei m an dem Doppelarm befestigte Fänger G zurückgezogen und die neue Münzplatte kann in den
Spindelkopf c einfallen. – 3) Durch ein in p angehängtes Gestänge und Umsetzung der Bewegung durch
einen Hebel wird der Rückgang des Zubringers D
veranlaſst. – 4) Durch ein Gestänge zwischen r (an U) und r1 (an T) wird T gezwungen, sich drehend um r2, also niederwärts zu bewegen.
Sobald die Rolle R aus dem Ausschnitte der Scheibe M zurücktritt, erfolgt die Einpressung der neuen
Münzplatte durch den Kolben K, der Fänger G schlieſst den Trichter, t läſst den Winkelhebel I hinab, der Druck
des Gewichtes P wird wirksam und das Messer J angedrückt.
Während des Umganges des Krummzapfens O unterhalb dem
Mittel der Welle B steht der Kolben K unter Druck ruhig; durch p wird der Zubringer D vorwärts bewegt, eine
neue Platte in den Trichter C schiebend; i geht frei abwärts und r,
mit r1 verbunden,
nöthigt T (die gemeinschaftliche Stütze der
Messerträger H) etwas abwärts zu steigen, um den
Spiralgang des Schnittes zu erzielen.
Die Stärke und Dauer des Schnittes, welche je nach dem gröſseren oder kleineren
Uebergewichte der Münzplatten verschieden sein wird, wird theils durch die
veränderliche Belastung bei P, theils durch die
Stellschraube x geregelt, mittels welcher erzielt wird,
daſs das Messer früher oder später von der Platte zurücktritt und daher auch mehr
oder minder lang in Schnittthätigkeit bleibt.
Die Messer haben, wie erwähnt, die Form einer Glocke erhalten, damit der Rand
gleichförmig scharf auf einer Kugelform geschliffen werden kann. Der Schnitt nimmt
stets nur einige Millimeter in Anspruch, während der übrige Umfang der
Messerschneide in Reserve bleibt. Sobald eine Abstumpfung des thätigen Theiles
wahrgenommen wird, ist nach Lüftung der Anziehschraube y das Glockenmesser etwas zu drehen, was ohne merkliche Unterbrechung der
Arbeit geschieht.
Die Antriebswelle A hat noch eine eigenthümliche
Einrichtung in der seitwärts aufgesetzten Riemenscheibe. Diese, kapsel- oder
dosenförmig gebaut, ist auf der Welle nicht fest; vielmehr ist der Angriff durch
einen Mitnehmer und zwei im Rande der Riemenscheibe nach innen vorstehende Nasen
vermittelt. Durch einen neben der Riemenscheibe gelegten, mit Handgriff versehenen
Hebel und einen im Centrum der Welle A beweglichen
Bolzen kann mit Verstellung des Hebels der Mitnehmer auf der Welle verkürzt werden,
so daſs die Scheibe leer umläuft. Dies wird nun nicht allein angewendet, um den Gang
der Maschine nach Willkür abzustellen, sondern die Maschine veranlaſst die
Abstellung selbst bei jedem für die Zeit eines halben Umganges der Welle. Dieser
Augenblick tritt ein, wenn die im Trichter C
befindliche Platte, durch Abzug des Fängers G
veranlaſst, nach dem Centrum des Spindelkopfes c
gleitet, welche Ruhepause der Spindel auch die senkrechte Richtung des Gleitkanales
entsprechen muſs.
Aus der vorstehenden Beschreibung ist zu erkennen, daſs die rotirende Schabmaschine
von L. Seyſs nach allen wünschenswerthen Richtungen hin
das Vollkommenste leistet, was bisher auf mechanischem Wege erzielt worden ist. Sie
hat sich auch in mehreren Münzstätten (Berlin, Hamburg, Frankfurt) mit einer
Arbeitsleistung von 60 bis 70 Stück in der Minute bestens bewährt. Einen Beleg für
die auſserordentliche Genauigkeit, mit welcher die Seyſs'sche Schabmaschine arbeitet, wird dadurch geliefert, daſs sie selbst
zum Justiren der sehr kleinen goldenen 5-Markstücke mit stets gleich sicherem
Erfolge verwendet wird. Ebenso gut dient sie aber für jede andere auch die gröſste
Münzsorte, wenn je nach ihrer Gröſse die Büchse F, der
Zubringer D, dann der Stahlring in S und die Kolbenköpfe an K
geeignet gewählt werden, sowie eine Abänderung in der Stellung der Stifte r und p am Hebel U vorgenommen wird.
Tafeln