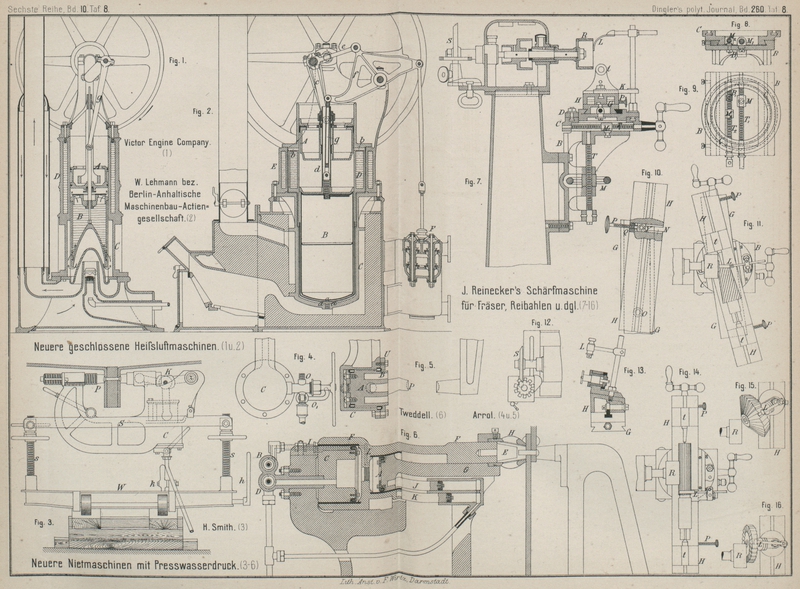| Titel: | Neuere geschlossene Heissluftmaschinen. |
| Fundstelle: | Band 260, Jahrgang 1886, S. 109 |
| Download: | XML |
Neuere geschlossene
Heiſsluftmaschinen.
Mit Abbildungen auf Tafel
8.
Neuere geschlossene Heiſsluftmaschinen.
Textabbildung Bd. 260, S. 109 Die bekannte Lehmann'sche Heiſsluftmaschine
(vgl. 1880 249 * 1) wird neuerdings von der Berlin-Anhaltischen Maschinenbau-Actiengesellschaft in
Berlin und Dessau auch stehend gebaut. Diese aufrechte
Anordnung hat vor der liegenden den Vorzug, daſs sie weniger Platz wegnimmt und daſs
die Rolle zur Leitung des Verdrängers wegfällt, also die Reibung vermindert und eine
Quelle öfterer Störungen beseitigt wird. Ferner ist, um eine wirksamere Heizung und
Kühlung zu ermöglichen, die Verdrängerspalte als Verbindung zwischen dem heiſsen und
dem kalten Raume des Cylinders durch eine andere Einrichtung ersetzt. Der Verdränger
geht jetzt dicht im Cylinder und die gedachte Verbindung wird durch einen
ringförmigen, den Cylinder umschlieſsenden Kanal hergestellt. Diese Anordnung war
zwar schon im J. 1881 auf der Ausstellung in Altona an einer liegenden Maschine zu
sehen, wurde aber seither nicht wieder ausgeführt.
Fig. 2 Taf. 8
gibt die als einpferdig bezeichnete Maschine in 1/20 n. Gr.
wieder. Der Cylinder besteht aus einem oberen Theile, in welchem sich der Kolben A, und einem unteren Theile, worin sich der Verdränger
B bewegt; dieser untere Theil besteht nur so weit,
wie der Kolbenring des Verdrängers es erfordert, aus Guſseisen, weiter abwärts aber
aus Blech. Der Heiztopf C umgibt den unteren Theil des
Cylinders, so daſs zwischen beiden ein ringförmiger Raum entsteht, welcher durch
einige im Cylinderboden angebrachte Oeffnungen a mit
dem heiſsen Raume verbunden ist. Der obere Theil des Cylinders ist mit einem
Wassermantel D versehen und wird von einem zweiten
ringförmigen Wassermantel E umgeben, so daſs zwischen
den beiden Mänteln eine Ringspalte bleibt, welche die Fortsetzung des erwähnten
Raumes zwischen Heiztopf und Cylinder bildet und durch zahlreiche Bohrungen b mit dem kalten Raume verbunden ist. Die Feuerung ist
für geringwertigen Brennstoff eingerichtet und bedarf keiner Erläuterung.
Die Schwungrad welle liegt über dem Cylinder, ist gekröpft und mit dem Kolben durch
zwei Pleuelstangen c verbunden; der Verdränger, welcher
eine im Kolben geführte röhrenförmige Verlängerung d
trägt, wird von der Welle durch die Pleuelstange e, den
Winkelhebel f und die Stange g gesteuert; durch diesen Winkelhebel erhält auch die Kühlwasserpumpe ihre
Bewegung. In der Figur ist die Maschine als zum Betriebe einer Pumpe F bestimmt angenommen, welche das Förderwasser durch
den Kühlmantel drückt, so daſs eine besondere Kühlwasserpumpe überflüssig wird.
Die Arbeitsweise ist bei dieser stehenden Anordnung die gleiche
wie bei der liegenden Maschine. Prof. R. Schöttler in
Braunschweig hat, wie in der Zeitschrift des Vereins
deutscher Ingenieure, 1885 * S. 935 mitgetheilt ist, mit einer solchen
stehenden Maschine von 370mm Durchmesser und
180mm Hub einige Indicator- und Bremsversuche
vorgenommen und gefunden, daſs dieselbe bei Heizung mit recht schlechter
Bitterfelder Braunkohle bei etwa 80 Umdrehungen 1,5 Pferd (an der Bremse gemessen)
leistete. Dabei muſste scharf gefeuert werden, ohne daſs jedoch der Heiztopf seine
normale Farbe veränderte. Wurde der Braunkohle etwas Steinkohle zugesetzt, so stieg
die Leistung bei etwa 90 Umdrehungen auf 1,8 Pferd; das Feuern war bequemer, ohne
daſs der Heiztopf zu roth wurde. Es ist hieraus zu schlieſsen, daſs die Maschine bei
gutem Brennstoffe fast 2 Pferd wird leisten können, ohne überanstrengt zu werden; in
der That wurde diese Leistung auch während der Versuche für kürzere Zeit erreicht.
Die Diagramme sind, wie vorauszusehen, denen der liegenden Maschine ganz ähnlich
gestaltet, die Spannungen aber wesentlich höher. Während die von Brauer und SlabyVgl. Brauer und Slaby:
Versuche über Leistung und Brennmaterialbedarf von Kleinmotoren.
(Berlin 1879. Jul. Springer.)
mitgetheilten Diagramme der einpferdigen Maschine liegender Anordnung höchstens eine
Spannung von 0at,9 Ueberdruck zeigen, war hier die
höchste Spannung der Diagramme stets wenigstens 1at,2 Ueberdruck. Dieser Unterschied ist wohl nur der wirksameren Heizung
im Ringraume zwischen Heiztopf und Cylinder zuzuschreiben. Den mechanischen
Wirkungsgrad ergaben die Versuche zu 0,65. Brauer und
Slaby landen denselben bei der liegenden
einpferdigen Maschine bei einer Ausführung noch etwas höher, bei einer anderen 10
Proc. niedriger, während die gröſseren Maschinen kaum 0,5 zeigten (vgl. 1879 233 82). Wahrscheinlich ist die Reibung des liegenden Verdrängers zwar
bei sehr gutem Zustande der Leitrolle nicht gröſser als die des stehenden geführten
Verdrängers, bei gewöhnlichem Zustande derselben aber wesentlich höher. Mit
Sicherheit kann dies aber aus den vorliegenden Versuchen noch nicht geschlossen
werden. Die geprüfte Maschine arbeitete während der Versuche ruhig und regelmäſsig
und dürfte sich die neue Anordnung im Betriebe bewähren.
Die Victor Caloric Engine Company in New-York baut nach
dem Techniker, 1886 * S. 19 eine ähnliche, aufrecht
stehende, geschlossene Heiſsluftmaschine, jedoch für die Heizung mittels Gas oder Erdöl. Bei der in Fig. 1 Taf. 8 gezeichneten
Maschine ist Gasheizung vorausgesetzt, zu welchem Zwecke in dem hohlen guſseisernen
Bodenkörper der Maschine ein Bunsenbrenner vorgesehen und der Boden des Feuertopfes
C entsprechend, ähnlich wie bei einer Glasflasche,
vertieft ist. Der sich unten dieser Form anschlieſsende Verdränger B ist mit einem guten Wärmeleiter gefüllt, welcher für
die abwechselnd durchstreichende Luft als Wärmespeicher
dient, indem beim Aufwärtsstreichen der erhitzten Luft von deren Wärme etwas
aufgenommen wird, welche Wärme dann beim Uebertreten der gekühlten Luft unter den
Verdränger wieder an dieselbe abgegeben wird. Der Verdränger wird einfach durch eine
zweite Kröpfung der Schwungrad welle mittels der Gelenkstange g bewegt. Der Cylinder C
ist mit dem Kühlwassermantel D in einem Stücke
gegossen. Der Kolben A erhält zur Dichtung eingelegte
federnde Stahlringe. Die Verbrennungsluft wird in einem Rohre zugeführt, welches das
Abzugsrohr für die vom Brenner abziehenden Gase umgibt, so daſs noch eine Vorwärmung
dieser Luft stattfindet.
Solche Heiſsluftmaschinen sollen bei geräuschlosem Gange bis 250 Umgänge in der
Minute machen und werden dieselben hauptsächlich für den Betrieb von Pumpen zur Hauswasserversorgung angewendet. Bei einem
Gasverbrauche von 1cbm oder einem Verbrauche von
1l Kerosin zur Heizung einer Maschine sollen
2400l Wasser 15m hoch gehoben werden können.
Tafeln