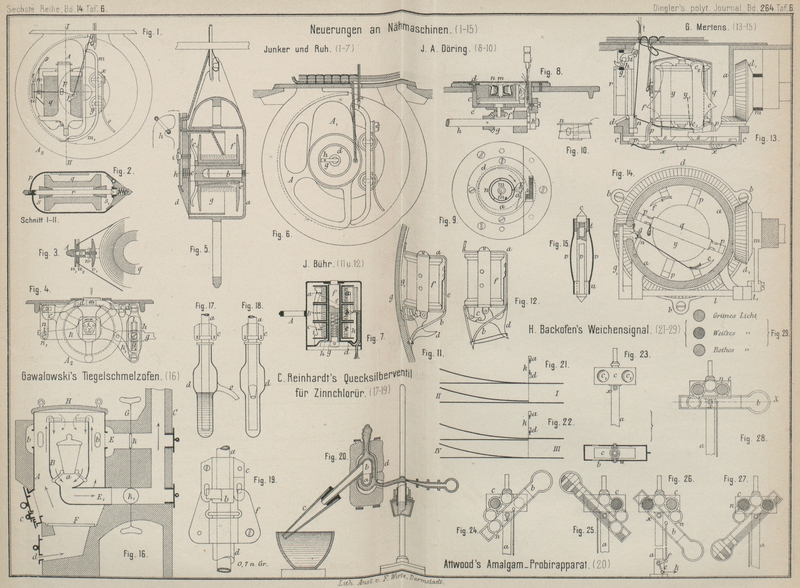| Titel: | Ueber Neuerungen an Nähmaschinen. |
| Fundstelle: | Band 264, Jahrgang 1887, S. 62 |
| Download: | XML |
Ueber Neuerungen an Nähmaschinen.
(Patentklasse 52. Fortsetzung des Berichtes Bd.
259 S. 406.)
Mit Abbildungen auf Tafel
6 ff.
Ueber Neuerungen an Nähmaschinen.
P. Th. Beier bringt in der Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, 1886 * S. 603 folgende
Eintheilung der Nähmaschinen. Nach der Stichbildung: 1) Kettenstich- oder Tambourirmaschinen, 2) Doppelkettenstich- oder Knotenstichmaschinen und 3) Doppelsteppstichmaschinen; letztere zerfallen wieder je nach dem Wesen
ihrer Construction in die folgenden Klassen: a) Die Greifermaschine, bei welcher der Unterfaden auf einer meist
scheibenförmigen Spule aufgewickelt ist und die Schlinge des Oberfadens durch einen
kreisenden Greifer um die im Mittelpunkte desselben ruhig stehende Spule gezogen
wird, b) Die Schiffchenmaschine, bei welcher der
Unterfaden, auf eine cylindrische Spule gewunden, in einem kleinen, dem
Weberschiffchen ähnlichen Gehäuse ruht, welches mit demselben in der Längsachse der
Maschine oder normal zu dieser in einer geraden oder kreisbogenförmigen Bahn hin und
her und durch die Schlinge des Oberfadens gezogen wird, c) Maschinen, bei denen im
Wesentlichen der Grundgedanke der Schiffchen- und
Greifermaschine vereinigt ist, indem dabei das dem Weberschiffchen ähnliche
Gehäuse in entsprechender Gestalt vorhanden ist, sich kreisend bewegt und dabei
entweder die Schlinge des Oberfadens um das Schiffchen mit der Spule herumzieht,
oder sich mit der Spule durch die Schlinge des Oberfadens windet.
Besonders auf die Maschinen der letzteren Art haben die Nähmaschinenfabrikanten ihr
Augenmerk gerichtet und es ist leicht zu erkennen, daſs die Maschinen mit der
ersteren und letzteren Anordnung gegenüber der zweiten in Folge der kreisenden
Bewegung des Greifers oder Spulengehäuses einen ruhigeren Gang besitzen, um den
Unterfaden von einer groſsen Garnrolle zu vernähen; letzteres mit Sicherheit bei
bequemer Bedienung der Maschine zu erreichen, ist der Grundgedanke der verschiedenen
Constructionen.
Doppelsteppstich-Nähmaschinen mit kreisendem oder schwingendem
Schiffchen bezieh. Greifer.
Eine Nähmaschine mit kreisendem Schiffchen, welche
unmittelbar von zwei käuflichen Spulen näht und den Stich bei einer einzigen
Umdrehung vollendet, wurde von C. v. Rein in Rudolstadt
(* D. R. P. Nr. 22682 vom 18. November 1881) angegeben und später von Junker und Ruh in Karlsruhe (* D. R. P. Nr. 28010 vom
20. Mai 1883 und Zusatz * Nr. 36361 vom 19. Januar 1886) weiter verbessert. Die hierdurch
entstandene Einrichtung zeigen Fig. 1 bis 7 Taf. 6.
Das Schiffchen A kreist in einem senkrecht stehenden
Ringe A2 (Fig. 1),
welches in einfacher Weise durch einen Schiffchentreiber m
m1 mitgenommen wird und sich zu Folge
seines Gewichtes, gleichsam wie von selbst, immer von demjenigen Treibarme entfernt,
zwischen welchem die Fadenschleife ungehindert durchschlüpfen soll. Um das
Schiffchen A beim Spulenwechsel bequem aus seinem
Führungsringe A2
herausnehmen zu können, ist der Treiber mm1 in dem Säulchen x
drehbar gelagert, wird aber in seiner Lage durch die Feder o gehalten, deren Stift den Treiber mit dem zweiten Säulchen y verbindet. Zieht man die Feder o zurück, so schnellt eine Spiralfeder, welche im
Inneren des Säulchens y ruht, den Treibarm m1 nach oben und das
Schiffchen kann herausgenommen werden. Nun öffnet man die um ein Gelenk bewegliche
Leiste p und setzt den Stift r (Fig.
2), welcher mittels aufgeschnittener kegelförmiger Büchsen s, s1 die Spule q festhält, in die Körner des Garnbehälters bezieh.
Schiffchens ein. Den Faden führt man hierauf durch das Loch t (Fig.
1), wodurch derselbe in die Fadenbremse u
gelangt, dann über eine Zunge unterhalb der Leiste p
hinweg und zur Oeffnung p1 heraus; letztere hat eine solche Lage, daſs der Unterfaden gleichzeitig
mit dem Oberfaden angezogen wird. Die Fadenbremse des Schiffchens (Fig. 3) hat ein mit
letzterem verbundenes Bremsplättchen w2, dessen Einschnitte die sichere Leitung des Fadens
wahrt. Auf dieses Plättchen wird das mit dem Stifte v
verbundene Plättchen u1
mittels der Feder w gedrückt, welche sich gegen die
Schraubenmutter v1 legt
und durch Drehung derselben eine Veränderung der Fadenspannung gestattet.
Stoffrückereinrichtung (Fig. 4): Die unter der
Nähplatte gelagerte Welle z trägt am vorderen Ende ein
Excenter t, auf welches der Schiffchentreiber mm1 geschraubt ist und
das sich in einem quadratischen Rahmen des Hebels kk1 führt; letzterer hat seinen Drehpunkt w1 in dem schwingenden
Arme n oder ist mittels eines Langloches an einem
feststehenden Bolzen geführt. Das andere Ende des Hebels kk1 steht durch das Zwischenglied l mit dem Transporteur d
in Verbindung, welcher sich in den Vorsprüngen c, c1 des Ringes A2 führt. Das Zwischenglied l bildet einen doppelarmigen Hebel, dessen Drehpunkt g1 durch den Hebel g verändert und somit die Stichgröſse nach Belieben
eingestellt werden kann. Der als Drehpunkt dienende Bolzen g1 findet seine feste Stütze in einem
Schlitze des am Ringe A2 angegossenen Theiles h.
Diese von C. v. Rein angegebene Stoffrückereinrichtung
arbeitet vollständig ohne Federn. Junker und Ruh haben
dieselbe noch etwas verändert, weil es unbequem ist, die Stichstellung nur unterhalb
der Nähplatte vorzunehmen, indem sie den Hebel g in
Richtung der Längsachse der Maschine legen, den Drehpunkt desselben nicht am Ringe
A2
, sondern an der Nähplatte anbringen und das hintere
Ende des Hebels mit einer
Sehraube verbinden, deren Höhenlage sich durch eine über der Nähplatte angeordnete
Mutter verstellen läſst.
Die Nadelstange erhält ihre auf und ab gehende Bewegung durch Hebel, Zugstange und
ein am Schnurwürtel angegossenes Kreisexcenter; neben diesem, auf gleicher Welle,
sitzt ein Cylinder mit Curvennuth, durch die der Fadenheber bewegt wird, welcher die
erforderliche Fadenmenge abgibt bezieh. den Anzug des Stiches bewirkt.
Die beschriebene Schiffcheneinrichtung bedingt beim Spulenwechsel, also beim
Neueinziehen des Unterfadens, das vollständige Entfernen des Schiffchens aus seiner
Bahn; bei Junker und Ruh kann aber das Schiffchen in
seiner Bahn verbleiben. Das Schiffchen besteht nämlich aus zwei Theilen, dem
eigentlichen Schiffchenkörper, welcher mit demjenigen in Fig. 1 übereinstimmt, und
dem Spulenhalter mit dem Fadenleiter; dieser Theil ist umklappbar. Die
Unterfadenspannung wird durch die Bremsung der Spule erzeugt, indem die beiden
Kegel, welche letztere halten, durch eine Schraube näher an einander gerückt werden
können.
Die Bremsung der Spule hat immer eine wechselnde Spannung des Fadens durch die
Abnahme des Bewickelungsdurchmessers, also auch eine unregelmäſsige Naht zur Folge;
anderentheils besitzen auch die käuflichen Spulen verschiedene Länge und Bohrung, so
daſs sich Junker und Ruh (* D. R. P. Nr. 30934 vom 24.
August 1884 und Nr. 38169 vom 27. Januar 1886) veranlaſst sahen, eine bestimmte Spule zu verwenden und derselben die in Fig. 5 Taf. 6
ersichtliche Lagerung im Schiffchen zu geben. Der cylindrische Schiffchenkorb a trägt in seiner Mitte den Stift b; über diesen schiebt man den hohlen Bolzen c, welcher in die Spulenkapsel g und den Fadenleitsteg d eingeschraubt ist.
Um den Bolzen c dreht sich die Hülse 0, deren Nase in
eine Nuth der Spule f eingreift. Eine Feder e1 bremst die Hülse,
wodurch die Spule beim Drehen des Schiffchens um dieselbe und während des
Fadenabzuges so viel Reibung erhält, daſs der Faden stets straff gehalten wird und
sich nicht verwirren kann. Von der Spule aus läuft der Faden durch ein Loch der
Kapsel g und durch die beiden Oeffnungen des
Fadenleitsteges d. Eine Feder h, deren Druck durch die Schraube i regulirt
werden kann, ertheilt dem Faden die erforderliche Spannung. Das Loch in der Kapsel
g, durch welches der Faden geleitet wird, ist durch
einen Schlitz vom Rande aus zugänglich und die Feder h
hat eine solche Form, daſs die Einziehung des Fadens leicht bewirkt werden kann.
Nimmt die Spule an der Drehung des Schiffchens oder des Greifers theil, wie z.B. in
Fig. 1, so
wird der abgewickelte Unterfaden bei jedem Stiche eine Drehung um seine Achse
erhalten, so daſs derselbe noch mehr gezwirnt oder aufgedreht wird, je nachdem der
Faden vorher rechts oder links gezwirnt war, oder das Schiffchen die eine oder
andere Drehrichtung besitzt. So kommen z.B. bei dem gebräuchlichen Nähzwirn auf
100mm Fadenlänge im Mittel 120 Drehungen.
Nimmt man nun die
Stichlänge zu 1mm an, so wird das Schiffchen dem
Faden 100 Umdrehungen ertheilen und diesen fast vollständig auf- oder denselben noch
einmal so stark zusammendrehen; beides ist aber für die Festigkeit der Naht
nachtheilig. Bei kreisenden Schiffchen sucht man daher die Drehung der Spule durch
den Fadenabzug zu verhindern (vgl. Fig. 1 bezieh. Brünchner 1883 248 * 231),
oder man hat auch kreisende Schiffchen wieder verlassen und in schwingende
umgewandelt (vgl. z.B. Freckmann 1883 248 * 233).
Duplirt man mehrere Fäden, so kann man diese durch das kreisende Schiffchen beim
Nähen zwirnen und dies benutzen Junker und Ruh (* D. R.
P. Nr. 28850 vom 1. April 1884) um eine Ziernaht durch das
kreisende Schiffchen zu erhalten. Das in der vorher beschriebenen Weise
geführte und angetriebene Schiffchen A (Fig. 6 und 7 Taf. 6) mit Verstärkung
A1 enthält die
excentrisch angeordnete Spule, deren Achse senkrecht gegen ersteres liegt. In das
Centrum des Schiffchenhohlraumes ist ein Stift f
eingeschraubt, über welchen eine Hülse e mit Deckel d und den Fadenführungen i
und k geschoben wird. Um diese Theile in ihrer Lage zu
sichern, ist der Schnapper g angebracht, welcher mit
einem Stifte h in ein Loch des Deckels d greift und hierdurch als Mitnehmer dient. Auf der
Hülse e steckt leicht drehbar eine beliebige Anzahl
Spulen a, b, c, deren Fäden aus einer
gemeinschaftlichen Oeffnung treten und durch Drehung des Schiffchens gezwirnt
werden.
Um diese Maschinen auch für den gewöhnlichen Steppstich gebrauchen zu können, wobei
also der Schiffchenfaden nur von einer Spule abgezogen wird, schlägt man den
Schnapper um 180° um, so daſs der Mitnehmerstift nicht mehr in sein Loch eingreift
und nun die Spannung des Schiffchenfadens die Drehung der Spule verhindern kann.
Um eine gleichmäſsige Spannung des Unterfadens und ein regelmäſsiges Anziehen des
Stiches zu erhalten, gibt J. A. Döring in Leipzig (* D.
R. P. Nr. 22048 vom 28. Juni 1882) seiner Nähmaschine mit
kreisender Spulenkapsel, welche zugleich als Greifer dient, folgende
Einrichtung: Die Schnurscheibe bewegt durch Zahnräder sowohl die im Maschinenarme,
als auch die unterhalb der Nähplatte gelagerte Welle h
(Fig. 8
und 9 Taf. 6);
letztere ertheilt durch Winkelräder f und g der mit einem Stifte b
versehenen Mitnehmerscheibe e und dadurch der
Spulenkapsel oder dem Schiffchen a eine gleichmäſsige
Drehung, welches auf einem Rande des auf der Nähplatte festgeschraubten Gehäuses c ruht. Dieses Gehäuse ist kegelförmig ausgedreht und
das Schiffchen an seiner Auſsenfläche dem entsprechend geformt, um bei der Abnutzung
die centrische Führung zu wahren. Das Schiffchen wird durch eine ringförmige
Deckplatte d gehindert, beim Auswechseln der Spule mit
ausgehoben zu werden, und eine verschiebbare Deckplatte verschlieſst die ganze
Schiffcheneinrichtung. Die Mitnehmerachse liegt excentrisch zur Schiffchenachse, so
daſs der Stift b eine bestimmte Bewegung in der Grube
des Schiffchens ausführt.
Diese Bewegung besitzt nachstehenden Zweck: Hat der Greifer die kleine Nadelschleife
gefangen, so erfolgt bei der weiteren Drehung desselben die Erweiterung dieser
Fadenschleife; dabei gleitet dieselbe in der Grube weiter und fällt bei der halben
Umdrehung des Schiffchens in den Einschnitt a1. Gleichzeitig hat sich aber der Stift b vor diesen Einschnitt a1 gelegt und verhindert das Freiwerden
der Schleife fast bis an das Ende einer Umdrehung. In dem Maſse nun, wie bei der
zweiten Hälfte der Schiffchendrehung die Grube mit der Fadenschleife näher zur Nadel
rückt, findet das allmähliche Anziehen der Schleife durch einen Fadenhebel statt.
Durch die eigenartige Wirkung des Schlingenhalters a1 wird die Fadenschleife von der öligen
Schiffchenbahn c fern gehalten und dadurch eine sehr
saubere Naht erzielt.
Zur Hervorbringung der gleichmäſsigen Unterfadenspannung
ist die Spule m (Fig. 8 bis 10 Taf. 6) über den
Hohlzapfen einer kleinen Trommel n geschoben; diese
besitzt an einer Stelle der Wand eine Oeffnung, aus welcher der Spulenfaden tritt.
Hierauf wird der Faden der Spannung entsprechend etwa zweimal um die Trommel
geschlungen und schlieſslich durch eines der drei im oberen Rande angebrachten
Löcher gezogen. Die kleine Trommel n wird dann leicht
drehbar auf den Bolzen m1 geschoben und bei der Drehung des Schiffchens durch den abgezogenen
Faden verhindert, an der Drehung theil zu nehmen. Die Spannungsreibung dieses Fadens
ist eine sehr gleichmäſsige, welche nicht durch die verschieden groſsen
Bewickelungsdurchmesser der Spule beeinfluſst wird. Der Stoffrücker wird durch das
Excenter k gehoben und gesenkt, sowie vor und zurück
geschoben und die Stichlänge auf gleiche Weise wie bei der Kettenstichmaschine von
Wilcox und Gibbs veränderlich gemacht.
Die Doppelsteppstich-Nähmaschine mit einem
Schlingencrweiterer zur Verwendung groſser Unterfadenspulen von J. Bühr in Hamburg (* D. R. P. Nr. 24774 vom 24. Januar
1883) ist in Betreff des Schlingenerweiterers derjenigen von Stresemann (1883 250 * 511) sehr ähnlich,
dagegen abweichend und neu im Prinzipe ist die zweite von Bühr angegebene Einrichtung (* D. R. P. Nr. 25154 vom 27. Juni 1883), bei
welcher das Schiffchen selbst den Schlingenerweiterer enthält. Der Spulenträger oder
das Schiffchen a (Fig. 11 und 12 Taf. 6)
besteht aus einem aus Blech gefertigten Rahmen a mit
einer eigenthümlich geformten Spitze b und kann bei
gleicher Einrichtung geradlinig, im Bogen oder im Kreise bewegt werden. Die
käufliche Spule f steckt lose auf einem eingeschraubten
Bolzen und wird durch eine am Rahmen a befestigte Feder
e am zufälligen Verdrehen gehindert. Die
Schiffchenspitze b und die eine Spitze des
Schlingenerweiterers d fangen gemeinschaftlich die
Nadelschleife und beim Weitergehen des Schiffchens drückt ein Arm des Hebels c, sobald dessen anderer Arm am Ende einer Nuth g1 der Schiffchenbahn
g anlangt, so weit nach vorn (Fig. 12), daſs nun das
Schiffchen mit seiner Spule durchschlüpfen kann, worauf der Fadenheber den Stich
anzieht. Ist der Hebel c durch den Rücklauf des
Schiffchens wieder in seine Nuth getreten, so zieht eine Feder den
Schlingenerweiterer in seine anfängliche Lage zurück. Das Schiffchen wird in
einfacher Weise durch einen Treiber, auf welchem es gleichzeitig ruht, bewegt.
Eine eigenthümliche Einrichtung zeigt die Doppelsteppstich-Nähmaschine zum Vernähen sehr groſser Unterfadenspulen
von G. Mertens in Berlin (* D. R. P. Nr. 28535 vom 14.
September 1883). Ein Cylinder a (Fig. 13 und 14 Taf. 6) ist
an die Nähplatte gegossen und steht durch Schrauben b
in Verbindung mit einem Teller c; letzterer dient zur
Führung des frei um erstgenannten Cylinder a drehbaren
Zahnrades d, welches doppelt so viel Zähne besitzt als
das Triebrad d1. Das
Zahnrad d dient zur Befestigung und Bewegung zweier
Greifer bezieh. Fadenführer e und f. In einer lothrechten Nuth des Cylinders a wird ein Greifer g1 welcher zunächst die Nadelschleife zu erfassen
hat, auf und nieder bewegt. Dieser Greifer g dreht sich
um ein Gelenk h, wenn beim Niedergange desselben sein
Daumen an das Streichblech r antrifft. Ferner kann sich
derselbe noch um das Gelenk i drehen, dessen Lage um
90° gegen das erste gewendet ist. Jeder Gelenkbolzen ist mit einer Spiralfeder
versehen, durch welche der Greifer die gezeichnete Stellung einzunehmen sucht. Zur
Bewegung des Greifers g wird sein Träger von einer
Gabel g1 umschlossen,
deren Schwingungen durch Vermittelung der Welle l mit
Arm l1 von einem
Kreisexcenter in aus erfolgen. Dieses Kreisexcenter
sitzt auf der Triebwelle, so daſs der Greifer g bei
einer Bewegung des groſsen Rades d zweimal gehoben und
gesenkt wird, also bei jedem Nadelhube einmal. Am unteren Ende der Greiferführung
ist ein Fadenhalter n angebracht, welcher sich um einen
Bolzen dreht und durch eine Feder nach dem Inneren des Cylinders a gedrückt wird und somit den Fadenführern e und f weichen kann.
Der Spulenhalter ist ein Rahmen g, welcher von vier
Winkelhebeln p frei schwebend gehalten wird; die Federn
x drücken diese Winkelhebel entsprechend an;
letztere haben ihren Drehpunkt im festliegenden Teller c und somit bleibt der Rahmen mit seiner Spule still stehen, während die
Fadenschlinge darüber hinweg geführt wird. Hierbei werden aber die Winkelhebel pp1 durch die Knaggen
s der Führer e, f
einzeln von dem Spulenrahmen entfernt, so daſs der Faden durchschlüpfen kann.
Um verschieden hohe und in der Bohrung beliebig weite Spulen auf den mit zwei
Körnerspitzen versehenen Bolzen stecken zu können, gibt Mertens eine praktische Einrichtung an. Auf dem Bolzen c (Fig. 15) sitzt die Hülse
u fest, dagegen t
lose; vier Blattfedern v verbinden beide Hülsen. Steckt
man die Spule auf, so drücken sich die Blattfedern entsprechend zusammen und die
obere Hülse schiebt sich dabei etwas vorwärts. Die Spule ist sofort centrirt und
wird fest an ihrem Platze gehalten. Die obere Körnerspitze des Bolzens c ist
beweglich, um das Einsetzen in den Rahmen q zu
ermöglichen.
Die Stichbildung ist nun folgende: Hat die Nadel in den
Stoff gestochen und sich wieder so weit erhoben, daſs sich eine kleine Schlinge
bildet, so tritt der Greifer g in diese und zieht sie
bei seinem Niedergange lang. Dabei wird durch die gewundene Form des Greifers die
Schlinge gedreht, so daſs nun der Fadenführer e oder
f mit seiner Spitze in dieselbe treten und diese
abnehmen kann; der Greifer wird hierauf durch die Berührung des Führers zur Seite
gedrückt, um diesen vorüber zu lassen. Der Faden y1 geht jetzt (den Fadenführer noch in der Nähe des
Greifers g gedacht) senkrecht abwärts, um die untere
Rinne e1 herum, sodann
nach oben, um die Rinne e2 und nach dem Stichloch zurück. Der Fadenführer hat während des Fangens
der Schlinge den Fadenhalter n zurück gedrückt; dieser
schnellt jedoch beim Vorübergehen von e vor und tritt
zwischen Faden y1 und
Führer e, den Faden erfassend. Der Führer e wird durch das Zahnrad d
weiter bewegt, die Winkelhebel p nach der Reihe
zurückgeschlagen und der Faden, welcher jetzt ziemlich die Form eines
Parallelogrammes besitzt, gleitet über die Spule y. Bei
der halben Drehung des Führers e fällt der Faden ab.
Mittlerweile ist der Stoff verschoben worden, die Nadel hat bereits eingestochen und
eine kleine Schlinge gebildet, welche der Greifer g
fängt und verlängert; dabei wird aber die frühere Schlinge vom Fadenhalter n entfernt. Sofort tritt der zweite Fadenführer f in Thätigkeit und, indem er die neue Schleife
erweitert, wird die alte angezogen und der Stich vollendet. Der Anzug des Fadens
erfolgt also, wie bei der Wheeler-Wilson'schen Maschine
nach dem zweiten Nadelhube, so daſs sich der Faden an zwei Stellen im Stoffe reibt,
was vorzugsweise dem Nähen harter oder starker Waaren hinderlich ist und die
Festigkeit der Naht vermindert. Die beschriebene Einrichtung erlaubt zwar die
Anwendung sehr groſser Unterfadenspulen; doch dürfte dieselbe nicht einfach genug
sein, um Dauerhaftigkeit bei schnellem Gange zu besitzen.
Tafeln