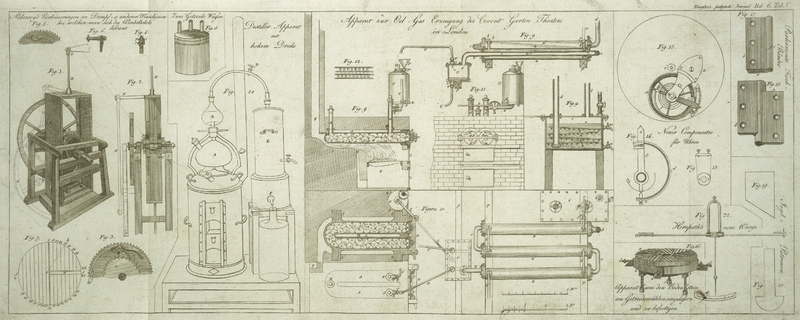| Titel: | Erklärung des dem Wilh. Aldersey, Gentleman zu Homerton, in der Pfarre Hackney, Grafschaft Middlesex, ertheilten Patentes auf eine Verbesserung an Dampf- und anderen Maschinen, bei welchen man sich des Winkelhebels bedient. Dd. 3. Februar 1821. |
| Fundstelle: | Band 6, Jahrgang 1821, Nr. LVIII., S. 353 |
| Download: | XML |
LVIII.
Erklärung des dem Wilh. Aldersey, Gentleman zu Homerton, in der Pfarre Hackney, Grafschaft Middlesex, ertheilten Patentes auf eine Verbesserung an Dampf-
und anderen Maschinen, bei welchen man sich des Winkelhebels bedient. Dd. 3. Februar 1821.
Aus dem Repertory of Arts, Manufactures et Agriculture. N. CCXXXII. September 1821. S. 193.
Mit Abbildungen auf Tab. V.
Ueber Verbesserung an Dampf- und anderen Maschinen.
Ich erklaͤre, daß meine Erfindung in der folgenden
Beschreibung und in den beigefuͤgten Zeichnungen deutlich beschrieben und
dargestellt ist; naͤmlich: statt eines sich drehenden Winkelhebels und einer
Verbindungsstange, um ein Flug- oder anderes Rad oder Raͤderwerk einer
Maschine, welcher ich eine umwaͤlzende Bewegung mittheilen will, mit der
bewegenden Kraft in Verbindung zu sezen, welche von der Art seyn muß, daß sie, wie
die Dampfmaschine eine abwechselnde Bewegung hervorbringt, verbinde ich beide
entweder unmittelbar, oder mittelst eines Balkens, oder mittelst Zahnraͤder
oder Ausschnitte von Raͤdern und eines Gestelles, welches einen doppelten
Sperrhaken oder ein Paar Sperrhaken besizt, welche gleichfalls eingekerbt oder
gezaͤhnt sind, alles stark genug um der Kraft der Maschine, oder der Last,
welche sie zu uͤberwaͤltigen hat, zu entsprechen. Die Form und
Stellung dieser Raͤder gegen einander ist in der beigefuͤgten
Zeichnung deutlicher zu erkennen, in welcher Taf. V. Fig. 1. A
den Theil einer Achse
darstellt, welcher eine umwaͤlzende Bewegung mitgetheilt werden soll. Ein
Flugrad BB ist in der Zeichnung an dem
entgegengesezten Ende der Achse angebracht: dieses Rad kann angestekt werden, oder
nicht, je nachdem man es fuͤr die Maschine noͤthig findet; es macht
aber keinen Theil meiner Erfindung aus, und ich ziehe den Gebrauch desselben nur
deßwegen vor, weil es die Bewegung mehr gleichfoͤrmig macht, und behalte es
daher auch in allen jenen Faͤllen, in welchen es ehevor angewendet wurde. An
irgend einer schiklichen Stelle der Hauptachse A
befestige ich ein metallnes Rad, dessen Zaͤhne wie an einem Stellrade gebaut
sind. Die Lage dieses Stellrades zeigt die Figur in C.
Dieses Rad muß an der Achse, an welcher es zu stehen kommt, so stark befestigt
werden, sey es nun durch ein vierekiges Gefuͤge oder auf was immer
fuͤr eine Weise, daß es sich durchaus nicht drehen oder bewegen kann, ohne
die Achse zugleich mit zu drehen, oder zu bewegen. Auf jeder Seite dieses Stellrades
bringe ich zwei Zahnraͤder oder Triebstoͤke an, welche von
groͤßerem Durchmesser sind, als besagtes Stellrad, und zugleich stark genug,
jeden Widerstand der Maschine zu gewaͤltigen. Diese beiden lezten
Raͤder sind in D und E dargestellt, und haben eine abwechselnde Bewegung auf der Achse, mit
welcher sie gleichen Mittelpunkt der Bewegung, so wie das Stellrad, besizen. Sie
sind aber nicht auf dieser Achse befestigt, sondern koͤnnen sich frey auf
derselben umher bewegen. In dieser Hinsicht werden auch jene Theile der Achse, um
welche sie laufen, vollkommen glatt und cylindrisch abgedreht, und die
Mittelloͤcher dieser Raͤder so vorgerichtet, daß sie genau auf dieses
cylindrische Lager passen. Die Raͤder D und E muͤssen ferner so nahe neben dem Stellrade C stehen, daß kaum das eine ohne das andere sich frey
und ohne alle Reibung bewegen kann, welcher man entweder durch Bukeln, Schultern,
Waͤscher, Schluͤssel, Stifte oder auf andere bekannte Art vorbeugt, sey es nun, daß
man diese Hilfsmittel an oder auf der Hauptachse A, oder
an der inneren oder aͤußeren Seite der beiden besagten Raͤder D und E, oder an dem
Stellrade C anbringt. i ist
ein Sperrhaken, Stellhaken, oder eine Klinke innenwendig in dem Rade D stark und so befestigt, daß er sich drehen und einen
Theil eines Kreises beschreiben, und sein aͤußeres Ende, welches sich in
demselben bewegt, in die Zaͤhne des Stellrades C
einfallen und einen Zahn desselben ergreifen kann. k ist
eine Feder, gleichfalls innenwendig in dem Rade D
befestigt, welche auf den Ruͤken oder auf die aͤußere Seite des
Stellhakens druͤkt, und so die gehoͤrige und geeignete Wirkung
desselben zwischen diesen Zaͤhnen sichert. Ein aͤhnlicher Sperrhaken
oder Klinke, und eine aͤhnliche Feder ist auf dieselbe Weise auch in dem Rade
E angebracht, kann aber in der angefuͤgten
Zeichnung wegen der Undurchsichtigkeit des Rades nicht dargestellt werdenDer Uebersezer findet auch l und k nicht im Originale. A. d. Ueb.. Man wird nun einsehen, daß, wenn die Raͤder D und E sich mehr als ein Drittel oder Viertel
in entgegengesezter Richtung drehen sollen, die Sperrhaken und Federn leer laufen,
oder in Beruͤhrung mit einander kommen, selbst wann sie an entgegengesezten
Punkten in beiden Raͤdern befestigt sind; und daß daher das Stellrad C von hinlaͤnglicher Dike oder Weite seyn muß, um
den Sperrhaken der beiden Raͤder D und E zwischen seinen zwei entgegengesezten Seiten
aufzunehmen, so daß es niemals die Moͤglichkeit gestattet, daß diese beiden
Sperrhaken, oder die Bolzen, Stifte oder andere Vorrichtungen, durch welche sie an
den Seiten der beiden Raͤder D und E angebracht sind, mit einander in Beruͤhrung
kommen; in einigen Faͤllen wird es daher gut seyn, das Stellrad selbst weiter und diker zu
machen, als noͤthig, weil dadurch die Raͤder D und E an der Hauptachse in jeder beliebigen
Entfernung von einander gestellt und angebracht werden koͤnnen, und man auf
die Weise leicht zu den Sperrhaken und Federn gelangen kann, wenn es noͤthig
ist sie zu oͤlen, oder auszubessern. FF ist ein starkes Gestell aus Holz gezimmert, oder aus Metall oder aus irgend
einem anderen schiklichen Materiale; es kann aus einem oder aus mehreren
Stuͤken und entweder in der in der Zeichnung vorgestellten Form oder
kreisfoͤrmig oder elliptisch oder auf eine andere Art sich endend, wohl auch
an einem Ende ganz offen verfertigt werden. Ein Ende dieses Gestelles, wie bei G, kann durch ein Nußgefuͤge oder auf irgend
eine, andere schikliche Weise mit dem Ende des Balkens oder Hebels verbunden werden,
welcher durch die Dampfmaschine oder durch irgend eine andere bewegende Kraft in
eine abwechselnde geradelinige Bewegung gebracht werden soll. Oder, wenn man
annimmt, daß die Zeichnung umgekehrt waͤre, kann H die Staͤmpelstange einer Dampf-Maschine seyn, welche auf
diese Weise unmittelbar ohne Dazwischenkunft eines Balkens, paralleler Bewegungen,
oder irgend eines jener Theile, welche viele Reibung oder Traͤgheitskraft an
der Maschine erzeugen, auf ihr Werk wirkt. Dieses ganze Gestell bewegt sich
abwechselnd auf und nieder, und kann, in dieser Bewegung durch die Seitenbalken oder
Stuͤke IIII erhalten werden, welche
noͤthigen Falles auch mit Reibungsrollen oder an denselben angeblachten
Raͤdern zur Verminderung der Reibung versehen seyn koͤnnen; oder, wenn
es mit einem Apparate zu paralleler Bewegung verbunden oder so vorgerichtet ist, daß
es in geradeliniger Richtung sich auf und nieder bewegt, kann das Ganze durch die
Staͤmpelstange selbst geleitet werden, oder durch zwei oder drei, wie II
gestellte Stangen, welche ober und unter dem Gestelle angebracht sind; wie z.B. eine
bei H, und eine oder zwei, die in die Loͤcher bei
LL passen: das Ganze muß dann so vorgerichtet
seyn, daß es durch Stellloͤcher in dem Gestelle auf und nieder gleitet. Wenn
aber das Gestell in der Form arbeiten soll, in welcher es hier gezeichnet, und nicht
an dem Apparate zur Parallelbewegung mittelst des Balkens verbunden ist, und nicht
eine gerade Bewegung auf- und abwaͤrts hat, dann muß es durch Rollen
in seiner Lage erhalten werden, und die Freyheit haben zu streifen, so daß es etwas
aus die Seite gehen kann, was uͤbrigens seiner Wirkung nicht schaden wird.
Dieses Gestell ist wegen zweier gezaͤhnter Stangen da, wovon die eine bei K frey und ganz, die andere bei M nur theilweise mit ihren Zaͤhnen sichtbar ist. Diese
gezaͤhnten Stangen stehen nicht einander gegenuͤber, sondern sind so
in dem Gestelle angebracht und befestigt, oder aus einem Stuͤke mit dem
Gestelle selbst verfertigt, daß sie genau in die Zaͤhne oder Kerben der zwei
Raͤder D und E
passen; so greift die gezaͤhnte Stange K in die
Zaͤhne des Rades D, waͤhrend M in E eingreift. Die Folge
davon ist, daß, sobald das Gestell und die gezaͤhnten Stangen entweder
auf- oder abwaͤrts bewegt werden, und dieß entweder hoch oder tief,
die beiden Raͤder D und E gleichfoͤrmig, aber in entgegengesezter Richtung, umgetrieben
werden; denn waͤhrend das eine sich rechts bewegt, muß das andere sich links
drehen, und umgekehrt, und dieß aus dem Grunde, weil die gezaͤhnten Stangen
sich auf entgegengesezten Seiten der Achse befinden, welche umgedreht werden soll.
Und da diese Raͤder diese entgegengesezte Bewegung erhalten, so ist es
offenbar, daß der eine Stellhaken des einen Rades auf die Zaͤhne der einen
Seite des Stellrades stossen, und so auf dieselben wirken wird, daß er dasselbe
umtreibt, waͤhrend der andere Stellhaken des anderen Rades auf der
entgegengesezten Seite des Stellrades sich von diesem in einer solchen Richtung
zuruͤkzieht, daß er nicht mehr auf die Zaͤhne wirken kann; und folglich muß
das Gestell, es mag auf- oder niedergezogen werden, stets die Wirkung
hervorbringen, daß das Stellrad, und folglich auch die Achse, an welcher dasselbe
auf die obenbeschriebene Weise befestigt ist, umgedreht wird. Der Stoß, den das
Gestell FF mittheilt, mag stark oder schwach seyn
(wenn er nur so stark ist, daß er den Stellhaken uͤber einen einzigen Zahn
des Stellrades fuͤhrt) die Wirkung wird stets und ununterbrochen dieselbe
seyn. Dieß ist der Grundsaz, auf welchem meine Erfindung beruht, und dessen
Anwendung bei dem einzelnen Falle und in der Form, wie oben angenommen wurde, nicht
mißverstanden werden kann: es wird aber zugleich jedem Mechaniker einleuchtend seyn,
daß eine Menge verschiedener Formen und Anwendungen hier moͤglich ist. So
kann z.B. das Gestell, statt daß es sich senkrecht bewegt, in eine horizontale, ja
sogar in eine schiefe Lage gebracht werden, und die Kraft kann folglich von oben,
von unten, oder von der Seite wirken. Die Vortheile, welche diese Erfindung bei
Verwandlung einer abwechselnden geradelinigen Bewegung in eine umwaͤlzende
vor einem gewoͤhnlichen Winkelhebel voraus hat, dessen man sich
gewoͤhnlich zu dieser Absicht bedient, sind 1stens, daß die bewegende Kraft,
welche hier stets an dem Ende des Halbmessers der Raͤder D und E angebracht wird,
stets gleichmaͤßig wirkt, und nicht mit jenem großen Verluste und jener
Ungleichheit verbunden ist, welche bei einem Winkelhebel unvermeidlich wird, wo die
Hebelkraft von o, auf welchem sie am Mittelpunkte ist,
schnell bis zum Maximum steigt, wenn sie mit der Verbindungsstange einen rechten
Winkel bildet. 2tens, daß es bei vielen Maschinen nothwendig ist, daß die Hauptachse
sich stets nach einer Richtung drehe, welches bei einem Winkelhebel nicht immer
moͤglich ist, durch meine Erfindung aber sicher und leicht bewerkstelligt
wird. 3tens kann die Kraft gleich vorteilhaft oben oder unten oder auf der Seite angebracht werden,
ohne jener Genauigkeit bei der Einrichtung zu beduͤrfen, welche bei dem
Winkelhebel noͤthig ist. 4tens endlich ist bei dem Winkelhebel immer
staͤte und gleiche Quantitaͤt der Bewegung oder Laͤnge des
Stoßes bei jedem Wechsel der treibenden Kraft noͤthig, wenn eine umdrehende
Bewegung hervorgebracht werden soll; meine Erfindung theilt aber eine solche
Bewegung mit, wenn auch die treibende Kraft unregelmaͤßig ist, oder sich in
ihrer Bewegung veraͤndert. Ich bin daher durchaus nicht an irgend eine
besondere Laͤnge des Stoßes gebunden, und da mein Stellrad, so wie das Rad
D und E, nicht in
demselben Verhaͤltnisse seines Durchmessers zu der Laͤnge des Stoßes
steht, wie der Winkelhebel, so kann ich die Groͤße derselben nach Belieben
vermehren oder vermindern, und dadurch nicht bloß die Schnelligkeit meiner Maschine
aͤndern, sondern auch die bewegende Kraft in verschiedener Entfernung von dem
Mittelpunkte der Achse A anbringen, was vielen Vortheil
in der Anwendung gewaͤhrt. Es kann jedoch in manchem Falle nothwendig seyn,
den Stoß der Dampfmaschine oder der treibenden Kraft, an welcher meine Erfindung
angebracht werden soll, zu beschraͤnken, oder zu bestimmen, und ebenso auch
die Richtung, nach welcher die Hauptachse sich drehen muß, zu veraͤndern:
beides laͤßt sich ohne alle Schwierigkeit auf folgende Weise bewerkstelligen.
Um den Stoß zu beschraͤnken oder zu bestimmen, wird es nothwendig die
Bewegung des Gestelles FF zu beschraͤnken
oder zu bestimmen, und dieß bringe ich dadurch zu Stande, daß ich entweder irgend
einen Theil des Gestelles mittelst einer gewoͤhnlichen schwingenden
Verbindungsstange mit einem Winkelhebel und einem Flugrade verbinde, wie die
punktirten Linien in der Zeichnung bei NNN zeigen;
oder, wo ein Balken noͤthig ist, verbinde ich einen Theil desselben mit einem
solchen Winkelhebel und Flugrade, wodurch in jedem Falle die Laͤnge des
Stoßes der Maschine beschraͤnkt und bestimmt und dem Stoße jener Maschine
angepaßt wird, an welcher dieselbe angebracht werden soll. Wenn es noͤthig
ist die Richtung der Bewegung zu aͤndern oder umzukehren, so nehme ich ein
paar Stellraͤder, d.h., als Zugabe zu dem diken und weiten Stellrade D, welches sich zwischen den zwei Raͤdern D und E befindet, nehme ich
zwei andere Stellraͤder, welche entweder gleichen Durchmesser mit C haben koͤnnen oder nicht, aber eben so stark
seyn muͤssen: an diesen beiden hinzugefuͤgten Raͤdern
muͤssen aber die Spizen ihrer Zaͤhne nach der entgegengesezten Seite
von jenen in C hingekehrt seyn, und außen oder an der
aͤußeren Seite D und E angebracht werden, wie Fig. 2. zeigt, welche
einen Laͤngen-Durchschnitt der Raͤder an der Hauptachse
darstellt mit einem Centralstellrade und mit zwei aͤußeren oder verkehrt sich
drehenden Stellraͤdern. Dieselben Buchstaben bezeichnen in dieser Figur
dieselben Gegenstaͤnde, wie in Fig. 1.; folglich stellt
hier A die Hauptachse vor; B
das Flug- oder Schwung-Rad an dem einen Ende derselben; C das Stellrad in der Mitte; D und E die zwei Zahnraͤder oder
Triebstoͤke D und E,
welche in die gezaͤhnten Stangen eingreifen (von welchen bloß eine bei K dargestellt ist); F ein
Theil des Gestelles zur Aufnahme der gezaͤhnten Stange; ii die Stellhaken oder Klinken, welche in das
Stellrad C eingreifen; k die
Federn, welche auf die Stellhaken druͤken; N und
O die beiden aͤußeren in entgegengesezter
Richtung laufenden Stellraͤder N und O, deren Zaͤhne in entgegengesezter Richtung von
jenen des Stellrades in der Mitte C laufen; p die Stellhaken oder Klinken, welche in dieselben
eingreifen, und welche folglich gegen eine andere Seite stehen als jene an der
anderen Seite desselben Rades, welche auf das in der Mitte befindliche Stellrad
wirken. Es ist offenbar daß, bei der Anwendung dieser Erfindung, die inneren
Stellhaken oder Klinken ii, und die
aͤußeren pp, wenn zweierley Raͤder
angebracht werden,
nie zu gleicher Zeit in Thaͤtigkeit seyn koͤnnen, weil dadurch die
Maschine gesperrt, und ihre Bewegung gaͤnzlich aufgehoben werden
wuͤrde. Es ist daher, wenn man eine entgegengesezte Bewegung hervorbringen
will, nothwendig, nicht bloß auf die Lage dieser Sperrhaken besonders aufmerksam zu
seyn, sondern auch auf die Form der Zaͤhne; denn in diesem Falle
duͤrfen die wirkenden Flaͤchen derselben nicht
uͤberhaͤngen, sondern muͤssen in der Richtung der Halbmesser
des Stellrades stehen, wie yz in Fig. 3.; indem es sonst
unmoͤglich seyn wuͤrde, die Spizen der Stellhaken oder Klinken aus den
besagten Zaͤhnen, wenn die Maschine in Thaͤtigkeit ist,
herauszuziehen, ohne das Rad zuruͤkzutreiben um sie aus denselben zu
loͤsen. Wenn aber die Maschine bloß nach einer Seite treiben soll, so bedarf
es dieser verkehrt bezaͤhnten Raͤder nicht, und diese Aufmerksamkeit
waͤre dann uͤberfluͤssig, weil die Maschine nicht falsch laufen
kann. Um jedoch, wo die doppelte Bewegung gebraucht werden muß, jedem Nachtheile
vorzubeugen, bediene ich mich eines excentrischen Hebels, der verschieden gebaut
seyn kann, der mir jedoch so, wie er in q, r, s
Fig. 3 und
4.
dargestellt ist, am einfachsten zu seyn scheint. Fig. 3. zeigt einen
solchen Hebel in groͤßerem Maßstabe von vorne nebst einem Theile des
aͤußeren Stellrades O, seinem Stellhaken oder
seiner Klinke, und der Feder pk, wie sie an der
aͤußeren Seite des Rades E befestigt ist, und der
Stellhaken p ist in Thaͤtigkeit auf die
Zaͤhne des Stellrades O dargestellt. Der innere
Stellhaken, oder jener, welcher an der anderen Seite des Rades E befestigt ist, und folglich in dieser Figur nicht
gesehen werden kann, ist mit rother Dinte bei i
gezeichnetIn dem Kupferstiche durch punktirte Linien. A. d. O., um die Lage desselben zu zeigen, in welcher er sich befinden muß, wenn der
aͤußere Stellhaken p
gesenkt oder in
Thaͤtigkeit ist: woraus erhellt, daß, wenn p
gesenkt ist, i erhoben und vollkommen außer dem Bereiche
der Zaͤhne des inneren Stellrades C stehen muß,
welches gleichfalls mit rother Dinte angedeutet ist. Die Art, wie diese Lagerung der
Stellhaken entsteht, wird einleuchtend seyn, wenn man den Bau des excentrischen
Hebels betrachtet, welcher aus einer cylindrischen Stahl- oder anderen Achse
q besteht, welches durch das Rad E in einem Loche laͤuft, in das dieselbe so
ziemlich genau paßt, und worin sie auf dem RiebeWir wissen den bekannten Ausdruk friction tight
nicht besser zu geben. A. d. Ueb. laͤuft. Fig. 4. zeigt den
Durchschnitt eines Theiles des Rades E zugleich mit der
cylindrischen Achse des Hebels Q, und den beiden
excentrischen kleinen Sperrhaken oder Klinken r und s, welche auf vierekige Zapfen an den beiden Enden der
cylindrischen Achse q passen, und so befestigt sind, daß
der eine aufwaͤrts steht, waͤhrend der andere abwaͤrts geneigt
ist, wie man in beiden dieser lezten Figuren sieht. Aus der Lage dieser beiden
excentrischen kleinen Sperrhaken des Hebels in Fig. 3. erhellt, daß der
Sperrhaken p nicht in Thaͤtigkeit gesezt wird,
wenn der hervorstehende Theil r des vorderen kleinen
Sperrhakens niedergesenkt ist, weil er ihn nicht erreichen kann; wenn aber r niedergesenkt ist, wird der hervorstehende Theil s des inneren kleinen Stellhakens (hier mit rother Dinte
gezeichnet) aufwaͤrts stehen, und folglich den inneren Stellhaken oder die
Klinke i in die aufrechte Lage bringen, in welcher die
Zeichnung denselben darstellt. Wenn sich die Achse q um
die Haͤlfte dreht, wird die Lage der Stellhaken verkehrt, denn nun wird p aufgehoben und ausgeloͤset und i wird sich senken und in Thaͤtigkeit kommen. Der
vierekige Zapfen t an dem Ende der Achse q ist deßwegen vierekig, damit er mittelst eines
Schluͤssels, Spanners oder befestigten Hebels gedreht werden kann, und die
kleinen excentrischen Stellhaken werden durch kleine Zapfen oder Hervorragungen in
ihrer Naͤhe, sobald sie gedreht werden, in der gehoͤrigen Lage
erhalten: diese Zapfen fallen naͤmlich in correspondirende Vertiefungen an
der Unterseite der Sperrhaken ein, in welchen diese hierzu vorgerichtet sind. Die
Federn kk beugen dem Heraustreten der Zapfen aus
diesen Vertiefungen waͤhrend der Belegung der Maschine vor; eine kleine Kraft
jedoch, die auf die vierekigen Enden der Achse t, wirkt,
reicht zu, um sie aus denselben los zu machen, wenn die Zaͤhne des Stellrades
gehoͤrig, wie oben gesagt wurde, gebildet sind. Da die Vollkommenheit und
Sicherheit meiner Erfindung groͤßtentheils von der freien Bewegung der
Sperrhaken abhaͤngt, und zugleich von der Staͤrke derselben und der
Unmoͤglichkeit, los zu lassen, so brauche ich zuweilen bei jedem der beiden
Raͤder D und E zwei
Stellhaken, von welchen der eine außer Thaͤtigkeit gesezt werden kann, oder
nicht. Die Weise, wie dieselben in den Raͤdern D
und E befestigt werden muͤssen, verdient einige
Aufmerksamkeit: ich ziehe in dieser Hinsicht einen Bolzen vor, welcher mit einem
starken vierekigen Schenkel und einem Halse versehen ist, um dadurch fest in ein
Loch im Rade zu passen, so daß er ganz durch das Rad durchgehen, und mit einer
angeschraubten mit einem Stifte versehenen Niete, wodurch das Abschrauben desselben
unmoͤglich wird, an der aͤußeren Seite der besagten Raͤder
befestigt werden kann, waͤhrend der Sperrhaken selbst an einem
walzenfoͤrmigen hervorstehenden Ende dieses Bolzens sich dreht, wie x in Fig. 6 zeigt. Wenn die
Raͤder D und E aus
Gußeisen verfertigt sind, so kann an der Oberflaͤche derselben ein vertieftes
Lager, wie Fig.
5 zeigt, angebracht werden, in welches das Hintertheil des Sperrhakens
paßt, so daß es daran eine Stuͤze findet, auf welcher es ruhen kann, wenn allenfalls der Bolzen,
um welchen der Haken sich dreht, sich beugen oder anfangen sollte nachzugeben. Die
Ansicht der Haupt-Achse und die Durchschnitte der Raͤder, wie A in Fig. 2 sie darstellt,
werden uͤber die Form derselben hinlaͤnglichen Aufschluß geben, so wie
auch uͤber die Weise, nach welcher die verschiedenen Raͤder aufgesezt
und gestellt werden muͤssen. Der mittlere Theil A, z.B. muß vierekig oder vielekig seyn, damit das mittlere Stellrad C darauf befestigt werden kann, und dieser Theil kann
diker seyn, als jeder andere Theil der Achse, so daß er Schultern fuͤr die
Raͤder D und E
bildet, damit diese darauf ruhen koͤnnen: die Theile vv hingegen muͤssen rund seyn oder walzenfoͤrmig, damit die
Raͤder DE sich auf denselben drehen
koͤnnen. Mehr Schulter ist hier nicht noͤthig, außer wenn die Bewegung
verkehrt werden soll, und in diesem Falle sind noch zwei vierekige oder vielekige
Theile ww, fuͤr die aͤußeren
Stellraͤder N, O noͤthig, damit diese
darauf befestigt werden koͤnnen. Diese Raͤder koͤnnen durch
Laufscheiben oder Waͤscher xx, in ihrer Lage
erhalten, und diese Waͤscher selbst koͤnnen entweder aufgeschraubt,
oder, was noch besser ist, durch Querkeil-Schluͤssel, die durch
dieselben durchgetrieben werden, wie die Figur zeigt, befestigt seyn. Die Zapfen yy muͤssen in jedem Falle cylindrisch geformt
werden, weil die Achse sich mittelst derselben in ihrem Zapfen-Lager drehen
muß. Ich binde mich jedoch nicht an diese Form der Achse, weil jeder Mechaniker
weiß, daß, man dieselbe auf verschiedene Weise abaͤndern, und der Achse auch
eine andere Einrichtung geben kann, ohne daß ihre Wirkung dabei litte: ich
beschreibe sie daher bloß als eine Form, die man annehmen kann. Aus demselben Grunde
kann man auch Ausschnitte von Zahnraͤdern statt der ganzen Raͤder DE waͤhlen, vorausgesezt, daß diese Ausschnitte
eine hinreichende Menge von Zaͤhnen enthalten um mit der Laͤnge des Stoßes im
Verhaͤltnisse zu stehen, den die Maschine erfordert. Auch das Gestell und
andere Theile der Maschine duͤrfen eben nicht nach der in der Zeichnung
gegebenen Form verfertigt, sondern koͤnnen so veraͤndert werden, wie
es die verschiedenen Umstaͤnde bei Anwendung derselben erfordern. Das Ganze
meiner Erfindung und alles, worauf ich fuͤr mich selbst, meine Bestellten und
Administratoren, und Verordneten in Kraft des oben theilweise angefuͤhrten
Patentes Anspruch mache, ist die Anwendung der Kraft und Bewegung der treibenden
Kraft an dem aͤußersten Ende des Halbmessers zweier Raͤder mittelst
der oben beschriebenen gezaͤhnten Stangen, und die Uebertragung dieser Kraft
und Bewegung auf die Haupt-Achse mittelst eines Stellrades und der
Raͤder D und E nebst
den Sperrhaken oder Klinken, wodurch eine gleichfoͤrmige und kraͤftige
Wirkung statt der wandelbaren und haͤufig unbedeutenden des Winkelhebels
hervorgebracht wird; und da dieß auf die oben beschriebene Weise und nach den
daselbst aufgestellten Grundsaͤzen sowohl bei großen als bei kleinen, bei
hoͤlzernen wie bei metallnen oder aus was immer fuͤr einem Materiale
verfertigten Maschinen geleistet werden kann, so ist es unnoͤthig die
Dimensionen der verschiedenen Theile oder Materialien zu beschreiben, deren ich mich
bediene, indem diese, so wie die Form und Einrichtung des Gestelles und der
Raͤder sich nach der Lage schiken muͤssen, in welcher sie angewendet
werden sollen, und folglich verschiedener Abaͤnderungen faͤhig sind.
Obige Beschreibung wird indessen jeden geschikten Werkmeister in den Stand sezen,
meine besagte Erfindung auf jeden ihm vorkommenden Fall anzuwenden.
Urkunde dessen etc.
Bemerkungen des Patenttraͤgers.
Das Ziel, welches der Patenttraͤger bei dieser Erfindung sich vorstekte, ist,
die Bewegung gleichfoͤrmig zu machen, und vorzuͤglich die Kraft zu
ersparen, welche bei Dampfmaschinen so unnuͤz verloren geht, und auch bei
allen anderen Maschinen, bei welchen eine abwaͤrts, oder ruͤk-
und vorwaͤrts gehende Bewegung in eine kreisfoͤrmige verwandelt werden
muß. Die einfache Weise, auf welche dieses hier geleistet wird, wird, wie ich hoffe,
allen jenen, die solche Maschinen gebrauchen muͤssen, ein großes Desideratum
seyn, indem Ersparung an Kraft auch Ersparung an Kohlen, an Zugthieren ist, welche
bei dem steten Gebrauche einer Maschine mehr, kosten, als die Maschine selbst. Daß
diese Ersparung an Kraft durch diese Maschine wirklich hervorgebracht wird, wird
jenen hinlaͤnglich einleuchtend seyn, die Kenntnisse in der Mechanik besizen;
und um diejenigen hiervon zu uͤberzeugen, bei welchen dieß nicht der Fall
ist, habe ich folgende Figur (Fig. 7) beigefuͤgt,
durch welche die Wirkung eines gewoͤhnlichen Winkelhebels sinnlich
dargestellt wird.
Sezen wir c sey der Mittelpunkt der Bewegung eines
gewoͤhnlichen Winkelhebels, und of, of, der
Kreis, welchen sein sich drehendes Ende waͤhrend der Bewegung desselben
beschreibt. Wenn die Stange mit dem Winkelhebel so verbunden ist, daß sie entweder
von oben oder von unten wirkt, so wird sie durchaus keine Kraft besizen, den
Winkelhebel im Kreise zu bewegen, so lang sie in einer der beiden Lagen co und co sich befindet; sie
wird aber die moͤglich groͤßte Gewalt auf ihn in dem Augenblike
aͤußern, wenn sie in die Lagen cf, cf kommt. Die
Folge davon ist, daß, waͤhrend die Kraft den Winkelhebel noͤthigt,
sich von o nach f zu
bewegen, sie von Null zu ihrem Maximum fortschreiten muß. In dem naͤchsten
Viertel seiner Umdrehung, von f nach o, nimmt sie
wieder vom Maximum bis zu o ab, und so in jedem Viertel
seiner Umdrehung. Hie Kraft bleibt sich daher nie gleich, und wirkt in ihrer ganzen
Staͤrke nur dann, wann sie auf die beiden Punkte ff gelangt ist. Sezen wir die Kraft = 112 Pfunds so wird sie bei o zu Null, waͤhrend sie = 56 Pfund ist, wenn der
Winkelhebel sich in der Lage ch befindet, weil dann ihre
wirtliche Kraft auf den Punkt n wirkt, welcher gerade in
der Haͤlfte von cf liegt.
Liegt der Winkelhebel in f, so sind alle 112 Pfunde in
Thaͤtigkeit, und so zeigen die Figuren uͤber und unter der rechten
Seite des Halbzirkels die Zahl der wirklich in Thaͤtigkeit befindlichen
Pfunde, oder die wirklich in Thaͤtigkeit befindliche Kraft, welche 112
Pfunde, die bestaͤndig in Thaͤtigkeit sind, auf einen Winkelhebel in
den verschiedenen Lagen desselben aͤußern, waͤhrend die Figuren unter
der linken Seite des Halbzirkels den Verlust der Kraft in Pfunden bei dem Gebrauche
eines gewoͤhnlichen Winkelhebels ausdruͤken.
Man kann sagen, daß bei dieser Patent-Erfindung die beiden Zahnraͤder
D und E einen
Winkelhebel bilden, folglich diese Raͤder dem Kreise of, of, Fig. 7, aͤhnlich sind, und da die gezaͤhnten Stangen nur
bei den Punkten ff in die Raͤder wirken, so ist
es offenbar, daß ihre Wirkung gerade dort angebracht ist, wo sie am groͤßten
seyn muß, und dadurch, daß auf diese Weise aller Verlust an Kraft aufgehoben ist,
wird diese zugleich gleichfoͤrmig und staͤtig, indem sie bei keinem
Theile der Umdrehung groͤßer ist, als bei dem anderen.
Es waͤre uͤberfluͤßig noch einige Bemerkungen uͤber die
Vortheile, der Richtung, der Umdrehung, jede Sicherheit verschaffen, und dieselbe
noͤthigen Falles veraͤndern zu koͤnnen, beizufuͤgen,
indem diese jedem von selbst einleuchten werden, und bei dem Baue von DampfboͤthenWarum nicht auch bei dem Baue von Dampf-Kutschen, mit welchen man ohne
Pferde faͤhrt, und die jezt in England, wie wir hoͤrten,
gebaut werden? Die Englaͤnder werden ihre Dampf-Maschinen
endlich noch so sehr miniaturisiren, daß man sie in die Absaͤze
feiner Stiefel steken und so, ohne selbst den Fuß zu heben, wird gehen
koͤnnen. Deß moͤgen sich unsre Podagristen freuen. A. d.
Ueb. von der hoͤchsten Wichtigkeit seyn muͤssen. Wir hoffen, daß
der Apparat, durch welchen diese wohlthaͤtigen Wirkungen hervorgebracht
werden, so einfach, stark und so wenig dem Verderben ausgesezt ist, daß man beinahe
keine Einwendung gegen denselben wird aufzubringen vermoͤgen.
Tafeln