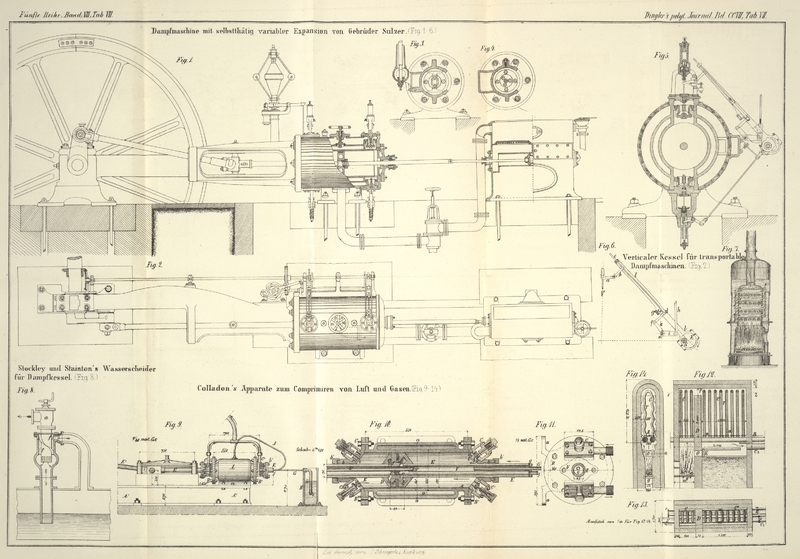| Titel: | Prof. Daniel Colladon's Apparate zum Comprimiren von Luft und Gasen behufs ihrer Verwendung als Triebkraft. |
| Fundstelle: | Band 207, Jahrgang 1873, Nr. XCIII., S. 345 |
| Download: | XML |
XCIII.
Prof. Daniel Colladon's Apparate zum Comprimiren von Luft und Gasen behufs ihrer Verwendung
als Triebkraft.
Aus Armengaud's
Publication industrielle, 1872, vol. XX p. 459.
Mit Abbildungen auf Tab.
VII.
Colladon's Apparate zum Comprimiren von Luft und Gasen behufs ihrer
Verwendung als Triebkraft.
Nachdem Colladon's
„Methode, Gas und Luft behufs der Verwendung als Triebkraft zu
comprimiren“, bereits im Jahrgang 1872 des polytechn. Journals, Bd.
CCV S. 519 im Princip mitgetheilt worden ist, lassen wir nun eine nähere
Beschreibung der hierzu dienenden Maschine, sowie des Apparates zur Wiedererwärmung
des comprimirten Gases folgen.
I. Compressionspumpe für Luft und
Gase.
Bei Herstellung dieser Pumpe sind von dem Erfinder zwei Fälle vorgesehen:
1) Abkühlung der inneren Theile des Pumpenstiefels, ohne Einführung von Wasser in den
Raum welchen die zu comprimirende Luft oder das Gas einnimmt;
2) Abkühlung der comprimirten Gase durch rasche und intermittirende Einspritzung von
Wasser in's Innere des Pumpenstiefels selbst.
Vorliegende Beschreibung bezieht sich nur auf den ersten Fall; bezüglich des zweiten
Falles verweisen wir auf die oben citirte Mittheilung im polytechn. Journal.
Fig. 9 stellt
den Pumpenkörper nebst Zugehör im Maaßstabe von 1/20 in der äußeren Ansicht dar. Das
Gestell, auf welchem er gelagert ist, nimmt auch die Führung der Kolbenstange und
die in der Abbildung nicht mehr sichtbare Kurbelwelle mit der Schubstange, welche
die Kurbel mit der Kolbenstange verbindet, auf. Fig. 10 ist ein achsialer
Horizontaldurchschnitt des Pumpenkörpers nach einem größeren Maaßstabe; Fig. 11 eine
Endansicht desselben.
Die Abkühlung der Luft oder des Gases, ohne Einführung von Wasser in's Innere des
Pumpenstiefels, erzielt der Erfinder durch eine Wassercirculation auf der äußeren
Seite des letzteren und innerhalb der Kolbenstange. Zu diesem Zwecke ist um den
Pumpenstiefel A, welcher mittelst Flantschen a an das Gestell A'
geschraubt ist, ein Mantel gegossen, wodurch ein zur Aufnahme des Kühlwassers
bestimmter ringförmiger Raum a' (Fig. 10) gebildet wird.
Die beiden Cylinderenden sind durch die conischen Deckel B und B' geschlossen, und jeder der letzteren
ist mit zwei rectangulären Oeffnungen versehen, in welche die Sitze der in den
Bronzekammern C und C'
spielenden Saug- und Druckventile c und c' eingepaßt sind. Die Deckel B und B' dienen der Kolbenstange als Führung,
indem diese durch Stopfbüchsen gleitet, welche mit Stulpliderungen b ausgestattet sind. Zur Sicherung der letzteren dienen
die Stopfbüchsendeckel b', welche auf die bei
Dampfmaschinen und Pumpwerten übliche Weise durch Bolzen und Muttern angezogen
werden. Der Kolben besteht aus zwei gegossenen Platten D
von der Form abgestumpfter Kegel, welcher an die hohle Eisenstange E geschraubt sind. Zwischen beide Platten ist als
Packung das doppelte Stulpleder d, sowie eine Scheibe
d' aus Gußeisen eingepreßt. In dem Kolben befinden
sich zwei ringförmige Höhlungen e und e', welche durch die Canäle f mit einander und durch die Löcher f' mit dem
Inneren der hohlen Stange E communiciren. Um das Wasser
in das Innere der Stange E einzuführen und in dem hohlen
Raum des Kolbens circuliren zu lassen, ist in dieser Stange ein kupfernes Rohr F angeordnet, welches sich einerseits in eine
Stopfbüchse mit Stulpliderung g endigt, durch die das
eiserne Rohr G tritt, andererseits sich bis zu dem am
Ende des Rohres G' angebrachten Klappenventil g' erstreckt. Das Rohr G'
ist mit einer Liderung h garnirt, welche eine
Scheidewand im Inneren der Stange E bildet, und bis
außerhalb dieser Stange verlängert.
Das durch die Stopfbüchse g gleitende Rohr G muß wenigstens so lang seyn wie der Kolbenschub der
Pumpe, und ohne anzustreifen im Inneren des Rohres F
spielen. Das letztere nimmt nämlich an der geradlinig hin- und hergehenden
Bewegung der Kolbenstange E Theil, während das Rohr G stationär befestigt ist. Letzteres Rohr, durch welches
das Wasser in die Kolbenstange dringt, ist mit dem in den Wasserbehälter H tauchenden Rohr h'
verbunden, und dieses ist an seinem unteren Ende mit einem kleinen Kugelventil i versehen, welches bei jedem Ansaugen sich öffnet.
Der Erfolg dieser Anordnungen ist nun leicht zu überblicken. In Folge der hin-
und hergehenden Bewegung der Stange E, an welcher die Röhre F und ihre Verlängerung G'
Theil nimmt, vergrößert und verkleinert sich der innere freie Raum dieser Röhre bei
jedem Doppelschub des Kolbens D. Das Wasser des
Behälters H wird daher bei dem nach der Pfeilrichtung
erfolgenden Schub hereingesaugt, bei der Rückbewegung aber durch das Ventil g' in das Rohr G'
hinein- und zum offenen Ende desselben hinausgedrückt. Von da an bewegt sich
das Wasser im Inneren der Stange E von vorn nach hinten
und begegnet der Scheidewand h, welche dasselbe nöthigt
seinen Weg durch die Oeffnungen f, f' und durch die
hohlen Räume e, e' zu nehmen, wobei es die beiden
Flächen des Kolbens D abkühlt. Und so setzt das Wasser
seinen Rückweg fort, bis es bei der Tubulatur j den
Apparat verläßt. Da seine Erwärmung nur unbedeutend ist, so kann man es, wie Fig. 9 zeigt,
mittelst einer an diese Tubulatur sich schließenden Röhre J seinen Weg durch den Cylindermantel nehmen lassen.
Die Anordnung dieser inneren Röhren gewährt den Vortheil, daß sie das Volumen des
eingeführten Kühlwassers mit der Zahl der Kolbenschübe, folglich auch mit dem
Volumen des in dieser Zeit comprimirten Gases genau in's Verhältniß zu setzen
gestattet. Die Abkühlung während des Actes der Compression hat aber den Zweck, den
durch die Erwärmung des Gases während seines Aufenthaltes im Pumpenstiefel
veranlaßten Kraftverlust zu vermeiden.
Was die Methode der Packung an den Röhrenfugen anbelangt, so ist diese wesentlich an
die Anwendung der comprimirten Gase als Triebkraft geknüpft. Colladon bedient sich einer Packung, welche zugleich dicht und billig
herzustellen ist. Sie entsteht aus der Verbindung einer Kautschukröhre mit einem in
ihr Inneres hineingezwängten hänfenen oder baumwollenen Strick, dessen Durchmesser
dem inneren Durchmesser der Röhre ungefähr gleich ist. Der Strick mit der
Kautschukröhre wird auf eine Länge gleich dem Umfange der zu dichtenden Fuge
abgeschnitten. Man schiebt alsdann das Seil in der Röhre etwas vorwärts, so daß
einige Centimeter desselben an einem der Röhrenenden hervorragen, biegt das Ganze zu
einem Kreis zusammen und steckt das hervorragende Seilende in den leeren Raum des
anderen Endes der Kautschukröhre. Auf diese Weise stoßen die beiden Seilenden in
einiger Entfernung von der Stelle, wo sich die beiden Enden der Kautschukröhre
vereinigen sollen, zusammen. Nachdem die Enden der Kautschukröhre einander
sorgfältig genähert und dann durch eine Naht vereinigt worden sind, bildet das Ganze
einen ausgezeichneten Packungsring, welcher den doppelten Vortheil darbietet, daß er
seine Elasticität besser behält, als ein Ring aus Kautschuk allein, und zugleich
billiger ist; endlich widersteht ein solcher Packungsring besser der Wärme.
II. Apparat zur Wiedererwärmung der
comprimirten Luft oder sonstigen Gasart.
Colladon's Anordnung zum Wiedererwärmen der Luft oder
sonstigen Gasart, bevor sie als Motor in Anwendung kommt, ist nicht nur durch die
Art wie die Wärme des Brennmaterials verwerthet wird, ökonomisch, sondern sie beugt überdieß den Einflüssen vor, welche für die
Conservirung der Apparate nachtheilig sind, und in Folge der Ausdehnung oder
Zusammenziehung der Metallflächen während der Arbeit auftreten können.
Fig. 12
stellt den Ofen im verticalen Längendurchschnitte, Fig. 13 im
Horizontaldurchschnitte nach der Linie 1–2, und Fig. 14 in einem durch
die Mitte des Rostes geführten Querschnitte dar. Die Construction dieses Ofens ist,
wie man sieht, eine der einfachsten. Zwei horizontale Röhren nehmen den unteren
Theil desselben ein. Die Röhre R, welche das comprimirte
Gas herbeileitet, durchsetzt den Ofen in seiner ganzen Länge und ist außerhalb
desselben durch eine Platte r geschlossen. Die Röhre S, durch welche das Gas nach erfolgter Erwärmung den
Ofen verläßt, ist an dem einen Ende durch die Platte s
geschlossen. Die Tubulirungen m und n beider Röhren im Inneren des Ofens dienen zur Aufnahme
der hufeisenförmig gebogenen Röhren T, welche das
comprimirte Gas von der Röhre R in die Röhre S überfuhren. Der eigentliche Ofen ist in zwei, durch
eine Scheidewand D aus feuerbeständigen Ziegeln von
einander getrennte Kammern C und C' abgetheilt, welche nur durch die oben befindliche Oeffnung P mit einander communiciren. Die Flamme steigt in C in die Höhe, streicht durch die Oeffnung P und steigt in C¹
abwärts, um durch das Rohr C² in den Schornstein
zu gelangen.
Der Rost g muß 1 1/2 bis 2 Meter tiefer gelegt werden als
die Röhren R und S, damit
die Flamme nicht gegen die letzteren und die Verbindungsröhren T schlagen kann. Die Scheidewand D ist außerdem oberhalb der Feuerstelle mit einer durch den Schieber K verschließbaren Oeffnung O
versehen, welche die Flamme direct nach dem Schornsteinrohre C² leitet, wenn das comprimirte Gas nicht circulirt und die Röhren
R, S und T nicht erhitzt
zu werden brauchen. Die wesentlichen Principien, auf welche die Construction dieses
Ofens sich gründet, bestehen:
1) in dem 1 1/2 bis 2 Meter oder nach Umständen noch mehr betragenden Abstande des
Rostes von den Röhren R und S, woraus zwei wichtige Vortheile entspringen, nämlich daß diese Röhren, sowie die Röhren T, keiner heftigen Flamme ausgesetzt sind, ferner daß
trotz der Umkehrung der Flammenrichtung der für die Sicherung einer guten
Verbrennung hinreichende Zug vorhanden, und kein hoher Schornstein nöthig ist;
2) in dem System der Communication und Fortleitung des comprimirten Gases zwischen
den beiden Hauptröhren R und S, welches eine ungehinderte Ausdehnung und Zusammenziehung der Röhren T vermöge ihrer eigenthümlichen Form gestattet.
Ueberdieß verleiht ihnen ihre Länge einen hinreichenden Grad von Elasticität, um der
Ausdehnung oder Zusammenziehung keinen bemerkbaren Widerstand entgegenzusetzen.
Tafeln