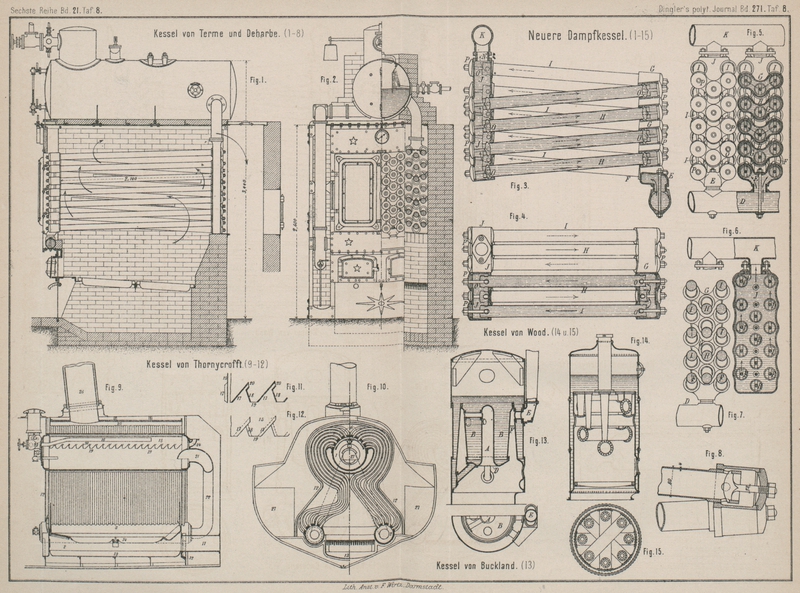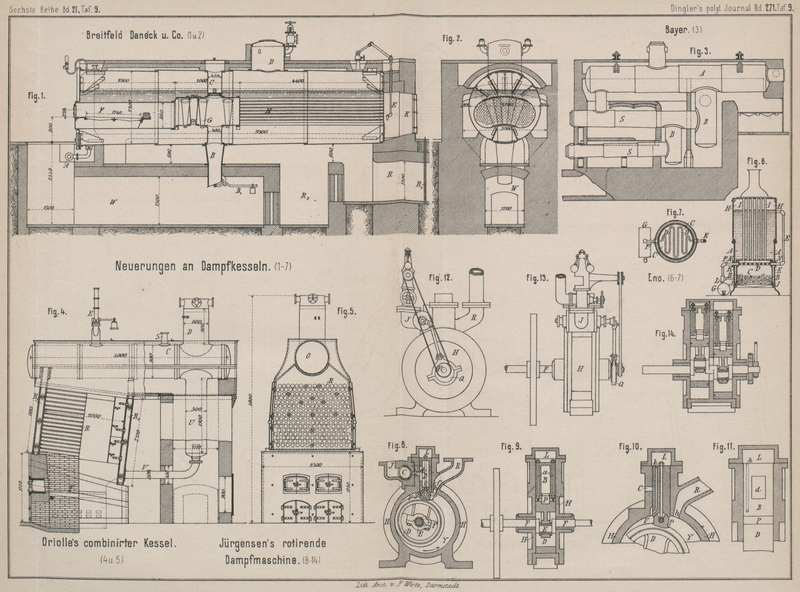| Titel: | Ueber neuere Dampfkesselconstructionen. |
| Fundstelle: | Band 271, Jahrgang 1889, S. 145 |
| Download: | XML |
Ueber neuere
Dampfkesselconstructionen.
Mit Abbildungen auf Tafel
8 und 9.
Ueber neuere Dampfkesselconstructionen.
Im Nachstehenden geben wir einige neue Veröffentlichungen von Kesselconstructionen
wieder, die, wenngleich sie keine erhebliche Neuerungen in den
Constructionsgrundsätzen darbieten, in mancher Hinsicht doch bemerkenswerthe
Ausführungen zeigen.
Kessel von Terme und Deharbe. Eine Beschreibung dieses
sogen. combinirten – aus einem Systeme von Röhren und einem cylindrischen Oberkessel
bestehenden – Kessels findet sich in der Märznummer von Portefeuille économique des machines. Der Kessel ist für eine Landmaschine
bestimmt und soll 1000k Dampf von 10at Spannung in der Stunde liefern. Er besteht im
Wesentlichen aus 80 geschweiſsten Eisenröhren von 80mm äuſserem Durchmesser, 4mm Wandstärke
und 2100mm Länge. Je drei Röhren sind zu einem
Elemente vereinigt und bilden in ihrer gegenseitigen Lage gleichsam die Kanten einer
dreiseitigen Pyramide, deren Grundfläche in dem senkrechten Dampfsammler ruht, in
welchen auch die Röhren münden (Fig. 3 bis 7). Die Spitze der
Pyramide wird von einem U-förmigen Gehäuse (Fig. 8) gebildet, welches
die Rohrenden aufnimmt und verbindet. Die beiden oberen Röhren I dieses der Kesselconstruction eigenthümlichen
Elementes liegen einander parallel und steigen vom gemeinschaftlichen Gehäuse aus
etwas an, während das untere, mittlere Rohr H sich vom
Gehäuse ab senkt. Wird daher das mit Wasser gefüllte Rohr geheizt, so bringt der
sich entwickelnde Dampf einen lebhaften Wasserumgang in der Richtung der in Fig. 3 und 4
eingezeichneten Pfeile hervor, indem die beiden oberen Rohre ihren Dampf in den
Dampfsammler J entsenden und gleichzeitig in das untere
Rohr H Wasser eintritt. Der Dampf kann in dem
senkrechten Kopfraume J rasch aufsteigen und gelangt
durch Sammelrohre in den oberen Dampfsammelraum K, Die
Speisung des Kessels wird in den Dampfraum eingeführt und spritzt vor das
eingehängte Blech.
Die Röhrenelemente bilden beim vorliegenden Kessel vier einander gleiche Reihen, die
neben einander angeordnet sind (Fig. 2, 5, 6 und 7).
Der Dampfsammler ist ein wagerechtes genietetes Rohr, welches bis zur Mittellinie mit
Wasser gefüllt gehalten wird. Etwaiger Schmutz des Speisewassers setzt sich in dem
Schlammsacke ab, von wo er zeitweise abgelassen wird.
Die zur Verbindung der Röhrenelemente dienenden Gehäuse sind von schmiedebarem Gusse
und ist deren Construction aus der Stückzeichnung (Fig. 8) zu ersehen.
Versuche haben ergeben, daſs der Kessel leicht zu bedienen ist, daſs die Spannung
rasch ansteigt und sich gut hält, sowie auch, daſs das Innere rein bleibt und die
Verbindungen dicht sind. Auswechselung einzelner Theile kann in kürzester Frist
bewirkt werden.
Der Thornycroft'sche Kessel (Fig. 9 bis 12 Taf. 8) wird in der
Revue industrielle vom 3. November 1888 näher
beschrieben. Er besteht aus dem Dampfsammler (1) und den beiden neben dem Roste
liegenden Siederohren (2), welche durch Röhrenbündel (12) mit einander in Verbindung
stehen. Die Röhren sind in Gruppen von je acht Stück angeordnet, welche nahezu in
derselben senkrechten Ebene liegen, und, vom oberen Theile des Siederohres
ausgehend, in den Dampfsammler münden. Die Röhren sind so angeordnet, daſs aus einem
Theile derselben zugleich die Wände gebildet werden, welche die Röhrenbündel nach
auſsen und innen abschlieſsen und somit den Heizgasen als Führung dienen (vgl. Fig. 10 rechte
Hälfte). Die erste und letzte Röhrengruppen sind etwas anders angeordnet, um dem
Zuge der Feuergase die Umkehr zu gestatten (Fig. 10 linke Hälfte).
Zum Schütze des unteren Theiles des Dampfsammlers gegen die Einwirkung der Heizgase
ist eine Hülle, etwa von Asbestgeflecht, unter demselben angebracht, welche an die
Röhrenwand anschlieſst und die Decke des Feuerzuges bildet. Das Dampfabführrohr (16)
erstreckt sich der Länge nach über einen groſsen Theil des Dampfsammlers, in welchem
eine aus Fig.
11 und 12 näher ersichtliche Vorrichtung in Form eines Schirmes angebracht ist,
um das Mitreiſsen des Wassers möglichst zu verhindern. Die Enden dieses Schirmes
sind zahnförmig ausgeschnitten und die Ausschnitte sind zum Theile senkrecht
umgebogen. Hierdurch wird bezweckt, daſs sich das ausgeschiedene Wasser bei (19)
sammelt und in den Wasserraum zurückgeführt wird, während der Dampf bei (20)
hindurchstreicht, In den Figuren bezeichnet auſserdem: (11) ein Rohr zum Abführen
des Dampfes bei etwaiger Beschädigung eines Rohres, (12) Blechwand zum Abschlusse,
(13) Aschenfall von Blech, (14) Rost, (21 und 22) Verbindungsrohre zwischen den
Siederöhren und dem Dampfsammler zur Zurückführung des Wassers behufs Erzielung
eines lebhaften Wasserumlaufes, (23 und 24) Stutzen zum Anbringen von
Sicherheitsvorrichtungen, (25 und 26) Rauchkammer und Schornstein, (27)
Schiffsrumpf.
Der Buckland'sche Kessel (Fig. 13 Taf. 8), welcher
nach Industries vom 19. Oktober 1888 von der Tyne Boiler Works Comp., Low Water, hergestellt wird,
zeigt eine bekannte Kesselform dahin erweitert, daſs in der Mitte des eingehängten
inneren Kessels B noch ein Rohr A angebracht ist. Der Kessel ist in der vorliegenden Ausführung, 11 Fuſs
hoch, 5 Fuſs, weit, für Land- und Schiffsmaschinen bestimmt. Die Heizgase streichen
von A aus um den Innenkessel B und entweichen durch E. Die vor dem
Abzugskanale E in den ringförmigen Feuerzug eingesetzte
Platte bei l soll den Gasen das zu rasche Entweichen
unmöglich machen. Ein Kessel von oben angegebener Gröſse mit 142,33 Quadratfuſs
Heizfläche verdampfte 695 Pfund Wasser in der Stunde, mithin 4,87 Pfund auf den
Quadratfuſs (= 23k auf 1qm;) und zeigte eine 7,8fache Verdampfung.
Sehr einfache Formen hat der stehende Kessel (Engineer
vom 2. November 1888) Fig. 14 und 15 Taf. 8 von
D. Wood and Sons, Cradley Heath. Erfahrungsgemäſs
geben die Querrohre eines stehenden Kessels eine sehr wirksame Kesselfläche. In
vorliegendem Falle sind vier solcher Querrohre zur Verwendung gekommen, welche je
durch zwei, nach oben sich etwas conisch erweiternde senkrechte Rohre mit der
Kopfplatte verbunden und so zu einem sich gegenseitig haltenden Systeme vereinigt
sind, in welchem dem Dampfe der Durchgang zum Dampfraume sehr erleichtert ist. Nicht
unwesentlich ist der hier erzielte lebhafte Wasserumlauf.
Ueber einen Dampfkessel der Maschinenbau-Actiengesellschaft vormals Breitfeld,
Danek und Comp. in Prag macht Uhland's Wochenschrift, S. 35, nachstehende Mittheilungen (Fig. 1 und 2 Taf. 9):
Unter den Kesseln der Wiener Jubiläums-Gewerbeausstellung erscheint uns der von der
Maschinenbau-Actiengesellschaft vormals Breitfeld, Danek und Comp. in Prag ausgeführte
Flammrohrkessel besonders bemerkenswerth.
Dieser Kessel hat 190qm Heizfläche und arbeitet mit
7at Betriebsspannung. Er erscheint als die
Combination eines gewöhnlichen Flammrohrkessels mit Siederöhren und einer
Feuerbüchse „Patent Piedboeuf“. Als
Herstellungsmaterial benutzte man Fluſsstahlbleche, da diese die Wärme schnell
aufnehmen. Obgleich man nun durch Anwendung von Fluſsstahlblechen schon eine sehr
schnelle Dampfentwickelung erreichte, wandte man doch noch Siederohre an, um sowohl
die Heizfläche ohne groſse Kosten zu vergröſsern, als auch die Heizgase äuſserst
auszunutzen.
Hierbei war man genöthigt, für einen Apparat Sorge zu tragen, welcher ein
jederzeitiges Reinigen der Röhren zulieſs, und ordnete aus diesem Grunde in dem am
hinteren Theile des Kessels vorgesehenen Rauchkanale K
einen durch den Kessel selbst gespeisten Ausblaseapparat E an. Derselbe hängt an einer über zwei Rollen geführten, mit einer
Handhabe versehenen Kette und ist somit senkrecht verstellbar. Das Verbindungsrohr,
welches von ihm zu dem auf dem Kessel angeordneten Dampfventile geführt ist,
zerfällt in drei durch Kugelgelenke verbundene einzelne Theile. Damit man den
erwähnten Ausblaseapparat während seiner Thätigkeit jederzeit beaufsichtigen kann,
ist die hintere Wand des Kesselmauerwerkes durch eine mit Doppelwandungen versehene
eiserne Thür verschlossen.
Die Feuerbüchse besteht aus dem vorderen, den Rost enthaltenden Theile F, sowie dem hinteren, mit Galloway-Röhren versehenen Theile G. Die
Feuerbüchse hat eine bohnenförmige Gestalt (Fig. 2) erhalten, welche
gestattet, alle Verankerungen der Büchse mit dem Kessel wegzulassen. Diese
Feuerbüchse ist, da sie nur glatte Flächen hat, bequem von Kesselstein zu reinigen.
Will man das Siederohrsystem, sowie die Kammer F
auch während des
Betriebes von Flugasche reinigen, so genügt ein Inbetriebsetzen des oben erwähnten
Ausblaseapparates E. Derselbe treibt alle Flugasche in
den mit Galloway-Rohren versehenen Theil der
Feuerbüchse, aus welchem sie sodann in einen mit dem selbsthätigen Verschlusse B1 versehenen Stutzen
B gelangt. Von Zeit zu Zeit führt dieser nach dem
Patente Lustig hergestellte Verschluſs eine Entleerung
des Stutzens in den Aschenkanal W herbei.
Soll der mit Galloway-Röhren versehene Theil der
Feuerbüchse G gereinigt oder nachgesehen werden, so
steigt der betreffende Arbeiter durch den Stutzen C in
die Büchse hinein. Um Wärmeverluste zu vermeiden, ist in diesem an seinem oberen
Ende durch eine Platte verschlossenen Kanale noch ein mit Chamottefüllung versehener
Deckel angeordnet.
Am vorderen, untere Theile des Kessels ist ein Wasserrohr A angeordnet, welches zugleich Speise- und Ablaſsrohr ist. Aus diesem
Grunde sind drei Ventile von entsprechend 50, 65 und 65mm lichter Weite in dasselbe eingeschaltet. Die Speisung des Kessels
geschieht mittels eines Körting'schen Injectors, dessen
Dampfrohr sowie Druckrohr je 65mm lichte Weite
erhalten haben. Das Saugrohr stellt die Verbindung des Injectors mit dem
Wasserbehälter her. Der Dampfdom D hat zwei Stutzen,
deren jeder ein Sicherheitsventil von 130mm
lichter Durchgangsöffnung trägt, während ein dritter Stutzen ein Dampfventil von
140mm Durchgang erhalten hat.
Hinter dem oben erwähnten Aschenfalle W befindet sich
ein Aschensammler R2,
während der Fuchs R durch einen Rauchschieber R1 verschlieſsbar
gemacht ist.
Bei dem Kessel von J. Bayer in München (D. R. P. Nr.
44663 vom 13. Januar 1888) sind die senkrechten Stutzen B (Fig.
3 Taf. 9), welche die Sieder S unter einander
und mit dem Oberkessel A verbinden, in senkrechten
Kammern untergebracht, welche von den Heizgasen zunächst durchströmt werden. In den
an diese Heizkammern angrenzenden Zügen sind die Siederohre gelagert. Der Kessel
zeigt in dieser Anordnung eine verhältniſsmäſsig groſse vom Feuer berührte Fläche,
ist in allen seinen Theilen leicht zugänglich und hat nur inneren Druck.
Der Oriolle'sche Kessel Fig. 4 und 5 Taf. 9 bietet nichts
besonders Neues, zeigt jedoch eine gute Anordnung. Nach Portefeuille économique des machines, Nr. 393 September 1888, besteht er
im Wesentlichen aus zwei flachwandigen, durch Schraubenstehbolzen versteiften
Kopfstücken R1 und R2, welche durch Röhren
R, mit einer Neigung von 10 bis 20cm auf das laufende Meter, verbunden sind, und dem
Oberkessel O, welcher als Dampfsammler dient. Der
Wasserstand soll so niedrig gehalten werden, daſs die oberen Röhren noch als
Ueberhitzer dienen können, welche Rolle auch dem Oberkessel zugetheilt ist.
Das Sicherheitsröhrensystem wird aus einer groſsen Anzahl 2000mm
langer Röhren gebildet.
Die Kammern R1 und R2 gestatten eine freie
Umströmung des dem Kessel an der tiefsten Stelle der Wand R2 zugeführten Wassers. Der erzeugte Dampf
strömt durch die Wand R1 dem Oberkessel O zu und sammelt sich in
dessen oberem Theile, sowie in dem Dampfdome D.
Der hintere, untere Theil des Oberkessels O ist zu einem
500mm weiten., 1900mm langen Vorwärmer U
ausgebildet, der durch ein 200mm weites Rohr V mit der Wand R2 verbunden ist.
Die vier Wände der Feuerung sind, um eine sichere Lagerung zu erzielen, sehr stark
ausgeführt und haben vollständige, durch eine Anzahl quer aufgenieteter
Flacheisenstangen verstärkte Blechbekleidung. Der Feuerungsrost besteht lediglich
aus über Rundeisenstäbe gelegten Roststäben. Die auf dem Roste sich entwickelnden
Feuerungsgase gelangen nach dem Durchstreichen des Sicherheitskessels R zu dem wagerechten Oberkessel O, umspülen den letzteren, sowie den mit ihm verbundenen Vorwärmer U und werden dann erst dem Fuchse zugeführt. Das
Röhrensystem R, sowie der Oberkessel O ruhen auf einem hohlen Steinpfeiler, welcher zugleich
als Rauchkanal benutzt ist. Im Uebrigen wird die Ummantelung des Oberkessels von
Blechplatten gebildet.
Die Anlage ist für zwei Feuer eingerichtet und zur Heizung mit Briquettes
berechnet.
Die Sicherheitsvorrichtung, die Leitung des Zuges, sowie die Vorrichtung zur
Reinigung zeigen nichts Neues.
Die Anordnung der flachen Wände macht die Vortheile des Röhrenkessels bezüglich der
Explosionssicherheit wieder hinfällig und ist gerade nicht empfehlenswerth. Es ist
daher die Mittheilung unserer Quelle über die Haltbarkeit und gute Verwendbarkeit
des Kessels mit Verständniſs aufzunehmen. Die erreichte Heizfläche ist allerdings
bedeutend.
Als Anhalt für die Kesselverhältnisse mögen nachstehende Angaben dienen, welche sich
auf Versuche mit einem Torpedokessel unter Verwendung künstlichen Zuges
beziehen.
Gesammte Heizoberfläche 52qm,88, Rostfläche 1qm,59, Verhältniſs der beiden zu einander 33,34.
Wasserinhalt 0cbm,596, gesammter Kesselraum 1cbm,073. Bei einer Versuchsdauer von 2 Stunden
ergab sich: Briquettes von englischer Staubkohle 757k,7, erzeugter Dampf 5627k, entsprechend
7k,42 auf 1k
Kohle, also für 1m = 53k. Auf 1qm
Rostfläche wurden 238k Kohle verbrannt.
Speisewasser 30°.
J. A. Eno in Newark, New Jersey (Amerikanisches Patent
Nr. 11983 vom 18. August 1888) legt durch die Feuerbüchse eines stehenden
Röhrenkessels, und zwar nahe unter die Kopfplatte ein mehrfach hin und her gehendes
Rohr D (Fig. 6 und 7 Taf. 9), welches an der
einen Seite mit dem am Boden befindlichen Speisewasserbehälter G verbunden ist, an der anderen Seite durch die beiden
Wände K und B des inneren
und äuſseren Kessels an dem Kessel durch das Rohr F und
E heraufgeführt wird, um bei der mittleren
Wasserstandshöhe wieder in den Kessel zu münden. Diese Vorrichtung soll zum
Vorwärmen und zum Ausschneiden des Kesselsteines in Pulverform dienen.
J. W. Eldroyd will nach einem österreichischen Patente
bei neben einander liegenden Kesseln die vom Mauerwerke herbeigeführten
Wärmeverluste dadurch beseitigen, daſs er die Mauern durch Wasserbehälter ersetzt;
dieselben sind flach oder gar kofferförmig gehalten und vertrauensvoll unter den
Kesseldampfdruck gebracht. Verstöſse gegen das Patent werden schwerlich gemacht
werden.
Der Kingsley'sche Kessel (American machinist vom 10. November 1888) ist, trotz der Reklame unserer
Quelle, weiter nichts als ein Flammrohrkessel mit eingehängten Field'schen Röhren.