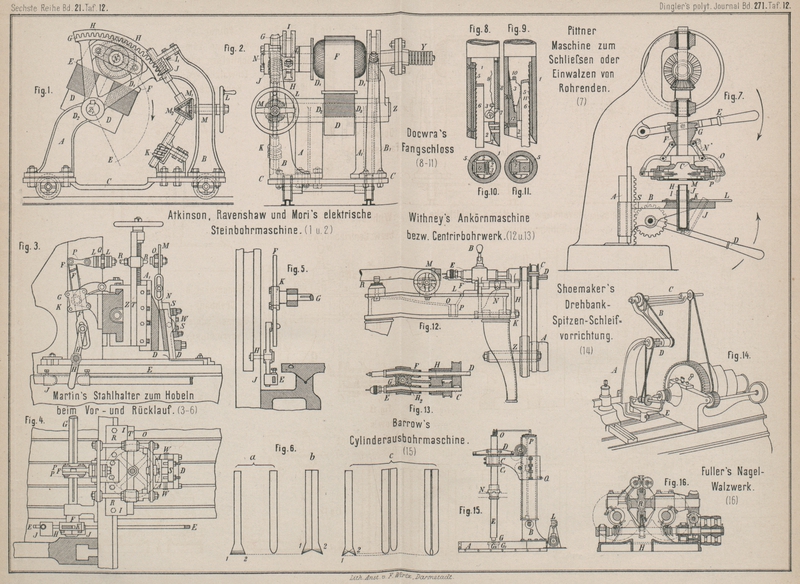| Titel: | T. H. Martin's Stahlhaltervorrichtung zum Hobeln während des Vor- und Rücklaufes. |
| Autor: | Pr. |
| Fundstelle: | Band 271, Jahrgang 1889, S. 248 |
| Download: | XML |
T. H. Martin's Stahlhaltervorrichtung zum Hobeln
während des Vor- und Rücklaufes.
Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 12.
Martin's Stahlhaltervorrichtung zum Hobeln.
Um den Rücklauf des Hobelmaschinentisches zum Schnitte mitzubenutzen, also den
Leergang desselben zur Arbeit zu verwenden und dadurch die Leistung der
Hobelmaschine, wenn nicht zu verdoppeln, so doch wenigstens beträchtlich zu
steigern, sind wiederholt Versuche mit verschiedenem Erfolge gemacht worden (vgl.
Whitworth und J. H.
Wicksteed, 1887 264 * 108).
Textabbildung Bd. 271, S. 247
Neuerdings ist beim Baue der Forth-Brücke (vgl. 1888 270 *
201) eine Hobelmaschine mit zwei gegensätzlich und nahe an einander gestellten
Balkenständern und Werkzeugsupporten in Thätigkeit, welche als eine neue Anwendung
eines seit 15 Jahren von Sondermann und Stier in
Chemnitz ausgeführten Hobelwerkes angesehen werden kann.
Wenn auch durch gleichzeitige Bearbeitung zweier gleichartigen Werkstücke die
Leistung der Hobelmaschine erhöht wird, so kann doch wegen den in der Maschine
auftretenden Spannungszuständen nur immer gleichartige Arbeit verrichtet werden. Es
kann daher bei einer breiten Hobelfläche nicht gleichzeitig vorgehobelt und
geschlichtet werden, wobei der zweite stillstehende Stahlhalter Verwendung finden
könnte. Es ist daher von
nicht geringem Vortheile, wenn der Vorlauf des Tisches zum Schroppen, der Rücklauf
desselben aber zum Schlichten verwendet wird.
Durch die im Engineer, 1888 Bd. 65 * S.
389, veröffentlichte Stahlhaltervorrichtung von T. H.
Martin in Swansea, Süd-Wales, England, wird dies in
der Weise angestrebt, daſs durch eine Schräglage des doppelschneidigen Stahles (Fig. 6
a, b oder c) in der
Bewegungsebene während des Vorganges des Hobeltisches die Schneide 1, im Rücklaufe die Schneide 2 in Eingriff mit dem Werkstücke tritt. Diese Schräglage des
Schneidstahles wird durch die in den Fig. 3, 4 und 5 Taf. 12 dargestellten
Einrichtungen herbeigeführt, welche im Wesentlichen aus einer stellbaren
Hebelverbindung bestehen, an welcher das schwingende Stichelgehäuse angelenkt
ist.
Zwei am seitlichen TischrandeIm Bilde sind diese Knaggen an einer Schiene E
angebracht, welche am Tische angeschraubt ist., der Hubgröſse
entsprechend eingestellte Anschlagklötzchen J bringen
den am Seitengestelle um einen festen Zapfen drehbar angeordneten Hebel H an jedem Hubende des Tisches zur Ausschwingung. Mit
diesem ist der durch eine Tasche K der Welle G geschobene Stangenhebel F verbunden. Mittels einer eigenthümlichen Stabverbindung P, L, R, O und M wird das
Stichelgehäuse A mit dem Schneidstahle C von der schwingenden Keilnuthwelle G in die vorgeschriebene Schräglage eingestellt.
Weil aber der Querbalken der Hobelmaschine Höhen-, der Supportschlitten Z Seitenverstellung, das Lyrastück T Schräglage, das Supporttheil A1 Verschiebung und sein Vordertheil D Schrägeinstellung erhält, so darf die ebenbezeichnete
Stab- und Hebel Verbindung diese Bewegungen der Supporttheile in keiner Weise
behindern.
Aus diesem Grunde endigt die am Querbalkenrücken gelagerte Welle G in der Tasche K, durch
welche sich der Stabhebel F schiebt, während der Hebel
F1 vermöge zweier
am Schlitten Z angeschraubter Grifflager auf der
Keilnuthwelle G mitgenommen wird. Das Lyrastück T trägt einen Rahmen, welcher aus zwei Schlitzbögen Q und O und zwei
Verbindungsstäbchen R besteht, die sich in den
Führungsaugen verschieben. Im hintenliegenden Schlitzbogen wird zwischen
Gummipuffern das Hebelauge L eingespannt, welches
mittels P die Verbindung des Rahmens mit dem Hebel F1 herstellt. Am
vorliegenden Schlitzbogen wird das Gabelstück M
angeschraubt, in welchem hebelartig das Stichelgehäuse NA angebolzt ist.
Hieraus ist ersichtlich, daſs bei einer Schrägstellung des Lyrastückes der Rahmen
schräg liegen, daſs aber bei einer gegensätzlichen Verdrehung des
Supportvordertheiles gegen das Lyrastück dennoch diese Verbindung leicht möglich
wird.
Die in Fig. 6
dargestellten Hobelstähle werden mittels Bügel S an das Stichelgehäuse
befestigt. Der Schneidstahl a, sowie der aus zwei
einfachen Stählen bestehende Doppelstahl b dienen nur
zum Schroppen oder Schlichten, während die Stahlverbindung c mit nebenliegenden einfachen Stählen die Bestimmung hat, im Vorlaufe des
Werkstückes zu schroppen, im Rücklaufe aber mit dem etwas tiefer eingestellten
Stahle die eben bearbeitete Fläche zu schlichten. Die Schaltung oder Steuerung des
Supportes erfolgt mit den bekannten Mitteln.
Pr.
Tafeln