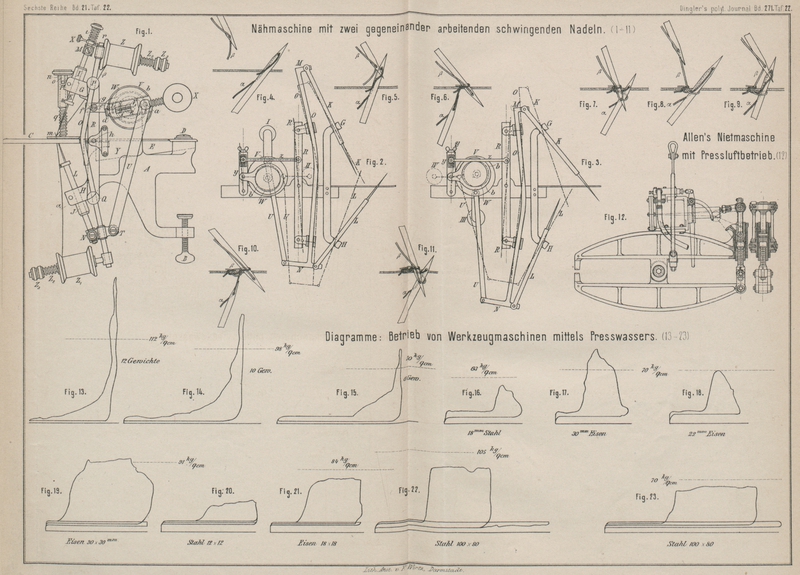| Titel: | Nähmaschine mit zwei gegen einander arbeitenden schwingenden Nadeln; von Cecil Noble und Hubert Haes (of Newman Mews) und Georg Lenton Roff in London. |
| Autor: | H. G. |
| Fundstelle: | Band 271, Jahrgang 1889, S. 433 |
| Download: | XML |
Nähmaschine mit zwei gegen einander arbeitenden
schwingenden Nadeln; von Cecil Noble und Hubert Haes (of Newman Mews) und Georg Lenton
Roff in London.
Mit Abbildungen auf Tafel
22.
Nähmaschine mit gegen einander arbeitenden schwingenden
Nadeln.
Die durch D. R. P. Kl. 52 Nr. 43095 vom 14. Mai 1887 geschützte Maschine ist mit zwei
zu beiden Seiten der Arbeitsplatte angeordneten schrägstehenden Oehrnadeln
ausgestattet, durch welche sowohl die Stichbildung als auch die Transportirung des
Stoffes erfolgt. Die Nadeln führen zu diesem Zwecke eine Bewegung in Richtung ihrer
Achsen und auſserdem eine Schwingbewegung in der durch sie bestimmten Ebene aus.
Die um Bolzen D behufs Einfädelns der Nadeln zur Seite
drehbare Stichplatte C wird mit Hilfe der
Schraubzwingen AB an einem Tische befestigt. Der nach
unten zeigende gegabelte Arm H dieser Zwinge nimmt die
drehbar gelagerte Führungshülse J der unteren
Nadelstange L auf, während der nach oben durch einen
seitlichen Ausschnitt der Nähplatte C tretende
gleichfalls gegabelte Arm G die in dieser Gabelung
drehbar gelagerte Führungshülse I der oberen
Nadelstange K trägt (Fig. 1 Taf. 22). Die beim
Spiel der Nadeln erforderliche genaue Lage der Stichplatte C kann beispielsweise durch eine Blattfeder dadurch gesichert werden, daſs
diese Feder in eine Aussparung der Stichplatte eingreift, sobald letztere in ihre
Schluſsstellung gedreht ist. Die in den drehbaren Hülsen J und I gleitenden Nadelstangen L und K sind durch
Querstücke NM gelenkig mit einem Gleitstücke, das im
vorliegenden Falle als Stange O ausgebildet ist,
verbunden. Die Stange O wird ihrerseits in drehbaren
Köpfen PQ des Hebels R
geführt, welcher um den am Maschinengestelle befestigten Zapfen h schwingt, und erhält von der Kurbelscheibe V, die für eventuellen Riemenbetrieb mit einer Rille
zur Aufnahme einer Treibschnur versehen ist, unter Vermittlung einer in T mit dem unteren Querstücke N gelenkig verbundenen Schubstange U eine auf
und nieder gehende Bewegung. Neben dieser auf und abwärts gehenden Bewegung der
Stange wird dem Hebel R eine um den Drehpunkt h schwingende Bewegung durch ein Excenter W ertheilt. Dieses Excenter W ist auf der Achse V1 der mit Kurbel X
Ersehenen Kurbelscheibe V befestigt, welche in dem
Ansätze Y des Maschinengestelles gelagert ist. Der
Excenterbügel b trägt einen Ansatz, dessen Drehzapfen
d durch das Gelenkstück e mit dem Zapfen g des Hebels R verbunden ist. Durch Drehung der Kurbelscheibe V wird also auch das Excenter W in Drehung versetzt und diese Bewegung durch den Excenterring b und das Gelenkstück e
auf den Hebel R überfragen (Fig. 1, Taf. 22).
Die schwingende Bewegung des Hebels R ertheilt der
Stange O
und damit den Nadeln
eine gewisse Bewegung in der Richtung der Naht derart, daſs hierdurch die
Verschiebung des Stoffes und damit die Stichlänge bestimmt wird. Um diese Bewegung
regeln zu können, ist das Gelenkstück e mit einem
Schlitze f versehen, so daſs mit Hilfe der Schraube g eine Einstellung erfolgen kann. Wird nun die
Kurbelscheibe V gedreht, so wird die Stange O in den Köpfen PQ auf und
ab geschoben und hierbei den Nadeln eine derart auf und ab gehende und gleichzeitig
schwingende Bewegung ertheilt, daſs diese sich in dem Stoffe kreuzen und dabei die
Stiche bilden und den Stoff verschieben.
Das Spiel der beiden Nadeln LK und die Bewegung der
arbeitenden Theile sind aus den Fig. 2 und 3 Taf. 22 in vier auf
einander folgenden Arbeitsperioden dargestellt.
Fig. 2 zeigt
zwei auf einander folgende Arbeitsperioden I und II und zwar stellen die ausgezogenen Linien die
Stellung der arbeitenden Theile in der ersten Periode bei senkrecht hoch gerichteter
Kurbel dar, während die strichpunktirten Linien die Stellung der arbeitenden Theile
ihren Mittellinien nach in der zweiten Arbeitsperiode bei der um 90° nach rechts
verdrehten Kurbel angeben. In Fig. 3 Taf. 22 zeigen die
ausgezogenen Linien die Lage der arbeitenden Theile in der dritten Position bei
senkrecht nach unten gerichteter Kurbel, und die strichpunktirten Linien die Lage
dieser Theile bei einer um 90° weiter nach rechts gedrehten Kurbel, also Stellung
vier. Bei dieser schematischen Darstellung ist gleichzeitig eine Abänderung in der
Uebertragung der Excenterbewegung auf den Hebel R
angegeben. Diese Excenterbewegung wird nicht direkt, sondern unter Vermittelung des
am Gestelle drehbar angeordneten Hebels y übertragen,
welcher durch eine Gelenkstange z mit dem Hebel R verbunden ist. Der Angriff der Stange z am Hebel y erfolgt in
einem Gleitstücke, welches durch eine Schraube höher oder tiefer gestellt werden
kann, so daſs dementsprechend auch die Schwingungen des Hebels R gröſser oder kleiner werden. Diese Uebertragung der
Excenterbewegung auf den Hebel R hat der in Fig. 1 Taf. 22
dargestellten gegenüber den Vortheil, daſs der Ausschlag des Hebels R und damit auch die Stichlänge während der Arbeit
leicht verändert werden kann.
Die Stichbildung und der Arbeitsgang vollziehen sich nun in folgender Weise.
Die Kurbel der Scheibe V ist senkrecht nach oben
gerichtet (Stellung I, Fig. 2 Taf. 22), demnach
nimmt die Schubstange U ihre höchste Stellung und somit
auch die Gleitstange O ihre höchste Lage ein. Das
Excenter W ist ungefähr um 180° zur Kurbel versetzt, so
daſs der Hebel R seine mittlere Lage einnimmt. Die
untere Nadel ist durch den Stoff gedrungen, hat ihre höchste und auch die am
weitesten nach rechts gerichtete Stellung angenommen, der Faden α ist von der Rolle z1 (Fig. 1 Taf. 22) abgezogen
und gespannt. Die obere Nadel hat ihre höchste und gleichzeitig die am weitesten nach links
gerichtete Stellung eingenommen. Der von der Rolle z
(Fig. 1)
kommende Faden ist nicht gespannt.
Wird nun die Kurbel um 90° nach rechts gedreht (Position II, Fig.
2 Taf. 22 strichpunktirte Stellung), so wird die Gleitstange O durch die Schubstange U
nach unten geschoben, der Excenterring b hat seine
äuſserste nach links gerichtete Lage eingenommen, der Hebel y und das obere Ende des Hebels R sind
demnach nach links gedreht, so daſs die Gleitstange O
eine Doppelbewegung, und zwar eine abwärts gerichtete und eine nach links gedrehte
ausgeführt hat. In Folge des Niederganges der Gleitstange O würde nun Nadelstange L auch nach unten
gezogen sein, wenn nicht gleichzeitig der Vorschub des unteren Gleitstangenendes
gemäſs der Drehbewegung des Hebels R diese Bewegung
nahezu aufgehoben hätte. Die Nadel L führt somit, durch
ihre Führung in dem Lager H gezwungen, bei einer
geringen Abwärtsbewegung eine nach links gerichtete Schwingung aus. In Folge des
geringen Niederganges der Nadel bei der geschilderten Doppelbewegung bleibt die
Nadel L in dem Stoffe (Fig. 5 Taf. 22), der
Unterfaden a aber folgt, da er durch Reibung im Stoffe
festgehalten wird, der geringen Nadelsenkung nicht, sondern bildet oberhalb des
Stoffes eine Schleife, in welche die obere Nadel K
eindringt. Diese Nadel ist durch die Abwärtsbewegung der Gleitstange O gesenkt und gleichzeitig um ein Geringes nach rechts
gedreht worden, so daſs sie mit Sicherheit in die Schlinge des Unterfadens eintreten
kann. Diese Stellung beider Nadeln und die Lage der Fäden ist aus Fig. 5 klar
ersichtlich.
Wie aus Fig. 2
Taf. 22 hervorgeht, hat die Nadel L bei der Bewegung
aus Stellung I nach Stellung II den Stoff auch vorgeschoben.
Bei weiterer Drehung der Kurbel um 90°, also bei senkrecht nach abwärts gerichteter
Stellung (Fig.
3 Taf. 22, ausgezogene Linien) gelangen die Hebel y und R wieder in die senkrechte Lage, so
daſs eine Rückwärtsdrehung der Gleitstange O in die
normale Stellung stattgefunden hat. Die Schubstange U
hat jedoch ihre tiefste Stellung eingenommen, so daſs auch die tiefste untere
Nadelstellung erreicht und die Nadel L aus dem Stoffe
herausgezogen ist. Die obere Nadel K ist gleichfalls
gesenkt und durch den Stoff hindurchgegangen, so daſs Nunmehr die Schlinge über dem
Oehre der oberen Nadel um letztere herumgeschlungen auf dem Stoffe liegt. Die
Schlinge des Unterfadens ist bei der Abwärtsbewegung der unteren Nadel angezogen
(Fig. 6
Taf. 22, Stellung III).
Wird nun die Kurbel weiter nach rechts gedreht, so bewegen die Hebel y und R sich wieder nach
rechts, während die Gleitstange O in Folge der
Aufwärtsbewegung der Schubstange V hochgeschoben ist
(Fig. 3
Taf. 22, strichpunktirt). Die Gleitstange O hat also
auch hier wieder, wie in Stellung II, eine
Doppelbewegung ausgeführt, welche jedoch in Folge der Führung der oberen Nadel K in dem Lager M für diese
Nadel nur in eine schwache steigende und gleichzeitig nach links schwingende
umgewandelt ist. Der Oberfaden β, wieder durch den
Stoff zurückgehalten, bildet eine Schleife, durch welche die gleichzeitig
hochgehobene untere Nadel gedrungen ist. Der Hub der unteren Nadel L ist ein so groſser, daſs letztere den Stoff
durchdringt und da durch die nach links gerichtete Schwingung der im Stoffe
verbliebenen oberen Nadel K dieser auch nach links
verschoben ist, so dringt die untere Nadel in einer gewissen Entfernung von der
oberen Nadel durch den Stoff. Die Lage der beiden Fäden zu den Nadeln ist in
Stellung IV dargestellt.
Wird nun die Kurbel wieder in ihre Anfangsstellung (Fig. 2 Taf. 22,
ausgezogene Stellung, Stellung I) zurückgedreht, so
nehmen die arbeitenden Theile die bei Stellung I
erläuterten Lagen ein.
Die untere Nadel L ist weit durch den Stoff
hindurchgetreten und die Fadenschlinge des Oberfadens β
liegt auf der unteren Nadel, die obere Nadel K hat
wieder ihre höchste Stellung eingenommen, die Schlinge des Unterfadens ist von der
oberen Nadel abgeglitten, liegt oberhalb des Stoffes um den Oberfaden α (Fig. 8 Taf. 22) und ein
Stich ist fertig gebildet, Stellung la. Bei
Weiterdrehung der Kurbel in Stellung II führt die
untere Nadel K wieder eine geringe Abwärtsbewegung zur
Bildung der Unterfadenschlinge (Fig. 9 Taf. 22) aus,
während gleichzeitig durch ihre Schwingung nach links der Stoff weiter geschoben
wird, so daſs die obere Nadel K, welche sich abwärts
bewegt hatte und in die Unterfadenschlinge eingetreten war, Stellung IIa, bei fortgesetzter Kurbeldrehung um eine Stichlänge
entfernt durch die Unterfadenschlinge und den Stoff hindurchdringt. Die untere Nadel
L ist während dieses Vorganges aus dem Stoffe
herausgetreten, die Schlinge des Oberfadens β ist von
der Unternadel abgeglitten und liegt um den Unterfaden, so daſs hierdurch der zweite
Stich gebildet ist (Fig. 10 Taf. 22, Stellung IIIa), der aber
nicht wie der erste Stich auf dem Stoffe, sondern unterhalb des Stoffes liegt.
Fig. 3 Taf. 22
zeigt die Kurbel in der Stellung 71, bei welcher die Bildung des dritten Stiches,
VIa, beginnt (Fig. 11 Taf. 22).
Wie aus der Schilderung der Stichbildung hervorgeht, wird der Stoff durch das
Schwingen der beiden Nadeln während einer vollen Kurbeldrehung, bei welcher zwei
Stiche gebildet werden, zweimal weiter geschoben. Die Gröſse der Schwingungen der
Nadeln bedingt demnach die Stichgröſse und da die Schwingungen der Nadeln wieder von
der Gröſse der Excentricität, welche den Hebel R
beeinfluſst, abhängig ist, so genügt eine Veränderung dieser Excentricität (Fig. 1 Taf. 22)
oder bei constanter Excentricität die Veränderung der Hebelübersetzung (Fig. 2 Taf.
22), um die Stichlänge zu verändern.
Die Führung der Nadelstangen KL geschieht, wie vorhin
beschrieben, in
beweglichen Hülsen JI. An Stelle dieser Construction
könnten die Arme G und H
aber auch, wie in Fig. 2 und 3 angenommen, conische
Schlitze erhalten, welche mit den Spitzen einander zugekehrt sind und demnach den
Nadelstangen seitliche Schwingungen auszuführen gestatten. Ebenso wie die
Excentricität des Excenters W kann auch der
Angriffspunkt der Schubstange U veränderlich gemacht
werden, obschon dies nicht unbedingt nöthig ist. Nach Fig. 1 Taf. 22 ist der
Angriffspunkt a der Schubstange U an einem in der Kurbelscheibe V
verschiebbaren Schlitten i angeordnet, so daſs durch
Verstellung des Kurbelarmes der Hub der Gleitstange O
und damit die Schwingung und Bewegung der Nadeln verändert wird. Dieser Schlitten
gleitet in einer schwalbenschwanzförmigen Ausfräsung der Kurbelscheibe V und trägt einen Schlitz k, in welchen ein Ansatz j der Scheibe
eingreift. Die durch den Schlitz h hindurchgehende und
im Schlitten i drehbar befestigte Schraube l hat ihr Muttergewinde in dem Ansätze j der Kurbelscheibe V, so
daſs durch Drehung dieser Schraube die Entfernung des Angriffspunktes a der Schubstange U an der
Kurbelscheibe V verändert wird.
Der Stoff wird durch den Stoffdrücker m (Fig. 1 Taf. 22)
angedrückt. Dieser Stoffdrücker ist an der Drückerstange q befestigt, welche durch die am Maschinengestelle befestigte Hülse n hindurchgeht. Der in die Stoffdrückerstange q eingelassene Stift p
ruht in einem Schlitze o der Hülse n, während eine zwischen Stoffdrückerstange und Hülse
eingelegte Spiralfeder den Stoffdrücker nach unten drückt. Soll der Stoffdrücker
auſser Wirksamkeit gesetzt werden, so wird derselbe an seiner Kopfscheibe in die
Höhe gezogen und so weit gedreht, daſs der aus dem Schlitze o herausstehende Stift p auf die
Stoffdrückerhülse n zu liegen kommt.
Um die obere Nadel nach Belieben aus dem Stoffe zurückziehen zu können, ist die
Nadelstange K mit folgendem Mechanismus verbunden. Die
obere Nadelstange K befindet sich in einer mit der
Gleitstange O verbundenen Hülse r und ist mit einer Einfräsung versehen, in welche eine durch Feder
beeinfluſste Klinke eingreift. Wird die Nadelstange K,
welche durch die Feder t nach auſsen gezogen wird,
niedergedrückt, so springt die bekannte Klinke in die Ausfräsung der Nadelstange ein
und letztere folgt demgemäſs der Bewegung der Gleitstange O. Soll hingegen Stange K der Bewegung der
Gleitstange nicht folgen und aus dem Stoffe enfernt werden, so wird die Klinke durch
einen Druck auf den Ausrückerknopf x aus der Ausfräsung
in der Nadelstange ausgehoben, die Feder t kommt zur
Wirkung und Nadelstange wird nach oben aus der Hülse r
herausgezogen. Ein einfacher Druck auf den Kopf der Nadelstange genügt, um dieselbe
wieder mit der Gleitstange O zu verbinden. Die Spulen
ZZ1 für die obere
und untere Nadel sitzen auf Achsen, welche an der Gleitstange O seitlich befestigt sind, und werden in ihrer durch das Abziehen des
Fadens veranlaſsten Drehung durch Druckfedern Z2, deren Wirkung durch Stellschrauben Z3 in bekannter Weise
beeinfluſst wird, geregelt. Diese hierdurch bewirkten Spannungen der Fäden genügen
vollständig zur Herstellung einer festen und gleichmäſsigen Naht, da es bei der
Maschine nicht erforderlich ist, den Faden bei der Stichbildung zeitweilig schlaff
und dann wieder angespannt zu halten, sondern die ganze Arbeit in unter sich stets
gleichbleibenden Fadenspannungen ausgeführt werden kann.
H. G.
Tafeln