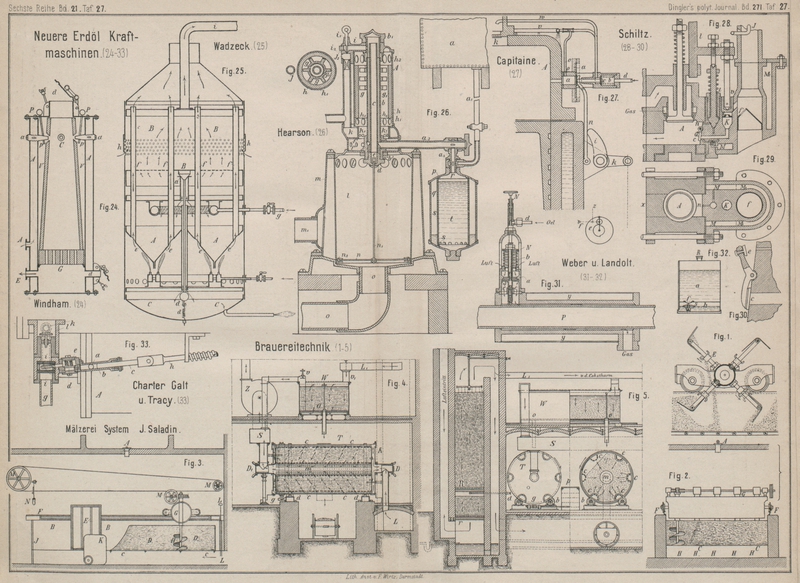| Titel: | Ueber technische Neuerungen auf dem Gebiete der Brau-Industrie (zugleich Bericht über die Stuttgarter Brauerei-Ausstellung); von Prof. Alois Schwarz in Mährisch-Ostrau. |
| Autor: | Alois Schwarz |
| Fundstelle: | Band 271, Jahrgang 1889, S. 538 |
| Download: | XML |
Ueber technische Neuerungen auf dem Gebiete der
Brau-Industrie (zugleich Bericht über die Stuttgarter Brauerei-Ausstellung); von Prof.
Alois Schwarz in Mährisch-Ostrau.
(Fortsetzung des Berichtes S. 351 d.
Bd.)
Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 27.
Neuerungen auf dem Gebiete der Brau-Industrie.
Einen anderen neuen Staubsammler hatte die Maschinenfabrik Gg. Kiefer in Feuerbach-Stuttgart in der Ausstellung vorgeführt, welcher
auf ähnlichem Prinzipe wie der vorbeschriebene beruht.
Textabbildung Bd. 271, S. 538Dieser Staubsammler besteht, wie nebenstehende Abbildung zeigt, aus zwei,
vier, sechs oder acht Flanellschläuchen, durch welche die eintretende, mit Staub
geschwängerte Luft staubfrei durch den Flanell in das Freie tritt, und geschieht die
Reinigung des von Staub zugelegten Flanelles wie folgt: An dem vorderen Haupte der
Maschine befindet sich der Automat (Abklopfer), dessen Einrichtung so getroffen ist, daſs nur zwei
Schläuche zusammen abgeklopft werden, während die übrigen in Thätigkeit bleiben und
somit der regelmäſsige Gang der zuströmenden Luft nicht im Geringsten beeinträchtigt
wird. Bei den in Abklopfung befindlichen Schläuchen wird der unterhalb am Schlauche
befestigte schwere Ring mittels einer Kette vom Automaten hoch gezogen und plötzlich
fallen gelassen, wodurch 4 bis 8 Stränge, welche den Belastungsring tragen, mit
Kraft gegen die Wandung des Flanelles geschlagen werden und zwar so, daſs selbst die
feinsten Staubtheilchen, welche sich in den Poren des Flanelles festgesetzt,
herausfallen müssen, um so mehr, da sich diese kräftige Abklopfung alle 10 Minuten
bei jedem einzelnen Schlauche 6 mal hinter einander wiederholt.
Der abgeklopfte Staub, welcher inzwischen durch eine geeignete Vorrichtung
aufgefangen worden ist, wird seitlich durch eine Schnecke oder durch Sackrohre
direkt in Säcke befördert, und beide Schläuche erhalten nach der Abklopfung wieder
freien Einzug der Luft.
Diese neue Anordnung des hier beschriebenen Staubsammlers bietet die gröſste
Sicherheit für Explosionsgefahr, indem sich die von Staub angefüllte Luft nur in
Flanellumhüllungen (Flanellschläuchen) befindet, und bei einem derartigen
Vorkommnisse sich nur ein Riſs in denselben bilden könnte, wo sich dann die
Staubluft mit der atmosphärischen Luft vermischen würde.
Die Schläuche werden auch häufig mit schwachen Jalousien umkleidet, welche die
entströmende Luft nach oben weisen und ein unmittelbares Berühren der Schläuche
unmöglich machen. Der Antrieb des Automaten ist sehr einfach, da er von unten oder
oben oder auch von der Seite angetrieben werden kann.
Andere Constructionen von Staubcollectoren (Patent Printz) waren von Eugen Kreiſs in Hamburg und
auch von Amandus Kahl in Hamburg in Betrieb vorgeführt
worden.
Die Patent-Staub-Collectoren werden mit auſserordentlichem Vortheile überall da
angewendet, wo es sich darum handelt, Staub, gleichviel welcher Art – er mag also
noch so fein, trocken oder feucht, faserig, klebrig u.s.w. sein – von Maschinen oder
aus Räumen zu entfernen, sei es behufs Gewinnung zur Wiederverwerthung oder aus
gesundheitlichen Gründen zur Reinigung der Luft, wie z.B. auch in Mälzereien. Diese
Staubcollectoren können so nahe als möglich an die betreffenden Maschinen oder
Staubquellen gerückt werden, saugen den hier entstehenden oder auch den in einem
Raume schwebenden Staub auf, sammeln denselben an, und es kann die völlig gereinigte
Luft in demselben Raume entweichen. Der Kraftbedarf zum Betriebe der Vorrichtung an
und für sich, abgesehen von dem Bläser, ist sehr unwesentlich; der Antrieb der
Filtertrommel erfolgt durch einen nur 50mm breiten
Riemen. Es findet bei den neuen Staubsammlern die Reinigung des Filtertuches in der
Weise statt, daſs nach und nach die einzelnen Zellen des Filterkörpers abgeklopft
werden, unter gleichzeitiger Anwendung eines kräftigen, pulsirenden Luftstromes,
welcher an der betreffenden isolirten Zelle des Filters von entgegengesetzter Seite
wirkt, wodurch der an dem Filterstoffe zurückgehaltene Staub sowohl abgeklopft als
abgeblasen wird. Die Abklopfung geschieht jedoch nicht gegen den Filterstoff,
sondern gegen den Rahmen desselben. Durch diesen Abklopfer in Verbindung mit
Gegenwand fällt der losgelöste Staub in eine Schnecke, welche denselben seitlich
herausbefördert, während völlig gereinigte Luft den Apparat verläſst, und werden
selbst die noch fest an dem Filtertuche haftenden Staubtheilchen wirksam entfernt
ohne Abnützung des Filterstoffes, welcher daher von sehr langer Dauer ist.
Von den in das Gebiet der Mälzerei schlagenden Apparaten fand die von Eugen Kreis in Hamburg in Betrieb vorgeführte neue
Förderspirale, als neues Förderelement, groſse Beachtung, und zwar war eine von
100mm und eine von 200mm Durchmesser mit einer Leistungsfähigkeit von 80
bezieh. 400 Centnern in der Stunde ausgestellt. Dieses neue Förderelement besteht
aus einer cylindrischen Drahtspirale von besonderem Querschnitt, welche wie die
bekannte Förderschnecke sich in einem Gerinne um ihre Achse dreht. Die Drahtspirale
wirkt direct nur auf einen sehr geringen Theil des zu fördernden Gutes, sie setzt
nur den äuſseren Mantel des innerhalb der Spirale befindlichen Gutes in Bewegung,
die sich dem letzteren, sowie auch dem über der Spirale befindlichen Theilchen in
Folge der Adhäsion mittheilt. Durch Vorwärtsbewegen dieses äuſseren Mantels wird
sowohl der innere Kern als auch das über der Spirale befindliche Gut mitgeführt,
gleichsam mitgetragen, so daſs durch Erhöhung des Gerinnes die Leistung sich
entsprechend steigern läſst. Ein Vermengen oder Zerreiben des Fördergutes findet
nicht statt. Der Spiraldraht besitzt einen besonderen, rechteckigen Querschnitt,
wodurch der bei rundem Draht vorhandene Uebelstand des Keilschubes, d.h. des
Festklemmens des Fördergutes zwischen der Rundung des Drahtes und dem Boden des
Troges, sowie die Schwierigkeiten einer dauerhaften Verbindung zwischen dem runden
Draht, der Stütze und der Achse gänzlich vermieden und gröſsere Leistung, sowie
leichterer Gang erzielt ist. In Folge der Vortrefflichkeit der Vorrichtung ist
dieselbe auch bereits in vielen Tausenden Metern Länge ausgeführt.
Eine gleichfalls ausgestellte neue Construction von Transportschnecken, Patent Röſsler und Reinhard, zeigte wesentliche Verbesserungen
gegenüber den üblich angewendeten Formen von Transportschnecken, indem bei derselben
die Flügel aus starkem Eisenblech gestanzt (nicht gegossen) sind und die
Befestigungslasche nach einem eigenen Verfahren umgebogen erscheint, wodurch eine
sehr groſse Versteifung des Flügels erzielt wird und ein Abbrechen derselben, wie
dies bei Guſseisenflügeln häufig, kaum möglich ist. Diese Flügel werden mit der
Höhlung der Lasche auf
die Welle gelegt und mittels einfacher Kopfschraube auf derselben befestigt. Das
Gewicht einer solchen Schnecke beträgt bei einem Durchmesser von 25cm in haltbarer Ausführung bloſs 8k auf den laufenden Meter, während
Transportschnecken gleichen Durchmessers mit Guſseisenflügeln entsprechend 20 bis
40k wiegen.
Ein sehr interessanter Apparat, welcher als Zugehör zu den Malzputzmaschinen
anzusehen ist, nämlich ein Magnetapparat, war von Scholl und
Auer in Göppingen ausgestellt. Diese Apparate bezwecken das Ausscheiden von
Eisentheilen aus Getreide und Malz und werden gewöhnlich auf dem Trichter der
Schrotmühlen derart angebracht, daſs sämmtliches Malz den Magnet passiren muſs, der
etwa im Malz enthaltene Eisentheile, welche beim Durchgehen durch die Walzen
dieselben beschädigen könnten, zurückhält; die Apparate sind auch mit selbstthätiger
Abstreifvorrichtung versehen, durch welche die an dem Magnete haftenden Eisentheile
seitlich abgehoben werden.
Eine zweite von dieser Fabrik ausgestellte Magnetmaschine dient zum Trennen der
Eisen- und Stahltheile aus Metall-, Dreh-, Bohr- und Feilspänen und ist für
Metallwaarenfabriken von groſsem Werth.
Unter den zahlreich ausgestellten Gerstesortir- und Putzmaschinen waren meistens
bekannte Constructionen, und nur wenige neue Einrichtungen vertreten. Bloſs Amandus Kahl in Hamburg hatte eine neue Wasch- und
Reinigungsvorrichtung für Gerste ausgestellt. Dieser Apparat, Patent Niederer-Kahl, besteht aus zwei Theilen, dem
wagerechten „Scheideapparat,“ in welchem sämmtliche Verunreinigungen der
Gerste durch einen Wasserstrom abgeschieden werden, und einem senkrechten Cylinder,
der sogenannten „Waschcolonne,“ in welchem eine senkrechte mit Schaufeln
besetzte Welle rotirt. Im unteren Theile dieses Cylinders wird die Gerste gewaschen
und durch die Schaufeln nach aufwärts gehoben, wobei gleichzeitig das abflieſsende
Wasser sammt den Verunreinigungen durch Centrifugalkraft weggeschleudert und auch
noch durch den Drahtmantel des Flügelwerkes die anhaftende Spreu abgeschieden wird.
Einrichtung und Betrieb dieser neuen beachtenswerthen Waschvorrichtung sind
folgende: Durch den linksstehenden wage rechten Theil der Maschine, dem sogenannten
Scheideapparat, welcher mehrere Abtheilungen hat, wird ein flieſsender Wasserstrom
(entweder kann kaltes oder auch Condensationswasser angewendet werden) geführt, und
so rasch, wie das Wasser läuft, trennen sich von dem guten Getreide je nach
specifischer Schwere in den respectiven Abtheilungen: Abschwamm, etwa noch
vorhandene Strohstückchen, Hülsen, Unkräuter, Holztheilchen u.s.w., halb gesunde,
faule, brandige u.s.w. Körner, Steine, Metalltheilchen u.s.w., kurzum alle fremden
Beimischungen der Frucht, die schwerer als letztere sind. Nachdem nun dem Getreide
die gröſsten Unreinigkeiten und schlechten Bestandtheile genommen, laufen sowohl die
schweren als auch die gesunden Körner, die sich aus zwei Abtheilungen
vereinigen, zusammen durch einen Trichter in die senkrechte Waschcolonne. Hier wird
das Getreide mittels Centrifugalkraft rationell gewaschen, worauf alsdann beim
Austritt aus diesem Apparat eine nochmalige Behandlung mit Luft erfolgt. Je nach den
Verwendungszwecken, z.B. Mälzereien, kann das Getreide, bevor es in die Weiche
kommt, noch einige Zeit unbeschadet auf Haufen lagern, wohingegen das Getreide bei
Vermahlung in Mühlen nach vorbeschriebener Reinigungsprocedur noch eigens
construirte Trockenapparate zu passiren hat.
Die von Amandus Kahl in Hamburg ausgestellte
Gerstesortirmaschine ist bei einfachem gefälligem Bau dauerhaft ganz in Eisen und so
construirt, daſs es einem davorstehenden Mann ermöglicht ist, selbst die gröſsere
Sorte von ebener Erde aus zu speisen. Auch liegt der ganze Arbeitsprozeſs unverdeckt
vor und ist leicht zu übersehen. Die Speise- und die Ausscheidevorrichtung weisen
zwei Verbesserungen auf. Durch erstere wird eine völlig gleichmäſsige Speisung der
Maschine bewirkt, welche auf einfache und schnelle Weise regulirt werden kann, wobei
durch eine Rüttelbewegung jede Verstopfung ausgeschlossen ist. Von einem regelbaren
Windstrom erfaſst, gelangt das nun von seinen leichten Theilen befreite Korn auf ein
sich über die ganze Länge und Breite der Maschine ausdehnendes neues
Patentrüttelsieb. Dieses leicht auswechselbare Sieb ist mit 2 bis 3 verschiedenen
Siebflächen versehen, die in ihrer Lochung je der zu reinigenden Frucht angepaſst
werden und in der Weise gewählt sind, daſs das erste Siebfeld alle kleinen und
dünnen Körner absondert. Die nicht verbleibenden, zum
Durchgange bestimmten gröberen Bestandtheile werden über das Ende des Siebes in eine
Abtheilung abgeführt. Der Durchgang des ersten und dritten Siebes wird je für sich
in einer Abtheilung gleichfalls abgefangen, wohingegen der Durchgang des zweiten,
mittleren Siebes, aus dem Siebgut, wie oben erwähnt, bestehend, nunmehr zum
Hauptziel seiner speciellen Sortirung gelangt, nämlich auf eine um zwei Achsen
rotirende, schräg nach oben gekehrte Auslesefläche, welche aus endlos
zusammengesetzten Platten mit halbrunden, gebohrten Löchern besteht.
Zu den schönsten und bestausgeführten Maschinen dieser Art gehörten unstreitig die
von der bekannten Kalker Trieuerfabrik Mayer und Comp.
in Kalk bei Köln ausgestellten drei Sortirmaschinen nach Krüger's Patent für eine Leistungsfähigkeit von 9,15 resp. 30 Centner in
der Stunde. Es sind dies vereinigte Gerstensortir-, Wicken- und
Halbkörner-Auslesemaschinen von groſser Leistungsfähigkeit und einfacher
Construction, welche sich in vielen Ausführungen vortrefflich bewährt haben. Die
ausgestellten Krüger'schen Patent-Trieurs sind ohne
Rüttelwerk, statt dessen mit einer Absiebetrommel ausgestattet, arbeiten daher
geräuschlos und verursachen nicht das bei anderen Constructionen so störende
Erschüttern des ganzen Arbeitsraumes.
Heinrich Reinhard in München hatte als Neuheit ein
Gefäſs mit Wage zur Bestimmung der Quellreife der Gerste ausgestellt, welches ohne
weitere Untersuchung und Berechnung über das Fortschreiten der Wasseraufnahme in
allen Schichten der Weichmasse Auskunft gibt. Die Wasseraufnahme, nach Procenten
bezeichnet, stellt zugleich eine vergleichende Einheit für alle Mälzereien dar und
ist genauer und verständlicher als die übrigen praktischen Merkmale, oder als die
gebräuchliche Angabe der Weichzeit nach Tagen und Stunden. Das Gefäſs wird mit
200g der einzuweichenden Gerste gefüllt, mit
dem Deckel geschlossen und in die frisch eingeweichte Gerste im Quellstock
gestoſsen. Diese kleine Gerstenmenge weicht somit unter denselben Verhältnissen wie
die groſse Masse. Will man sich von der Wasseraufnahme überzeugen, so kommt das
Gefäſs aus der Weiche und wird in reinem Wasser durchgeschüttelt, damit etwa
anhaftende Unreinigkeit durch die Oeffnungen entfernt wird. Alsdann wird der Deckel
wieder abgenommen und als Ersatz für die Wagschale das Gefäſs angehängt. Die Wage
zeigt die Wasserzunahme in Procenten an, wobei das Gewicht immer auf demselben Punkt
stehen muſs, wie bei der trockenen Gerste.
Die Maschinenfabrik von Franz Hochmuth in Dresden hatte
ihre neuesten verbesserten Malzwender im Betrieb vorgeführt; derselbe hat folgende
Construction: Am Umfange einer hohlen Welle sind wechselseitig Arme eingesetzt,
welche an ihren Enden in Gelenken drehbare, gebogene Schaufeln tragen, wie solche in
der Querschnittzeichnung dargestellt sind (Fig. 1 Taf. 27).
Bei rascher Umdrehung der Wenderwelle bewegt sie sich nur langsam vorwärts, so daſs
bei Eingriff der Schaufeln dieselben nie mehr als nöthig fassen können. Am
Wenderarme sitzt lose eine Hülse E mit zwei kleinen
Greifern, sobald nun die Schaufel zum Eingriff kommt, fällt durch ihr eigenes
Gewicht die Hülse E am Arme herab und hält die Schaufel
so lange fest, bis der Arm eine solch schräge Lage nach oben einnimmt, in welcher
die Hülse durch die eigene Schwere herabgleitet und die Schaufel frei schwingen
läſst. Durch diese Anordnung wird der groſse Vortheil erreicht, daſs das Malz nur
nach und nach von der Schaufel herabgleitet und dabei einen möglichst langen Weg
durch die erhitzte Luft zurücklegt.
Der Antrieb des Malzwenders geschieht durch einen einfachen Mechanismus; derselbe ist
zu beiden Seiten in das Mauerwerk gelegt, da er wenig Raum bedarf, demnach die
Darrbreite der Wenderbreite gleich ist. An den Enden tritt selbsthätig ein
Umschaltungsmechanismus in Thätigkeit, so daſs der Wender ohne jede Aufsicht
selbsthätig vor- und rückwärts arbeitet, demnach jede Controle der Arbeiter
wegfällt.
Die Lager der Wenderwelle sind mit präparirten Metallschalen versehen, welche kein
Oel oder irgend eine Schmierung erfordern.
Die Hülse ist so construirt, daſs sich Staub, Körner und Unreinigkeiten niemals
festsetzen können.
Ein anderer neuer Wendeapparat für Malz, von Friedrich August
Hartmann und Comp. in Offenbach a. M. ausgestellt, zeichnete sich dadurch
aus, daſs derselbe ebenfalls die Ausnützung des Raumes, in welchem das zu wendende
Material ausgebreitet liegt, bei Malz also die Ausnützung der Darrhorde, voll und
ganz gestattet. Es wird dies dadurch erreicht, daſs der gesammte
Bewegungsmechanismus des Schaufelrades auſserhalb der eigentlichen Darrhorde
angebracht ist, so daſs das Schaufelrad die volle Breite des Darrraumes erhalten
kann. Diese eigenartige Anordnung des Bewegungsmechanismus bedingt eine von den
bisher zu dem gleichen Zwecke benutzten Einrichtungen vollständig abweichende
Construction, welche im Wesentlichen aus einem Umlaufgetriebe besteht, das
gleichzeitig die Rotation des Schaufelrades und den Vorschub der Wenderwelle
bewirkt.
Das Schaufelrad ist in bekannter Weise aus einem die Welle ersetzenden Cylinder, den
darauf befestigten Blechscheiben, den radialen Stegen und den in den Scheiben
drehbar gelagerten, aus winkelförmig gebogenen Blechen bestehenden Schaufeln
zusammengesetzt. In den Enden des Cylinders sind die Drehzapfen eingesetzt, welche
in Gehäusen lagern, die in Aussparungen der beiden Seitenwände des Darrraumes
schlittenartig verschiebbar sind. Die Gehäuse haben mit Schraubengewinde versehene
Naben und sind auf je einer zu beiden Seiten der Darrhorde sich über die ganze Länge
des Darrraumes erstreckenden, an den beiden Enden der bezüglichen Wandaussparung
drehbar gelagerten Spindel montirt, so daſs die Gehäuse mit dem Schaufelrad bei der
gleichzeitig erfolgenden Drehung der beiden Spindeln in der einen oder anderen
Richtung langsam über die Darrhorde vor- oder zurückgeschoben werden. In jedem
Gehäuse ist zwischen den beiden Naben eine mit ihrer Nabe auf der Spindel
verschiebbare Schnecke angeordnet, welche mit dem bezüglichen der beiden auf den
Drehzapfen des Schaufelrades befestigten Schneckenräder in Eingriff steht. Die Nabe
jeder Schnecke greift mit einer Feder in eine Nuth, welche über die ganze Länge in
jede der beiden Spindeln eingeschnitten ist, so daſs sich die beiden Schnecken bei
der Drehung der Spindeln mit diesen mitdrehen müssen, hierbei aber auch mit den
Gehäusen längs der Spindeln vorbezieh. zurückgleiten können.
Durch die Drehung der Schnecken werden die Schneckenräder und hierdurch der Cylinder
mit den Schaufeln in Bewegung versetzt.
Die eine Spindel des erstbeschriebenen Umlaufgetriebes ist als Welle durch die
Stirnwand des Darrraumes hindurch verlängert und hier mit einer Klauenkuppelung
versehen, welche durch Umlegen des Hebels mit der einen oder anderen der beiden lose
und in entgegengesetzten Richtungen laufenden Riemscheiben gekuppelt wird, so daſs
hierdurch die Welle
und die Spindel je nach Bedarf in Rechts- bezieh. Linksdrehung versetzt werden
können. Damit nun diese Umkehrung der Drehungsrichtung der Spindeln jedesmal, wenn
das Schaufelwerk an dem einen oder anderen Ende der Darrhorde anlangt, selbsthätig
erfolgt, ist der soeben erwähnte Hebel durch eine Schiebstange mit einem durch ein
Gewicht belasteten, zweischenkligen Hebel verbunden, welcher nahe am vorderen Ende
des Darrraumes in geeigneter Weise drehbar an einer an der Wand befestigten Platte
angebracht ist.
Ein auf dem bezüglichen Gehäuse befestigter Anschlag stöſst gegen Ende des Vorschubes
des Schaufelwerkes gegen das untere Ende des zweiten Hebels, legt diesen und damit
auch den ersten, den Kuppelungshebel, allmählich um, schaltet hierdurch die
Kuppelung zwischen der Spindel und der rechts liegenden Riemscheibe aus und kuppelt
dieselbe mit der zweiten sich entgegengesetzt drehenden Riemscheibe, so daſs die
durch ein Kettengetriebe miteinander verbundenen Spindeln nunmehr nach
entgegengesetzter Richtung in Drehung versetzt und das Schaufelwerk bei
entgegengesetzter Schaufelwirkung wieder langsam zurückbefordert wird.
Am anderen Ende der Darrhorde stöſst der Anschlag ebenfalls gegen einen dritten
Hebel, welcher mit dem zweiten Hebel durch eine Schubstange verbunden ist. Mit dem
Umlegen des dritten Hebels wird also auch wieder der Kuppelungshebel umgelegt, die
Kuppelung aus der links befindlichen Riemscheibe ausgelöst und in die rechts
befindliche Riemscheibe eingeschaltet, so daſs also die Rotation der Spindeln und
damit die Bewegung des Schaufelwerkes wiederum wechselt.
Die Kuppelung mit der betreffenden Riemscheibe wird bis zur nächsten Umsteuerung
durch das am zweiten Hebel angebrachte Gewicht gesichert.
Beim Abstellen des Apparates wird der erste Hebel mit der Kuppelung durch Einklinken
eines Ueberwurfhebels in Mittelstellung gesichert.
Eine sehr interessante, wenn auch schon seit einigen Jahren bekannte Neuerung war von
der Berliner Actiengesellschaft für Eisengieſserei und
Maschinenfabrikation in Charlottenburg zur Ansicht gebracht worden, nämlich
das Verfahren der pneumatischen Mälzerei nach dem Trommelsysteme Patent Galland. Es war ursprünglich beabsichtigt gewesen,
einen solchen Apparat in vollständiger Ausführung in der Ausstellung in Betrieb zu
setzen, was sich jedoch aus technischen Gründen als undurchführbar erwies, weshalb
dieses System bloſs durch groſse in Farben ausgeführte Tafeln den Besuchern zur
Darstellung gebracht worden war. Wir reproduciren diese Tafeln, indem wir
gleichzeitig eine ausführliche Beschreibung dieses Mälzereisystemes geben (Fig. 4 und 5 Taf. 27).
Ein gemauerter oder eiserner Koksthurm ist unten mit einem Roste r, worauf eine niedrige Koksschicht ruht, und über
demselben, mit kleinem Zwischenraume mit noch einem Rost R mit höherer
Koksschicht versehen. Unter den untersten Rost wird möglichst reine und daher Luft
aus der Höhe zugeleitet. Oberhalb vom Koks ist ein sogen. Anschwänzer s angebracht, der, sich drehend, in feiner Vertheilung
frisches Brunnenwasser von etwa 8 bis 10° R. über den Koks niederrieselt und auf
letzteren also in gröſster Oberfläche vertheilt. Der Raum über dem Anschwänzer steht
in Verbindung mit einer Windzuleitung L und L1, zu den
Malzapparaten gehend, und mit einer Windableitung S,
von diesen zu einem Exhaustor (Ventilator) Z führend.
Wenn letzterer saugt, so tritt unter den Rost frische Auſsenluft, durchstreicht den
Koks, wird gereinigt, sättigt sich an dem in gröſster Oberfläche vertheilten Wasser,
dieses theilweise verdunstend, mit Wasserdampf, und weil hierzu Wärmebindung nöthig
ist, so kühlt sich die selbst im heiſsesten Sommer etwa mit 28° R. eintretende Luft
bei diesem Prozesse bis auf 9 bis 11°, voll gesättigt mit Wasserdampf, ab. Im
Winter, wo die Luft mit groſser Kälte, also unbrauchbar für die Mälzerei, unter dem
Roste eintritt, wird durch ein in den freien Raum zwischen beiden Kokslagen
eingeführtes kleines Dampfrohr d vom Dampfkessel so
viel Dampf zugeleitet, daſs die Temperatur der oben aus dem Koksthurme den Apparaten
zugeführten feuchten Luft ebenfalls 9 bis 11° beträgt. Dampf- und Wasserzuführung in
den Koksthurm sind je nach den Auſsentemperaturen durch Ventile regulirbar. So ist
für jede Jahreszeit in einfachster Weise das geeignete Mälzungsklima, bestehend in
voll mit Wasser gesättigter, gereinigter kühler Luft, hergestellt, welche in
nachstehender Weise zum Wachsen der Gerste Verwendung findet.
Das Einquellen der Gerste geschieht im Weichkasten W.
Nachdem das Einweichen der Gerste in gewöhnlicher Weise vorgenommen und das letzte
Wasser abgelassen ist, verbleibt das gequellte Gut noch 1 bis 2 Tage in dem mit fein
gelochtem Doppelboden versehenen Weichkasten, welcher dann oben mit einem luftdicht
abschlieſsenden Plan abgedeckt wird. Die Ventile v und
v1 werden geöffnet
und unter Durchsaugung von frischer gekühlter Luft wird das Anspitzen der Gerste
begünstigt, indem dieselbe kühl gehalten und die sich bildende Kohlensäure abgesaugt
wird. Unten in den Weichkästen sind ventilartig abgeschlossene Oeffnungen o, durch welche nach der genannten Anspitzzeit das
Keimgut in die unterhalb der Weichkasten placirten Keimtrommeln T niedergelassen wird, worin der Keimungsprozeſs weiter
vor sich geht.
Die Keimtrommeln sind unten auf 2 Paar Rollenböcken b
gelagerte und mittels Schneckenradgetriebe g in etwa 40
Minuten einmal herumdrehbare Blechcylinder, von denen jede an einer Seite eine mit
der Feucht-Windleitung L mittels eines
Regulirdrehschiebers D in Verbindung stehende
Luftkammer k hat, von welcher am äuſseren Umfange der
Trommel halbkreisförmige, ganz fein gelochte Kanäle c
die Trommelcylinder der
ganzen Länge nach durchziehen. Von der anderen Seite steht ein in der Mitte der
Trommel angebrachtes, ebenfalls fein gelochtes Mittelrohr m, auch absperrbar und regulirbar, mittels eines Drehschiebers D1 in Verbindung mit
der Windabsaugeleitung S. Dieses Mittelrohr hat jedoch
keine direkte Verbindung mit der Luftkammer k; es kann
daher die vom Ventilator gesaugte Luft die Trommel nur in der Richtung der
eingezeichneten Pfeile durchstreichen. Jede Keimtrommel hat am Umfange zwei um etwa
120° versetzte, ganz leicht zu öffnende und dicht abschlieſsende Thüren zum Ein- und
Auslassen der gequellten Gerste bezieh. des Grünmaizes. Durch das sehr langsame
Drehen der Trommel bleibt die Oberfläche des Inhaltes nicht wagerecht stehen,
sondern nimmt eine schräge Fläche an, auf welcher allmählich abrieselnd das
wachsende Keimgut ohne irgend sonstige gewaltsame mechanische Beihilfe gewendet wird
und somit vor Zusammenwachsen (Verfilzen) in der einfachsten und die zarten
Würzelchen schonendsten Weise absolut sicher bewahrt bleibt. Jede sich in 40 Minuten
einmal herumdrehende Trommel läſst das eingefüllte gequellte Gut, je nach der
Temperatur, mit welcher man den Keimungsprozeſs führt, in 7 bis 9 Tagen fertig
wachsen und zwar in der gleichmäſsigsten Weise mit vorzüglichster Lösung. Bei der
constanten Zuführung von voll mit Wasser gesättigter und gereinigter Luft wird die
sich bildende Kohlensäure stetig abgeführt, und ein Abtrocknen des Malzes kommt in
dem kleinen Raume der Trommel nicht vor. Schimmelbildung ist selbst bei halben
Körnern ausgeschlossen.
Zur jederzeitigen Beobachtung und entsprechenden Regulirung der Temperaturen des
wachsenden Malzes im Inneren der Trommeln hat jede derselben an jeder der Stirnwände
ein Thermometer. Zeigt sich bei einer Trommel für das Stadium des darin wachsenden
Gerstenhaufens zu hohe oder zu niedere Temperatur, so wird solche Differenz durch
Drehen des Windregulirhahnes D und dementsprechende
Durchführung von mehr oder weniger gekühlter Luft durch diese Trommel in kürzester
Zeit wieder auf den normalen Standpunkt regulirt. Ferner kann zu jeder Zeit auch von
dem zwischen je 2 Trommeln angebrachten Podium p aus,
durch Oeffnen einer der Thüren in der Mitte der Trommeln der Haufen mit Leichtigkeit
gradirt und beobachtet werden. Es können auſser den Thüren auch noch Fenster zum
Einblicke in die Trommeln angebracht werden.
Ist das Grünmalz hinreichend ausgewachsen, so wird mit dem Zuführungsdrehschieber D die feuchte Luft von der betreffenden Trommel
abgesperrt und eine im Deckel dieses Drehschiebers angebrachte Thür geöffnet, so
daſs gewöhnliche trockene Atmosphäre durch das Grünmalz gesaugt wird, welche ein
Abschwelken und Abtrocknen nach Belieben in einfachster Weise bewirkt.
Das so fertige Grünmalz wird durch eine nach unten gestellte Thür in untergefahrene Kippwagen
entleert, und dies durch Nachstoſsen durch die zweite schräg nach oben gerichtete
Thür nachhelfend von dem zwischen je 2 Trommeln angebrachten Podium p aus erleichtert.
Mit dem pneumatischen Grünmalzapparate, Trommelsystem Galland, kann man bei dem mit Leichtigkeit und in einfachster Weise
hergestellten künstlichen Klima das ganze Jahr hindurch mälzen. Rechnet man jedoch
zur Generalsäuberung und Neulackirung der Apparate und Räume im Jahre etwa 4 Wochen
ab, so kann man eine jährliche Arbeitszeit bei diesen Apparaten von 335 bis 340
Tagen annehmen, gegenüber einer Arbeitsdauer von durchschnittlich 220 bis 230 Tagen
auf den gewöhnlichen Tennen. Dementsprechend kann jede Trommel in vorstehend
genannter Campagne 41 bis 42 mal fertiges Grünmalz ausleeren. Durch die gleichmäſsig
niedrig gehaltene Temperatur der Haufen in den Trommeln während der Keimzeit ist der
Verlust der Gerste an nutzbarer Substanz geringer als bei dem Wachsthume auf den
Tennen, so daſs die Ausbeute an Malz eine erhöhte ist. Bei Anwendung der Galland'schen Keimtrommelapparate gebraucht man zur
Herstellung des gleichen Malzquantums nur etwa ⅕ des Raumes wie bei gewöhnlichen
Tennen.
Wegen des geringen Platzes, den die Apparate einnehmen, lassen sich dieselben mit
Leichtigkeit in vorhandenen Gebäuden unterbringen. Es ist fast gleichgültig, ob die
Keimtrommeln im Keller oder in hochgelegenen Räumen Aufstellung finden.
Abgesehen von der enormen Ersparniſs an Terrain stellen sich die Kosten der Anlage
einer gewöhnlichen Tennenmälzerei durchschnittlich 45 bis 50 Proc. höher als eine
solche mit Galland's Trommelapparaten bei gleichen
jährlichen Productionen an fertigem Malze.
Die benöthigte Wassermenge ist für das Einweichen der Gerste bei dem pneumatischen
Verfahren genau dieselbe, wie bei der Tennenmälzerei. Man kann dafür ziemlich genau
für den Tag das 10fache von dem Gewichte der täglich einzuweichenden Gerste rechnen,
so daſs bei einer täglichen Verarbeitung von 5000k
Gerste für alle Weichkästen in 24 Stunden etwa 50000k = 50cbm Wasser für das Einweichen
verbraucht werden. Als Kühlwasser für die Koksthürme wird in den Wintermonaten
Oktober bis Ende März ungefähr dasselbe Quantum beansprucht wie zum Einweichen; es
vermehrt sich das Quantum allmählich mit der zunehmenden Auſsentemperatur, jedoch
wird für die Koksthürme in den allerheiſsesten Sommertagen höchstens die 3½fache
Wassermenge gebraucht als im Winter.
Bei der so überaus einfachen und sicheren Regulirbarkeit aller Factoren, welche bei
der pneumatischen Trommelmälzerei in Betracht kommen, ist das nöthige
Arbeitspersonal auf das denkbar geringste Minimum gebracht. Ein Mann bei Nacht,
welcher zugleich Maschinist sein kann, ist in der Lage, die Beobachtung und
Regulirung der Temperaturen vorzunehmen für eine Mälzerei von mehreren Serien
Trommeln unbeschadet
ihrer Gröſse. Desgleichen genügt für den Tagesbetrieb ein Mann für die Beobachtung
und Regulirung. Nur während der Zeit des Ausleerens einer Trommel und Weiche sind
zur Fortschaffung und Hochförderung des Grünmalzes zur Darre je nach Gröſse der
Apparate noch 2 bis 3 Mann auf 1½ bis 2 Stunden zur Hilfe zu stellen.
Die Betriebskosten einschlieſslich der maschinellen Betriebskraft lassen sich je nach
den Gröſsen der Anlagen für die Grünmalzfabrikation bis zu 0,3 der Betriebskosten
eines Tennenbetriebes reduciren.
Ein zweites, ebenso häufig als das vorbeschriebene in der Praxis eingeführte System
der pneumatisch-mechanischen Mälzerei, das von Saladin,
für welches die Maschinenfabrik Beck und Rosenbaum's
Nachfolger in Darmstadt das alleinige
Ausführungsrecht für Deutschland erworben hat, war wohl in der Ausstellung nicht
vorgeführt, doch hatte die genannte Firma an alle Ausstellungsbesucher ein Circular
ergehen lassen, in welchem dieselben zur Besichtigung der an den Reiserouten der
Ausstellungsbesucher befindlichen Anlagen von pneumatisch-mechanischen Mälzereien
nach System Saladin eingeladen wurden.
Das Wesen des Saladin'schen Verfahrens besteht in
Folgendem: Die geweichte Gerste wird in einen besonderen Keimkasten ausgestoſsen, in
welchem sie vom Beginne bis zur Beendigung des Wachsthumes ununterbrochen verbleibt.
Sie liegt in demselben auf einem Siebboden, unter welchem sich eine Luftzuführung
befindet, welche mittels einer Klappe verschlieſsbar ist, und von der aus auf eine
bestimmte Temperatur gebrachte feuchte Luft durch das Malz von unten her gedrückt
werden kann. Durch diese gleichmäſsige Zuführung von Luft, welche vorher auf eine
bestimmte Temperatur gebracht worden ist, wird die Temperatur des Haufens auf einer
bestimmten, gewünschten Höhe, und die Luft im Haufen rein erhalten (von Kohlensäure
befreit, der Sauerstoff ersetzt). Die zugeführte Luft wird auſserdem vor der
Zuführung mit Feuchtigkeit gesättigt, um ein Austrocknen des Malzes zu verhindern.
Wird ein Schwelken des Malzes nach beendetem Wachsthume gewünscht, so kann dies in
demselben Kasten, in dem das Malz gewachsen ist, durch Zuführung von trockener
warmer Luft ausgeführt werden (Fig. 2 und 3 Taf. 27).
Das Auflockern des Malzes wird bei dem Saladin sahen
Verfahren nicht wie auf der Tenne durch Handarbeit bewirkt, sondern es dient zu dem
Zwecke ein besonderer mechanischer Apparat, welcher „Wender“ oder richtiger
„Auflockerer“ genannt wird. Im Wesentlichen besteht derselbe aus einem
sich selbsthätig fortschiebenden eisernen Wagen, welcher auf Schienen über dem
Keimkasten hin und her laufend korkzieherartige Auflockerungsschrauben trägt,
welche, bis auf den Boden des Kastens reichend und sich um die eigene Achse drehend,
bei der Vorwärtsbewegung des Wagens über dem keimenden Malze hin dieses durchfurchen
und die Keime, die in einander gegriffen haben, trennen.
Auch um die dem Malze zuzuführende Luft auf die gewünschte Temperatur zu bringen und
mit Feuchtigkeit zu sättigen, bedient sich das Saladin'sche Verfahren eines besonderen, „Umwechsler“ (Changeur)
genannten Apparates, welcher aus einer oder mehreren Trommeln besteht, deren Mantel
von mehrfachen Lagen von Siebblech gebildet wird, und welche in ein Wasserbecken
tauchen, dessen Wasser durch ein Schlangenrohr beliebig mit Dampf angewärmt oder mit
Eiswasser gekühlt werden kann. Durch diese sich langsam drehenden Umwechsler wird
die Luft, welche das Malz durchstreichen soll, durch einen Ventilator gepreſst und
nimmt auf dem Wege durch die Siebblechlagen, welche das temperirte Wasser des
Beckens durch Adhäsion mitnehmen, nicht nur die gewünschte Temperatur an, sondern
sättigt sich auch mit Feuchtigkeit.
Die Keimkästen bestehen aus cementirtem Mauerwerke. Auf der Seite des Hauptganges
sind sie offen, können aber hier durch eine Eisenblechwand ebenfalls geschlossen
werden. In einer Höhe von 70cm über dem Boden
befindet sich der oben genannte Siebboden CC (Fig. 2 und 3), auf welchem
das Malz D liegt. Derselbe besteht aus 18 einzelnen
Rahmen, welche an den beiden Längswänden des Keimkastens drehbar befestigt sind und
von der Mitte des Kastens aus zur Hälfte nach rechts zur Hälfte nach links hin
hochgeklappt werden können, so daſs der ganze innere Kastenraum frei und zugänglich
wird, in ähnlicher Weise, wie die Flügel einer Flügelthür sich öffnend den Durchgang
gestatten. Diese Einrichtung erleichtert die Leerung der Kästen auſserordentlich und
gestattet auch eine sehr gründliche und schnelle Reinigung der Kästen.
Der oben erwähnte Saladin'sche „Auflockerer“ ist
in Fig. 2 und
3 Taf. 27
im Durchschnitte und in Vorderansicht dargestellt. Derselbe besteht aus einem hohlen
Metallcylinder G, an dessen beiden Enden Querleisten
mit je zwei Rollen FF angebracht sind, welche auf den
Längswänden des Keimkastens in Schienen laufen, so daſs der Cylinder auf dem
Keimkasten der ganzen Länge desselben nach entlang gefahren werden kann. Quer durch
den Cylinder ragen 5 Schaufeln H, welche eine Schnecke
von doppelter Schraubenwindung bilden, bis auf das Siebblech hinabreichen und zum
Auflockern des Malzes dienen. In dem Cylinder, parallel mit der Achse, aber unter
ihr, befindet sich eine Welle, welche an beiden Enden einen Zahnstern trägt, welcher
in eine in die Längswand des Keimkastens eingelassene Zahnstange eingreift. Diese
Welle wird, durch eine Zahnradübersetzung mittels des Baumwollseiles MM gedreht und bewirkt durch ihr Eingreifen in die
Zähne der Zahnstange die Vorwärtsbewegung des ganzen Auflockerers. Gleichzeitig wird
durch denselben Antrieb eine auf dem Cylinder liegende Schnecke in Umdrehung
versetzt, welche in die an den Schaufeln h angebrachten
Zahnräder eingreift und so jedem für sich eine drehende Bewegung ertheilt, so daſs diese Schaufele
während des allmählichen Vorschreitens des Auflockerers das Malz durchfurchen und
das Keimgut von unten nach oben heben und drehen. Ist der Auflockerer an einem Ende
des Bassins angekommen, so muſs er sofort ausgerückt (bei N) werden, da er sonst beginnt, den Weg rückwärts zu machen, weil die
Zahnstange am Kopfe so eingerichtet ist, daſs der Wender am Ende angekommen alsbald
in die entgegengesetzte Bewegung übergeht. Dieser Uebergang wird aber auch aus der
Entfernung für den Mälzer sichtbar durch besondere Einrichtung der
Zahnradübersetzung, so daſs er auch, wenn er in einem entfernten Theile des
Bassinraumes beschäftigt ist, bei der langsamen Bewegung der Auflockerer Zeit genug
hat, das Ausrücken zu bewirken. Die Handhabung dieser Auflockerer ist eine einfache,
ihre Leistung durchgreifend und elegant. – Die Vorzüge dieses Verfahrens sind die
gleichen als die bereits beim vorhergehenden ausführlich besprochenen, welche
überhaupt der pneumatischen Mälzerei einen Vorzug vor der Handmälzerei geben.
Tafeln