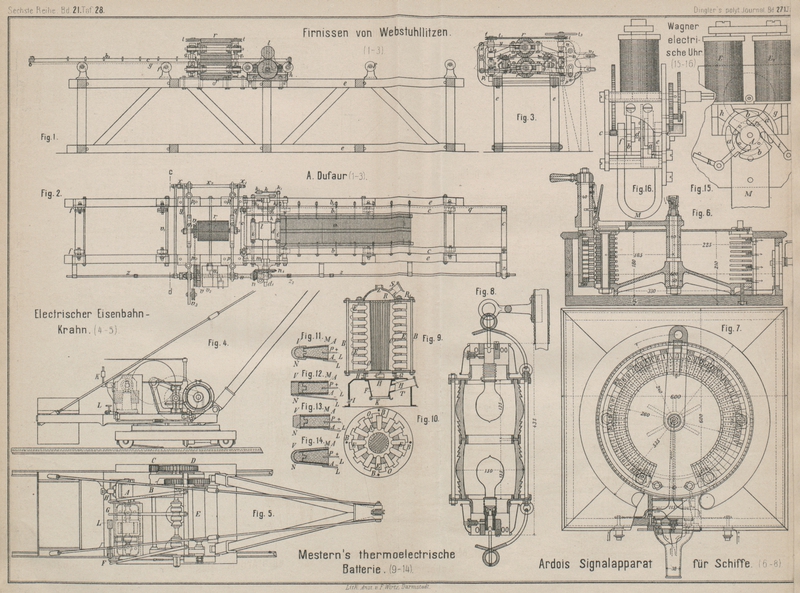| Titel: | H. Mestern's ofenförmige thermo-elektrische Batterie. |
| Fundstelle: | Band 271, Jahrgang 1889, S. 558 |
| Download: | XML |
H. Mestern's ofenförmige thermo-elektrische
Batterie.
Mit Abbildungen auf Tafel
28.
H. Mestern's ofenförmige thermo-elektrische Batterie.
Eine Schwäche der gewöhnlichen thermo-elektrischen Oefen liegt in der Schmelzbarkeit
der als Elektroden angewendeten Legirungen und der dadurch veranlaſsten
Unterbrechung des Stromes; daſs ferner die Elemente dem Feuer und den Feuergasen
ausgesetzt sind, befördert nicht nur ihr Schmelzen, sondern schwächt auch den von
ihnen gelieferten Strom. Dem will H. Mestern in München
dadurch abhelfen, daſs er (nach seinem englischen Patente Nr. 2259 vom 14. Februar
1888) den Elementen die in Fig. 11 und 12 Taf. 28
dargestellte Anordnung gibt.
Die positive Elektrode P ist aus Antimon und Zink oder
einer anderen geeigneten Legirung gemacht und durch Schwalbenschwanz mit der
negativen N verbunden, die aus Kupfer und Nickel
hesteht. Eine isolirende Schicht Asbest A trennt den
aus Eisen oder einem anderen widerstandsfähigen Metalle hergestellten Schutzmantel M von der positiven Legirung und wirkt zusammen mit
einer Verstärkungskappe V als Ableiter für die negative
Elektrode. L und L sind
aus einer Nickel-Kupfer-Legirung hergestellte Ableitungsstücke.
In Fig. 11 ist
die Kappe V so geformt, daſs sie das elektro-negative
Metall umschlieſst und den Schutzmantel M sichert. In
Fig. 12
bildet die Kappe einen Wärmeleiter, der vom Mantel M
umgeben und festgehalten wird, während in Fig. 13 der Mantel M den Leiter V nicht
umgibt. In der Abänderung nach Fig. 14 besteht Mantel
und Kappe aus einem Stücke M.
In Fig. 9 und
10 ist
eine aus den Elementen E aufgebaute Batterie
dargestellt. Der Körper des Ofens ist aus Asbest oder anderem Material gebildet und
so ausgeführt, daſs die Elemente leicht eingesetzt und herausgenommen werden können.
Ein Gitter R von Eisenstäben ist in den Ofen eingesetzt
und wird mit Koks durch den Trichter S gefüllt. Der
Aschenkasten F ist durch einen darüber liegenden Rost
abgeschlossen; das Brennmaterial wird durch den Trichter T eingeführt. Die Luft tritt bei H und I ein, der Rauch entweicht durch das Rohr Z.
Tafeln